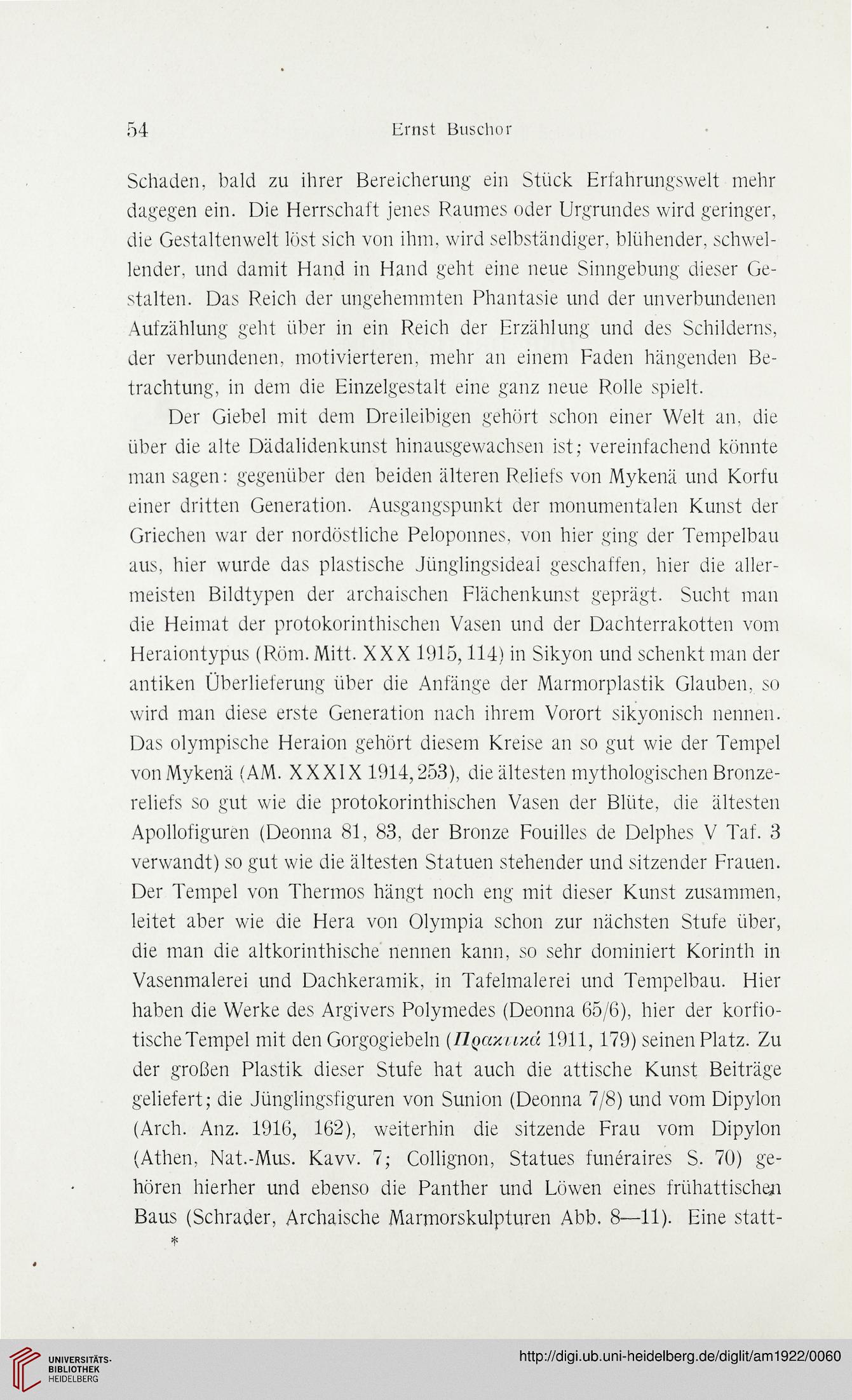54
Ernst Buschor
Schaden, bald zu ihrer Bereicherung ein Stück Erfahrungswelt mehr
dagegen ein. Die Herrschaft jenes Raumes oder Urgrundes wird geringer,
die Gestaltenwelt löst sich von ihm, wird selbständiger, blühender, schwel-
lender, und damit Hand in Hand geht eine neue Sinngebung dieser Ge-
stalten. Das Reich der ungehemmten Phantasie und der unverbundenen
Aufzählung geht über in ein Reich der Erzählung und des Schilderns,
der verbundenen, motivierteren, mehr an einem Faden hängenden Be-
trachtung, in dem die Einzelgestalt eine ganz neue Rolle spielt.
Der Giebel mit dem Dreileibigen gehört schon einer Welt an, die
Liber die alte Dädalidenkunst hinausgewachsen ist; vereinfachend könnte
man sagen: gegenüber den beiden älteren Reliefs von Mykenä und Korfu
einer dritten Generation. Ausgangspunkt der monumentalen Kunst der
Griechen war der nordöstliche Peloponnes, von hier ging der Tempelbau
aus, hier wurde das plastische Jünglingsideai geschaffen, hier die aller-
meisten Bildtypen der archaischen Flächenkunst geprägt. Sucht man
die Heimat der protokorinthischen Vasen und der Dachterrakotten vom
Heraiontypus (Röm. Mitt. XXX 1915,114) in Sikyon und schenkt man der
antiken Überlieferung tiber die Anfänge der Marmorplastik Glauben, so
wird man diese erste Generation nach ihrem Vorort sikyonisch nennen.
Das olympische Heraion gehört diesem Kreise an so gut wie der Tempel
vonMykenä (AM. XXXIX 1914,253), dieältesten mythologischen Bronze-
reliefs so gut wie die protokorinthischen Vasen der Blüte, die ältesten
Apollofiguren (Deonna 81, 83, der Bronze Fouilles de Delphes V Taf. 3
verwandt) so gut wie die ältesten Statuen stehender und sitzender Frauen.
Der Tempel von Thermos hängt noch eng mit dieser Kunst zusammen,
leitet aber wie die Hera von Olympia schon zur nächsten Stufe iiber,
die man die altkorinthische nennen kann, so sehr dominiert Korinth in
Vasenmalerei und Dachkeramik, in Tafelmalerei und Tempelbau. Hier
haben die Werke des Argivers Polymedes (Deonna 65/6), hier der korfio-
tischeTempel mit den Gorgogiebeln {IlQaxcr/M 1911, 179) seinen Platz. Zu
der großen Plastik dieser Stufe hat auch die attische Kunst Beiträge
geliefert; die Jünglingsfiguren von Sunion (Deonna 7/8) und vom Dipylon
(Arch. Anz. 1916, 162), weiterhin die sitzende Frau vom Dipylon
(Athen, Nat.-Mus. Kavv. 7; Collignon, Statues funeraires S. 70) ge-
hören hierher und ebenso die Panther und Föwen eines frühattischen
Baus (Schrader, Archaische Marmorskulpturen Abb. 8—11). Eine statt-
*
Ernst Buschor
Schaden, bald zu ihrer Bereicherung ein Stück Erfahrungswelt mehr
dagegen ein. Die Herrschaft jenes Raumes oder Urgrundes wird geringer,
die Gestaltenwelt löst sich von ihm, wird selbständiger, blühender, schwel-
lender, und damit Hand in Hand geht eine neue Sinngebung dieser Ge-
stalten. Das Reich der ungehemmten Phantasie und der unverbundenen
Aufzählung geht über in ein Reich der Erzählung und des Schilderns,
der verbundenen, motivierteren, mehr an einem Faden hängenden Be-
trachtung, in dem die Einzelgestalt eine ganz neue Rolle spielt.
Der Giebel mit dem Dreileibigen gehört schon einer Welt an, die
Liber die alte Dädalidenkunst hinausgewachsen ist; vereinfachend könnte
man sagen: gegenüber den beiden älteren Reliefs von Mykenä und Korfu
einer dritten Generation. Ausgangspunkt der monumentalen Kunst der
Griechen war der nordöstliche Peloponnes, von hier ging der Tempelbau
aus, hier wurde das plastische Jünglingsideai geschaffen, hier die aller-
meisten Bildtypen der archaischen Flächenkunst geprägt. Sucht man
die Heimat der protokorinthischen Vasen und der Dachterrakotten vom
Heraiontypus (Röm. Mitt. XXX 1915,114) in Sikyon und schenkt man der
antiken Überlieferung tiber die Anfänge der Marmorplastik Glauben, so
wird man diese erste Generation nach ihrem Vorort sikyonisch nennen.
Das olympische Heraion gehört diesem Kreise an so gut wie der Tempel
vonMykenä (AM. XXXIX 1914,253), dieältesten mythologischen Bronze-
reliefs so gut wie die protokorinthischen Vasen der Blüte, die ältesten
Apollofiguren (Deonna 81, 83, der Bronze Fouilles de Delphes V Taf. 3
verwandt) so gut wie die ältesten Statuen stehender und sitzender Frauen.
Der Tempel von Thermos hängt noch eng mit dieser Kunst zusammen,
leitet aber wie die Hera von Olympia schon zur nächsten Stufe iiber,
die man die altkorinthische nennen kann, so sehr dominiert Korinth in
Vasenmalerei und Dachkeramik, in Tafelmalerei und Tempelbau. Hier
haben die Werke des Argivers Polymedes (Deonna 65/6), hier der korfio-
tischeTempel mit den Gorgogiebeln {IlQaxcr/M 1911, 179) seinen Platz. Zu
der großen Plastik dieser Stufe hat auch die attische Kunst Beiträge
geliefert; die Jünglingsfiguren von Sunion (Deonna 7/8) und vom Dipylon
(Arch. Anz. 1916, 162), weiterhin die sitzende Frau vom Dipylon
(Athen, Nat.-Mus. Kavv. 7; Collignon, Statues funeraires S. 70) ge-
hören hierher und ebenso die Panther und Föwen eines frühattischen
Baus (Schrader, Archaische Marmorskulpturen Abb. 8—11). Eine statt-
*