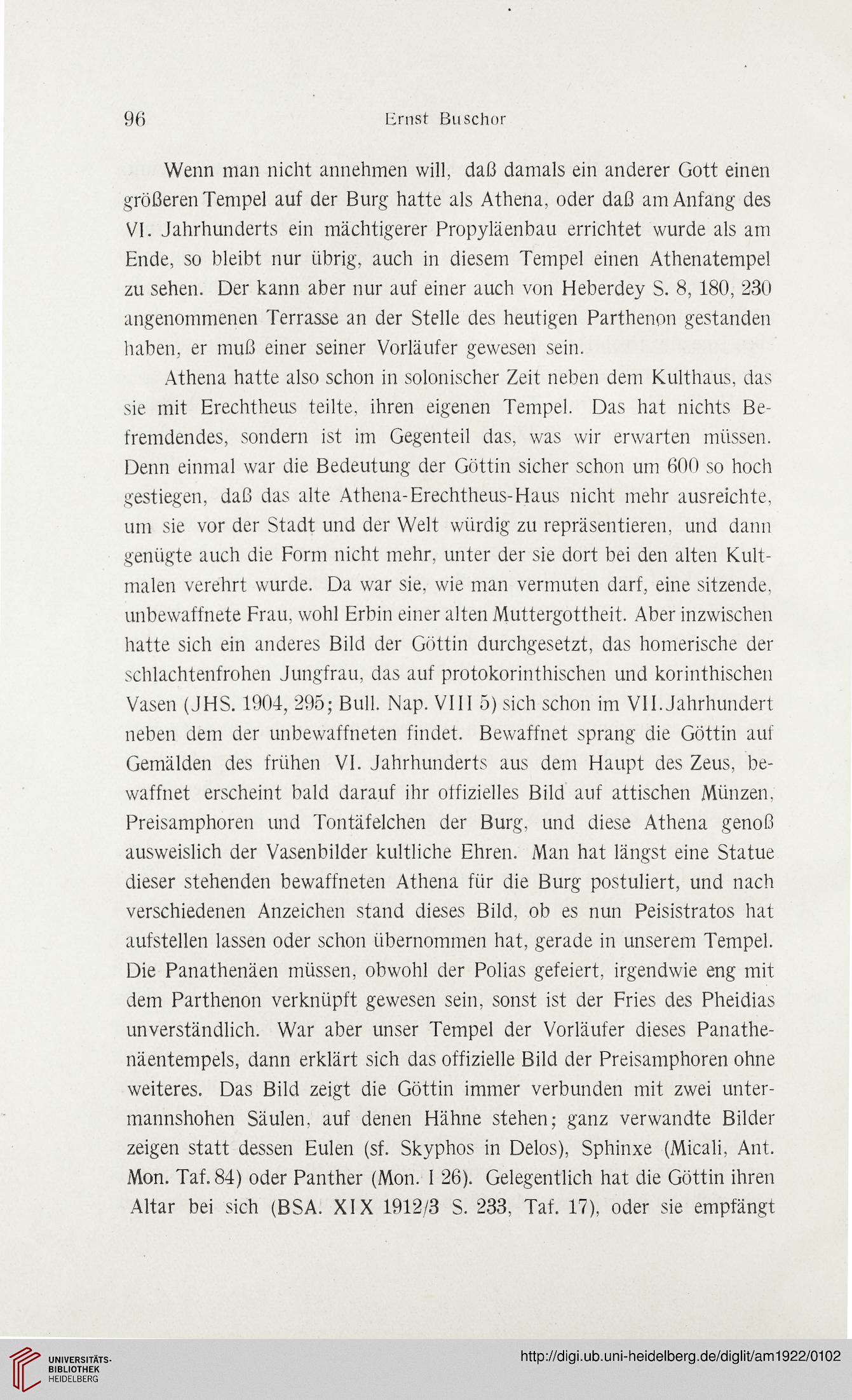96
Ernst Buschor
Wenn man nicht annehmen will, daß damals ein anderer Gott einen
größerenTempel auf der Burg hatte als Athena, oder daß amAnfang des
VI. Jahrhunderts ein mächtigerer Propyläenbau errichtet wurde als am
Ende, so bleibt nur iibrig, auch in diesem Teinpel einen Athenatempel
zu sehen. Der kann aber nur auf einer auch von Heberdey S. 8, 180, 230
angenommenen Terrasse an der Stelle des heutigen Parthenon gestanden
haben, er muß einer seiner Vorläufer gewesen sein.
Athena hatte also schon in solonischer Zeit neben dem Kulthaus, das
sie mit Erechtheus teilte, ihren eigenen Tempel. Das hat nichts Be-
fremdendes, sondern ist im Gegenteil das, was wir erwarten müssen.
Denn einmal war die Bedeutung der Göttin sicher schon um 600 so hoch
gestiegen, daß das alte Athena-Erechtheus-Haus nicht mehr ausreichte,
um sie vor der Stadt und der Welt würdig zu repräsentieren, und dann
genügte auch die Form nicht mehr, unter der sie dort bei den alten Kult-
malen verehrt wurde. Da war sie, wie man vermuten darf, eine sitzende,
unbewaffnete Frau, wohl Erbin einer alten Muttergottheit. Aber inzwischen
hatte sich ein anderes Bild der Göttin durchgesetzt, das homerische der
schlachtenfrohen Jungfrau, das auf protokorinthischen und korinthischen
Vasen (JHS. 1904, 295; Bull. Nap. VIII 5) sich schon im Vll.Jahrhundert
neben dem der unbewaffneten findet. Bewaffnet sprang die Göttin auf
Gemälden des frühen VI. Jahrhunderts aus dem Haupt des Zeus, be-
waffnet erscheint bald darauf ihr offizielles Bild auf attischen Münzen,
Preisamphoren und Tontäfelchen der Burg, und diese Athena genoß
ausweislich der Vasenbilder kultliche Ehren. Man hat längst eine Statue
dieser stehenden bewaffneten Athena für die Burg postuliert, und nach
verschiedenen Anzeichen stand dieses Bild, ob es nun Peisistratos hat
aufstellen lassen oder schon übernommen hat, gerade in unserem Tempel.
Die Panathenäen müssen, obwohl der Polias gefeiert, irgendwie eng mit
dem Parthenon verknüpft gewesen sein, sonst ist der Fries des Pheidias
unverständlich. War aber unser Tempel der Vorläufer dieses Panathe-
näentempels, dann erklärt sich das offizielle Bild der Preisamphoren ohne
weiteres. Das Bild zeigt die Göttin immer verbunden mit zwei unter-
mannshohen Säulen, auf denen Hähne stehen; ganz verwandte Bilder
zeigen statt dessen Eulen (sf. Skyphos in Delos), Sphinxe (Micali, Ant.
Mon. Taf. 84) oder Panther (Mon. I 26). Gelegentlich hat die Göttin ihren
Altar bei sich (BSA. XIX 1912/3 S. 233, Taf. 17), oder sie empfängt
Ernst Buschor
Wenn man nicht annehmen will, daß damals ein anderer Gott einen
größerenTempel auf der Burg hatte als Athena, oder daß amAnfang des
VI. Jahrhunderts ein mächtigerer Propyläenbau errichtet wurde als am
Ende, so bleibt nur iibrig, auch in diesem Teinpel einen Athenatempel
zu sehen. Der kann aber nur auf einer auch von Heberdey S. 8, 180, 230
angenommenen Terrasse an der Stelle des heutigen Parthenon gestanden
haben, er muß einer seiner Vorläufer gewesen sein.
Athena hatte also schon in solonischer Zeit neben dem Kulthaus, das
sie mit Erechtheus teilte, ihren eigenen Tempel. Das hat nichts Be-
fremdendes, sondern ist im Gegenteil das, was wir erwarten müssen.
Denn einmal war die Bedeutung der Göttin sicher schon um 600 so hoch
gestiegen, daß das alte Athena-Erechtheus-Haus nicht mehr ausreichte,
um sie vor der Stadt und der Welt würdig zu repräsentieren, und dann
genügte auch die Form nicht mehr, unter der sie dort bei den alten Kult-
malen verehrt wurde. Da war sie, wie man vermuten darf, eine sitzende,
unbewaffnete Frau, wohl Erbin einer alten Muttergottheit. Aber inzwischen
hatte sich ein anderes Bild der Göttin durchgesetzt, das homerische der
schlachtenfrohen Jungfrau, das auf protokorinthischen und korinthischen
Vasen (JHS. 1904, 295; Bull. Nap. VIII 5) sich schon im Vll.Jahrhundert
neben dem der unbewaffneten findet. Bewaffnet sprang die Göttin auf
Gemälden des frühen VI. Jahrhunderts aus dem Haupt des Zeus, be-
waffnet erscheint bald darauf ihr offizielles Bild auf attischen Münzen,
Preisamphoren und Tontäfelchen der Burg, und diese Athena genoß
ausweislich der Vasenbilder kultliche Ehren. Man hat längst eine Statue
dieser stehenden bewaffneten Athena für die Burg postuliert, und nach
verschiedenen Anzeichen stand dieses Bild, ob es nun Peisistratos hat
aufstellen lassen oder schon übernommen hat, gerade in unserem Tempel.
Die Panathenäen müssen, obwohl der Polias gefeiert, irgendwie eng mit
dem Parthenon verknüpft gewesen sein, sonst ist der Fries des Pheidias
unverständlich. War aber unser Tempel der Vorläufer dieses Panathe-
näentempels, dann erklärt sich das offizielle Bild der Preisamphoren ohne
weiteres. Das Bild zeigt die Göttin immer verbunden mit zwei unter-
mannshohen Säulen, auf denen Hähne stehen; ganz verwandte Bilder
zeigen statt dessen Eulen (sf. Skyphos in Delos), Sphinxe (Micali, Ant.
Mon. Taf. 84) oder Panther (Mon. I 26). Gelegentlich hat die Göttin ihren
Altar bei sich (BSA. XIX 1912/3 S. 233, Taf. 17), oder sie empfängt