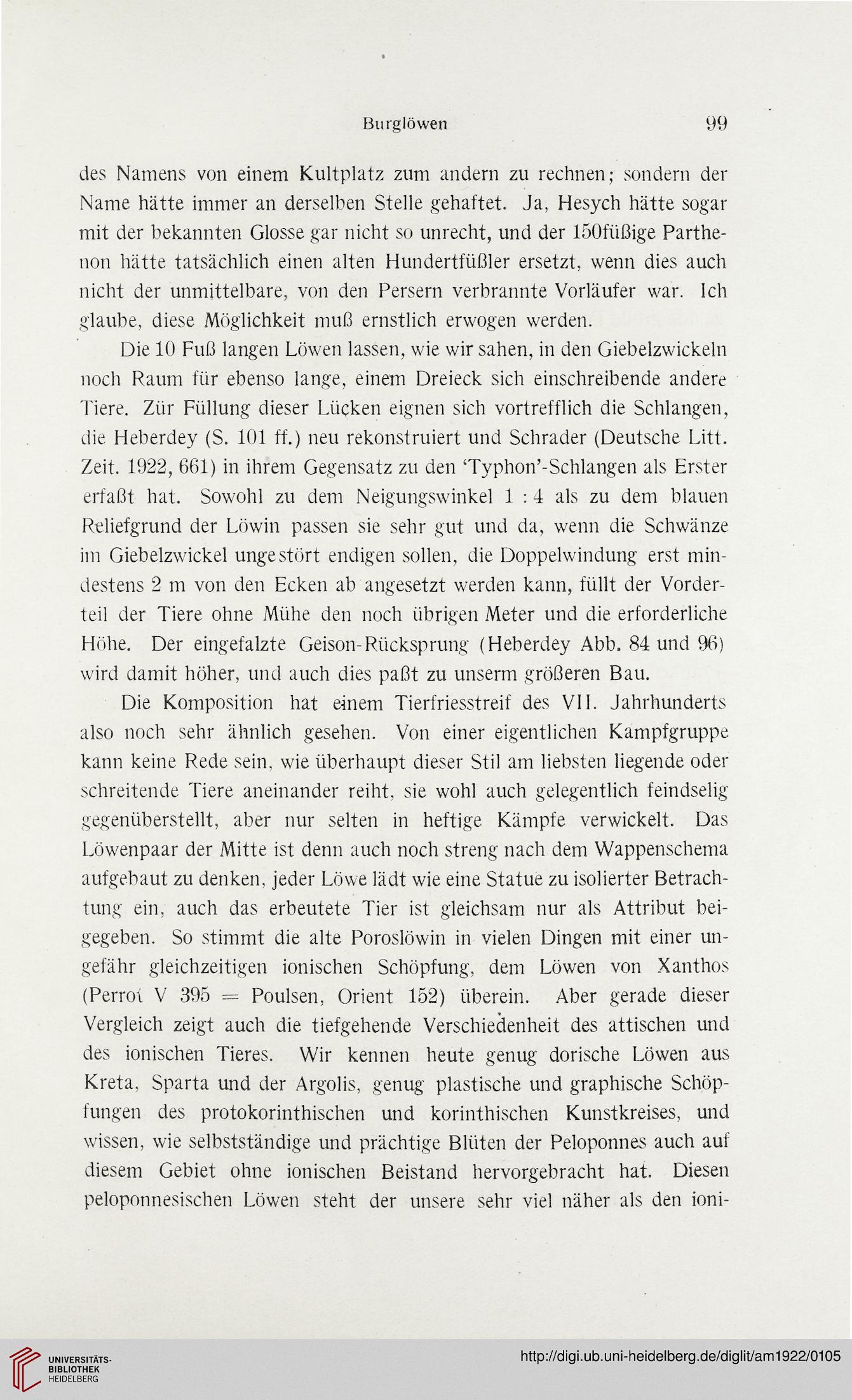Burglöwen
99
des Namens von einem Kultplatz zum andern zu rechnen; sondern der
Name hätte immer an derselben Stelle gehaftet. Ja, Hesych hätte sogar
mit der bekannten Glosse gar nicht so unrecht, und der 150füßige Parthe-
non hätte tatsächlich einen alten Hundertfüßler ersetzt, wenn dies auch
nicht der unmittelbare, von den Persern verbrannte Vorläufer war. Ich
glaube, diese Möglichkeit muß ernstlich erwogen werden.
Die 10 Fuß langen Löwen lassen, wie wir sahen, in den Giebelzwickeln
noch Rauin für ebenso lange, einem Dreieck sich einschreibende andere
Tiere. Zür Füllung dieser Lücken eignen sich vortrefflich die Schlangen,
die Heberdey (S. 101 ff.) neu rekonstruiert und Schrader (Deutsche Litt.
Zeit. 1922, 661) in ihrem Gegensatz zu den ‘Typhon’-Schlangen als Erster
erfaßt hat. Sowohl zu dem Neigungswinkel 1 :4 als zu dem blauen
Rdiefgrund der Löwin passen sie sehr gut und da, wenn die Schwänze
im Giebelzwickel ungestört endigen sollen, die Doppelwindung erst min-
destens 2 m von den Ecken ab angesetzt werden kann, füllt der Vorder-
teil der Tiere ohne Mühe den noch iibrigen Meter und die erforderliche
Höhe. Der eingefalzte Geison-Rticksprung (Heberdey Abb. 84 und 96)
wird damit höher, und auch dies paßt zu unserm größeren Bau.
Die Komposition hat einem Tierfriesstreif des VII. Jahrhunderts
also noch sehr ähnlich gesehen. Von einer eigentlichen Kampfgruppe
kann keine Rede sein, wie überhaupt dieser Stil am liebsten liegende oder
schreitende Tiere aneinander reiht, sie wohl auch gelegentlich feindselig
gegenüberstellt, aber nur selten in heftige Kämpfe verwickelt. Das
Löwenpaar der Mitte ist denn auch noch streng nach dem Wappenschema
aufgebaut zu denken, jeder Löwe lädt wie eine Statue zu isolierter Betrach-
tung ein, auch das erbeutete Tier ist gleichsam nur als Attribut bei-
gegeben. So stimint die alte Poroslöwin in vielen Dingen mit einer un-
gefähr gleichzeitigen ionischen Schöpfung, dem Löwen von Xanthos
(Perrot V 395 = Poulsen, Orient 152) iiberein. Aber gerade dieser
Vergleich zeigt auch die tiefgehende Verschiedenheit des attischen und
des ionischen Tieres. Wir kennen heute genug dorische Löwen aus
Kreta, Sparta und der Argolis, genug plastische und graphische Schöp-
fungen des protokorinthischen und korinthischen Kunstkreises, und
wissen, wie selbstständige und prächtige Blüten der Peloponnes auch auf
diesem Gebiet ohne ionischen Beistand hervorgebracht hat. Diesen
peloponnesischen Löwen steht der unsere sehr viel näher als den ioni-
99
des Namens von einem Kultplatz zum andern zu rechnen; sondern der
Name hätte immer an derselben Stelle gehaftet. Ja, Hesych hätte sogar
mit der bekannten Glosse gar nicht so unrecht, und der 150füßige Parthe-
non hätte tatsächlich einen alten Hundertfüßler ersetzt, wenn dies auch
nicht der unmittelbare, von den Persern verbrannte Vorläufer war. Ich
glaube, diese Möglichkeit muß ernstlich erwogen werden.
Die 10 Fuß langen Löwen lassen, wie wir sahen, in den Giebelzwickeln
noch Rauin für ebenso lange, einem Dreieck sich einschreibende andere
Tiere. Zür Füllung dieser Lücken eignen sich vortrefflich die Schlangen,
die Heberdey (S. 101 ff.) neu rekonstruiert und Schrader (Deutsche Litt.
Zeit. 1922, 661) in ihrem Gegensatz zu den ‘Typhon’-Schlangen als Erster
erfaßt hat. Sowohl zu dem Neigungswinkel 1 :4 als zu dem blauen
Rdiefgrund der Löwin passen sie sehr gut und da, wenn die Schwänze
im Giebelzwickel ungestört endigen sollen, die Doppelwindung erst min-
destens 2 m von den Ecken ab angesetzt werden kann, füllt der Vorder-
teil der Tiere ohne Mühe den noch iibrigen Meter und die erforderliche
Höhe. Der eingefalzte Geison-Rticksprung (Heberdey Abb. 84 und 96)
wird damit höher, und auch dies paßt zu unserm größeren Bau.
Die Komposition hat einem Tierfriesstreif des VII. Jahrhunderts
also noch sehr ähnlich gesehen. Von einer eigentlichen Kampfgruppe
kann keine Rede sein, wie überhaupt dieser Stil am liebsten liegende oder
schreitende Tiere aneinander reiht, sie wohl auch gelegentlich feindselig
gegenüberstellt, aber nur selten in heftige Kämpfe verwickelt. Das
Löwenpaar der Mitte ist denn auch noch streng nach dem Wappenschema
aufgebaut zu denken, jeder Löwe lädt wie eine Statue zu isolierter Betrach-
tung ein, auch das erbeutete Tier ist gleichsam nur als Attribut bei-
gegeben. So stimint die alte Poroslöwin in vielen Dingen mit einer un-
gefähr gleichzeitigen ionischen Schöpfung, dem Löwen von Xanthos
(Perrot V 395 = Poulsen, Orient 152) iiberein. Aber gerade dieser
Vergleich zeigt auch die tiefgehende Verschiedenheit des attischen und
des ionischen Tieres. Wir kennen heute genug dorische Löwen aus
Kreta, Sparta und der Argolis, genug plastische und graphische Schöp-
fungen des protokorinthischen und korinthischen Kunstkreises, und
wissen, wie selbstständige und prächtige Blüten der Peloponnes auch auf
diesem Gebiet ohne ionischen Beistand hervorgebracht hat. Diesen
peloponnesischen Löwen steht der unsere sehr viel näher als den ioni-