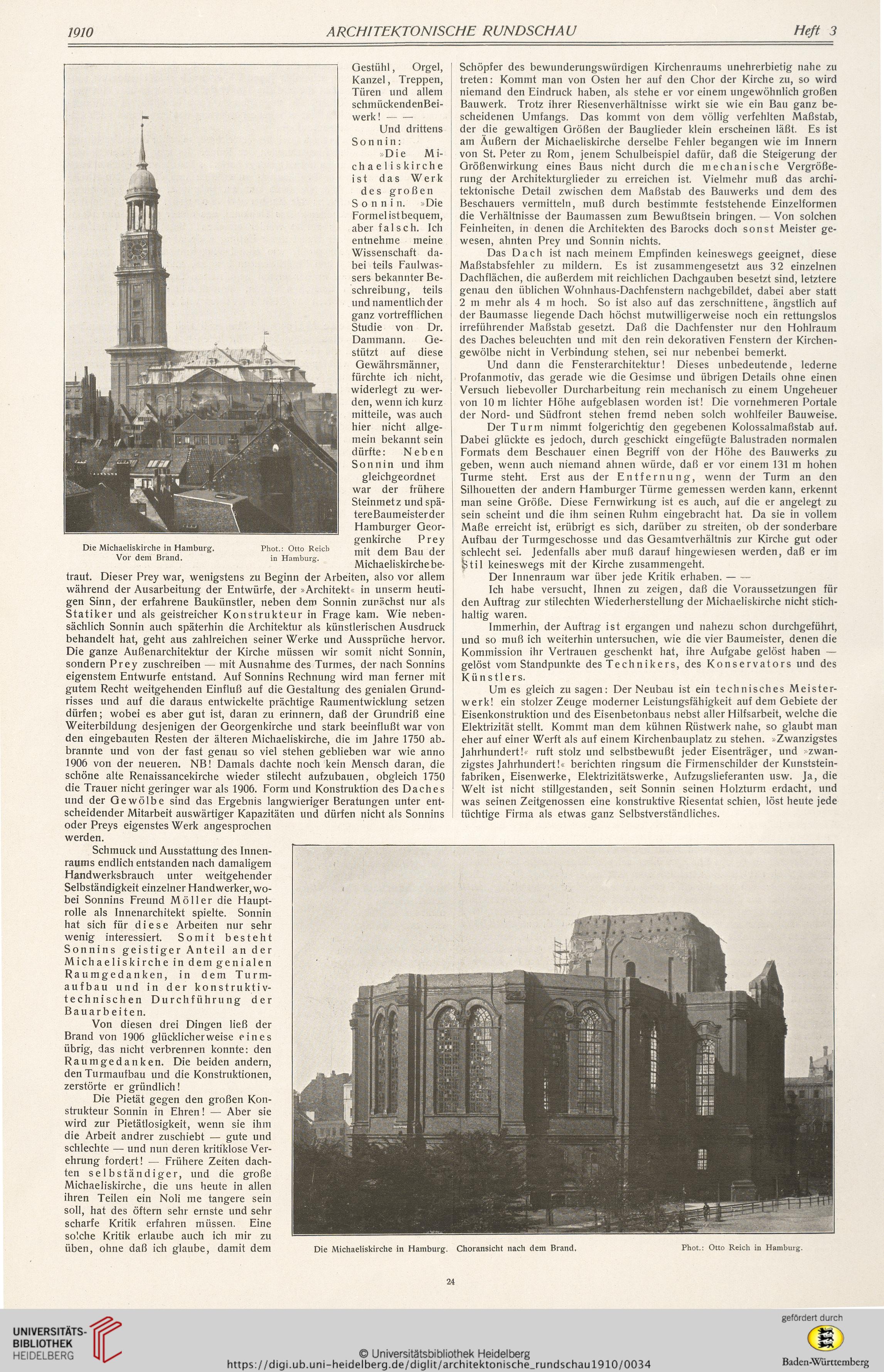1910
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 3
Die Michaeliskirche in Hamburg.
Phot.: Otto Reich
in Hamburg.
Die Michaeliskirche in Hamburg.
Vor dem Brand.
Dr.
Ge-
Gestühl, Orgel,
Kanzel, Treppen,
Türen und allem
schmückendenBei-
werk!-
Und drittens
S o n n i n:
»Die
chaeliskirche
ist das Werk
des großen
S o n n i n. »Die
Formel istbequem,
aber falsch. Ich
entnehme meine
Wissenschaft da-
bei teils Faulwas-
sers bekannter Be-
schreibung, teils
und namentlich der
ganz vortrefflichen
Studie von
Dammann.
stützt auf diese
Gewährsmänner,
fürchte ich nicht,
widerlegt zu wer-
den, wenn ich kurz
mitteile, was auch
hier nicht allge-
mein bekannt sein
dürfte: Neben
Sonn in und ihm
gleichgeordnet
war der frühere
Steinmetz und spä-
tereBaumeisterder
Hamburger Geor-
genkirche Prey
mit dem Bau der
Michaeliskirche be-
traut. Dieser Prey war, wenigstens zu Beginn der Arbeiten, also vor allem
während der Ausarbeitung der Entwürfe, der »Architekt« in unserm heuti-
gen Sinn, der erfahrene Baukünstler, neben dem Sonnin zunächst nur als
Statiker und als geistreicher Konstrukteur in Frage kam. Wie neben-
sächlich Sonnin auch späterhin die Architektur als künstlerischen Ausdruck
behandelt hat, geht aus zahlreichen seiner Werke und Aussprüche hervor.
Die ganze Außenarchitektur der Kirche müssen wir somit nicht Sonnin,
sondern Prey zuschreiben — mit Ausnahme des Turmes, der nach Sonnins
eigenstem Entwürfe entstand. Auf Sonnins Rechnung wird man ferner mit
gutem Recht weitgehenden Einfluß auf die Gestaltung des genialen Grund-
risses und auf die daraus entwickelte prächtige Raumentwicklung setzen
dürfen; wobei es aber gut ist, daran zu erinnern, daß der Grundriß eine
Weiterbildung desjenigen der Georgenkirche und stark beeinflußt war von
den eingebauten Resten der älteren Michaeliskirche, die im Jahre 1750 ab-
brannte und von der fast genau so viel stehen geblieben war wie anno
1906 von der neueren. NB! Damals dachte noch kein Mensch daran, die
schöne alte Renaissancekirche wieder stilecht aufzubauen, obgleich 1750
die Trauer nicht geringer war als 1906. Form und Konstruktion des Daches
und der Gewölbe sind das Ergebnis langwieriger Beratungen unter ent-
scheidender Mitarbeit auswärtiger Kapazitäten und dürfen nicht als Sonnins
oder Preys eigenstes Werk angesprochen
werden.
Schmuck und Ausstattung des Innen¬
raums endlich entstanden nach damaligem
Handwerksbrauch unter weitgehender
Selbständigkeit einzelner Handwerker, wo¬
bei Sonnins Freund Möller die Haupt¬
rolle als Innenarchitekt spielte. Sonnin
hat sich für diese Arbeiten nur sehr
wenig interessiert. Somit besteht
Sonnins geistiger Anteil an der
Michaeliskirche in dem genialen
Raumgedanken, in dem Turm¬
aufbau und in der konstruktiv¬
technischen Durchführung der
Bauarbeiten.
Von diesen drei Dingen ließ der
Brand von 1906 glücklicherweise eines
übrig, das nicht verbrennen konnte: den
Raumgedanken. Die beiden andern,
den Turmaufbau und die Konstruktionen,
zerstörte er gründlich!
Die Pietät gegen den großen Kon¬
strukteur Sonnin in Ehren! — Aber sie
wird zur Pietätlosigkeit, wenn sie ihm
die Arbeit andrer zuschiebt — gute und
schlechte — und nun deren kritiklose Ver¬
ehrung fordert! — Frühere Zeiten dach-
ten selbständiger, und die große
Michaeliskirche, die uns heute in allen
ihren Teilen ein Noli ine tangere sein
soll, hat des öftern sehr ernste und sehr
scharfe Kritik erfahren müssen. Eine
solche Kritik erlaube auch ich mir zu
üben, ohne daß ich glaube, damit dem
Schöpfer des bewunderungswürdigen Kirchenraums unehrerbietig nahe zu
treten: Kommt man von Osten her auf den Chor der Kirche zu, so wird
niemand den Eindruck haben, als stehe er vor einem ungewöhnlich großen
Bauwerk. Trotz ihrer Riesenverhältnisse wirkt sie wie ein Bau ganz be-
scheidenen Umfangs. Das kommt von dem völlig verfehlten Maßstab,
der die gewaltigen Größen der Bauglieder klein erscheinen läßt. Es ist
am Äußern der Michaeliskirche derselbe Fehler begangen wie im Innern
von St. Peter zu Rom, jenem Schulbeispiel dafür, daß die Steigerung der
Größenwirkung eines Baus nicht durch die mechanische Vergröße-
rung der Architekturglieder zu erreichen ist. Vielmehr muß das archi-
tektonische Detail zwischen dem Maßstab des Bauwerks und dem des
Beschauers vermitteln, muß durch bestimmte feststehende Einzelformen
die Verhältnisse der Baumassen zum Bewußtsein bringen. — Von solchen
Feinheiten, in denen die Architekten des Barocks doch sonst Meister ge-
wesen, ahnten Prey und Sonnin nichts.
Das Dach ist nach meinem Empfinden keineswegs geeignet, diese
Maßstabsfehler zu mildern. Es ist zusammengesetzt aus 32 einzelnen
Dachflächen, die außerdem mit reichlichen Dachgauben besetzt sind, letztere
genau den üblichen Wohnhaus-Dachfenstern nachgebildet, dabei aber statt
2 m mehr als 4 m hoch. So ist also auf das zerschnittene, ängstlich auf
der Baumasse liegende Dach höchst mutwilligerweise noch ein rettungslos
irreführender Maßstab gesetzt. Daß die Dachfenster nur den Hohlraum
des Daches beleuchten und mit den rein dekorativen Fenstern der Kirchen-
gewölbe nicht in Verbindung stehen, sei nur nebenbei bemerkt.
Und dann die Fensterarchitektur! Dieses unbedeutende, lederne
Profanmotiv, das gerade wie die Gesimse und übrigen Details ohne einen
Versuch liebevoller Durcharbeitung rein mechanisch zu einem Ungeheuer
von 10 m lichter Höhe aufgeblasen worden ist! Die vornehmeren Portale
der Nord- und Südfront stehen fremd neben solch wohlfeiler Bauweise.
Der Turm nimmt folgerichtig den gegebenen Kolossalmaßstab auf.
Dabei glückte es jedoch, durch geschickt eingefügte Balustraden normalen
Formats dem Beschauer einen Begriff von der Höhe des Bauwerks zu
geben, wenn auch niemand ahnen würde, daß er vor einem 131 m hohen
Turme steht. Erst aus der Entfernung, wenn der Turm an den
Silhouetten der andern Hamburger Türme gemessen werden kann, erkennt
man seine Größe. Diese Fernwirkung ist es auch, auf die er angelegt zu
sein scheint und die ihm seinen Ruhm eingebracht hat. Da sie in vollem
Maße erreicht ist, erübrigt es sich, darüber zu streiten, ob der sonderbare
Aufbau der Turmgeschosse und das Gesamtverhältnis zur Kirche gut oder
schlecht sei. Jedenfalls aber muß darauf hingewiesen werden, daß er im
ttil keineswegs mit der Kirche zusammengeht.
Der Innenraum war über jede Kritik erhaben.-
Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, daß die Voraussetzungen für
den Auftrag zur stilechten Wiederherstellung der Michaeliskirche nicht stich-
haltig waren.
Immerhin, der Auftrag ist ergangen und nahezu schon durchgeführt,
und so muß ich weiterhin untersuchen, wie die vier Baumeister, denen die
Kommission ihr Vertrauen geschenkt hat, ihre Aufgabe gelöst haben —
gelöst vom Standpunkte des Technikers, des Konservators und des
Künstlers.
Um es gleich zu sagen: Der Neubau ist ein technisches Meister-
werk! ein stolzer Zeuge moderner Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete der
Eisenkonstruktion und des Eisenbetonbaus nebst aller Hilfsarbeit, welche die
Elektrizität stellt. Kommt man dem kühnen Rüstwerk nahe, so glaubt man
eher auf einer Werft als auf einem Kirchenbauplatz zu stehen. »Zwanzigstes
Jahrhundert!« ruft stolz und selbstbewußt jeder Eisenträger, und »zwan-
zigstes Jahrhundert!« berichten ringsum die Firmenschilder der Kunststein-
fabriken, Eisenwerke, Elektrizitätswerke, Aufzugslieferanten usw. Ja, die
Welt ist nicht stillgestanden, seit Sonnin seinen Holzturm erdacht, und
was seinen Zeitgenossen eine konstruktive Riesentat schien, löst heute jede
tüchtige Firma als etwas ganz Selbstverständliches.
Phot.: Otto Reich in Hamburg.
Choransicht nach dem Brand.
24
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 3
Die Michaeliskirche in Hamburg.
Phot.: Otto Reich
in Hamburg.
Die Michaeliskirche in Hamburg.
Vor dem Brand.
Dr.
Ge-
Gestühl, Orgel,
Kanzel, Treppen,
Türen und allem
schmückendenBei-
werk!-
Und drittens
S o n n i n:
»Die
chaeliskirche
ist das Werk
des großen
S o n n i n. »Die
Formel istbequem,
aber falsch. Ich
entnehme meine
Wissenschaft da-
bei teils Faulwas-
sers bekannter Be-
schreibung, teils
und namentlich der
ganz vortrefflichen
Studie von
Dammann.
stützt auf diese
Gewährsmänner,
fürchte ich nicht,
widerlegt zu wer-
den, wenn ich kurz
mitteile, was auch
hier nicht allge-
mein bekannt sein
dürfte: Neben
Sonn in und ihm
gleichgeordnet
war der frühere
Steinmetz und spä-
tereBaumeisterder
Hamburger Geor-
genkirche Prey
mit dem Bau der
Michaeliskirche be-
traut. Dieser Prey war, wenigstens zu Beginn der Arbeiten, also vor allem
während der Ausarbeitung der Entwürfe, der »Architekt« in unserm heuti-
gen Sinn, der erfahrene Baukünstler, neben dem Sonnin zunächst nur als
Statiker und als geistreicher Konstrukteur in Frage kam. Wie neben-
sächlich Sonnin auch späterhin die Architektur als künstlerischen Ausdruck
behandelt hat, geht aus zahlreichen seiner Werke und Aussprüche hervor.
Die ganze Außenarchitektur der Kirche müssen wir somit nicht Sonnin,
sondern Prey zuschreiben — mit Ausnahme des Turmes, der nach Sonnins
eigenstem Entwürfe entstand. Auf Sonnins Rechnung wird man ferner mit
gutem Recht weitgehenden Einfluß auf die Gestaltung des genialen Grund-
risses und auf die daraus entwickelte prächtige Raumentwicklung setzen
dürfen; wobei es aber gut ist, daran zu erinnern, daß der Grundriß eine
Weiterbildung desjenigen der Georgenkirche und stark beeinflußt war von
den eingebauten Resten der älteren Michaeliskirche, die im Jahre 1750 ab-
brannte und von der fast genau so viel stehen geblieben war wie anno
1906 von der neueren. NB! Damals dachte noch kein Mensch daran, die
schöne alte Renaissancekirche wieder stilecht aufzubauen, obgleich 1750
die Trauer nicht geringer war als 1906. Form und Konstruktion des Daches
und der Gewölbe sind das Ergebnis langwieriger Beratungen unter ent-
scheidender Mitarbeit auswärtiger Kapazitäten und dürfen nicht als Sonnins
oder Preys eigenstes Werk angesprochen
werden.
Schmuck und Ausstattung des Innen¬
raums endlich entstanden nach damaligem
Handwerksbrauch unter weitgehender
Selbständigkeit einzelner Handwerker, wo¬
bei Sonnins Freund Möller die Haupt¬
rolle als Innenarchitekt spielte. Sonnin
hat sich für diese Arbeiten nur sehr
wenig interessiert. Somit besteht
Sonnins geistiger Anteil an der
Michaeliskirche in dem genialen
Raumgedanken, in dem Turm¬
aufbau und in der konstruktiv¬
technischen Durchführung der
Bauarbeiten.
Von diesen drei Dingen ließ der
Brand von 1906 glücklicherweise eines
übrig, das nicht verbrennen konnte: den
Raumgedanken. Die beiden andern,
den Turmaufbau und die Konstruktionen,
zerstörte er gründlich!
Die Pietät gegen den großen Kon¬
strukteur Sonnin in Ehren! — Aber sie
wird zur Pietätlosigkeit, wenn sie ihm
die Arbeit andrer zuschiebt — gute und
schlechte — und nun deren kritiklose Ver¬
ehrung fordert! — Frühere Zeiten dach-
ten selbständiger, und die große
Michaeliskirche, die uns heute in allen
ihren Teilen ein Noli ine tangere sein
soll, hat des öftern sehr ernste und sehr
scharfe Kritik erfahren müssen. Eine
solche Kritik erlaube auch ich mir zu
üben, ohne daß ich glaube, damit dem
Schöpfer des bewunderungswürdigen Kirchenraums unehrerbietig nahe zu
treten: Kommt man von Osten her auf den Chor der Kirche zu, so wird
niemand den Eindruck haben, als stehe er vor einem ungewöhnlich großen
Bauwerk. Trotz ihrer Riesenverhältnisse wirkt sie wie ein Bau ganz be-
scheidenen Umfangs. Das kommt von dem völlig verfehlten Maßstab,
der die gewaltigen Größen der Bauglieder klein erscheinen läßt. Es ist
am Äußern der Michaeliskirche derselbe Fehler begangen wie im Innern
von St. Peter zu Rom, jenem Schulbeispiel dafür, daß die Steigerung der
Größenwirkung eines Baus nicht durch die mechanische Vergröße-
rung der Architekturglieder zu erreichen ist. Vielmehr muß das archi-
tektonische Detail zwischen dem Maßstab des Bauwerks und dem des
Beschauers vermitteln, muß durch bestimmte feststehende Einzelformen
die Verhältnisse der Baumassen zum Bewußtsein bringen. — Von solchen
Feinheiten, in denen die Architekten des Barocks doch sonst Meister ge-
wesen, ahnten Prey und Sonnin nichts.
Das Dach ist nach meinem Empfinden keineswegs geeignet, diese
Maßstabsfehler zu mildern. Es ist zusammengesetzt aus 32 einzelnen
Dachflächen, die außerdem mit reichlichen Dachgauben besetzt sind, letztere
genau den üblichen Wohnhaus-Dachfenstern nachgebildet, dabei aber statt
2 m mehr als 4 m hoch. So ist also auf das zerschnittene, ängstlich auf
der Baumasse liegende Dach höchst mutwilligerweise noch ein rettungslos
irreführender Maßstab gesetzt. Daß die Dachfenster nur den Hohlraum
des Daches beleuchten und mit den rein dekorativen Fenstern der Kirchen-
gewölbe nicht in Verbindung stehen, sei nur nebenbei bemerkt.
Und dann die Fensterarchitektur! Dieses unbedeutende, lederne
Profanmotiv, das gerade wie die Gesimse und übrigen Details ohne einen
Versuch liebevoller Durcharbeitung rein mechanisch zu einem Ungeheuer
von 10 m lichter Höhe aufgeblasen worden ist! Die vornehmeren Portale
der Nord- und Südfront stehen fremd neben solch wohlfeiler Bauweise.
Der Turm nimmt folgerichtig den gegebenen Kolossalmaßstab auf.
Dabei glückte es jedoch, durch geschickt eingefügte Balustraden normalen
Formats dem Beschauer einen Begriff von der Höhe des Bauwerks zu
geben, wenn auch niemand ahnen würde, daß er vor einem 131 m hohen
Turme steht. Erst aus der Entfernung, wenn der Turm an den
Silhouetten der andern Hamburger Türme gemessen werden kann, erkennt
man seine Größe. Diese Fernwirkung ist es auch, auf die er angelegt zu
sein scheint und die ihm seinen Ruhm eingebracht hat. Da sie in vollem
Maße erreicht ist, erübrigt es sich, darüber zu streiten, ob der sonderbare
Aufbau der Turmgeschosse und das Gesamtverhältnis zur Kirche gut oder
schlecht sei. Jedenfalls aber muß darauf hingewiesen werden, daß er im
ttil keineswegs mit der Kirche zusammengeht.
Der Innenraum war über jede Kritik erhaben.-
Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, daß die Voraussetzungen für
den Auftrag zur stilechten Wiederherstellung der Michaeliskirche nicht stich-
haltig waren.
Immerhin, der Auftrag ist ergangen und nahezu schon durchgeführt,
und so muß ich weiterhin untersuchen, wie die vier Baumeister, denen die
Kommission ihr Vertrauen geschenkt hat, ihre Aufgabe gelöst haben —
gelöst vom Standpunkte des Technikers, des Konservators und des
Künstlers.
Um es gleich zu sagen: Der Neubau ist ein technisches Meister-
werk! ein stolzer Zeuge moderner Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete der
Eisenkonstruktion und des Eisenbetonbaus nebst aller Hilfsarbeit, welche die
Elektrizität stellt. Kommt man dem kühnen Rüstwerk nahe, so glaubt man
eher auf einer Werft als auf einem Kirchenbauplatz zu stehen. »Zwanzigstes
Jahrhundert!« ruft stolz und selbstbewußt jeder Eisenträger, und »zwan-
zigstes Jahrhundert!« berichten ringsum die Firmenschilder der Kunststein-
fabriken, Eisenwerke, Elektrizitätswerke, Aufzugslieferanten usw. Ja, die
Welt ist nicht stillgestanden, seit Sonnin seinen Holzturm erdacht, und
was seinen Zeitgenossen eine konstruktive Riesentat schien, löst heute jede
tüchtige Firma als etwas ganz Selbstverständliches.
Phot.: Otto Reich in Hamburg.
Choransicht nach dem Brand.
24