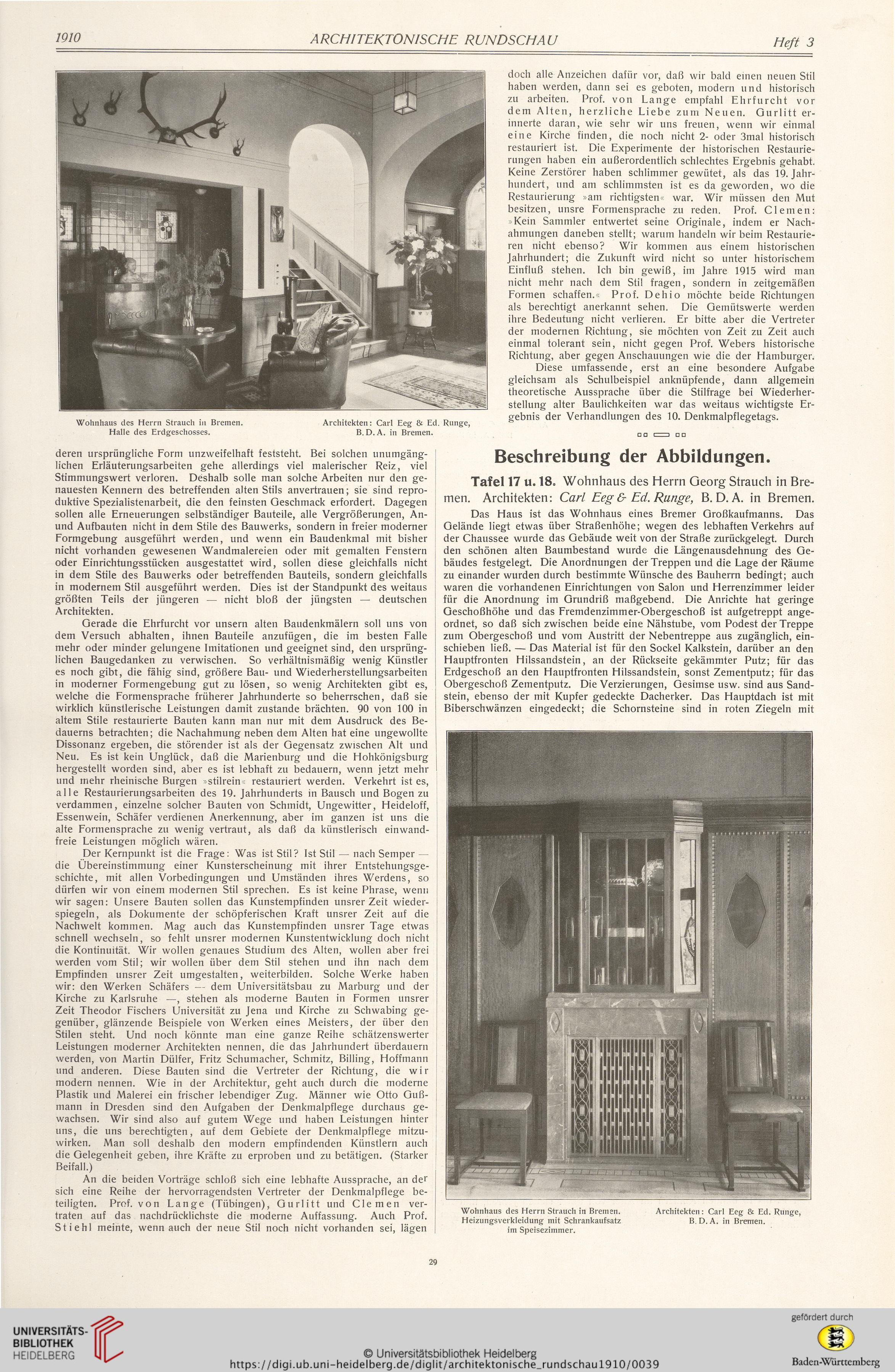1910
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 3
Wohnhaus des Herrn Strauch in Bremen.
Halle des Erdgeschosses.
Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge,
B. D.A. in Bremen.
doch alle Anzeichen dafür vor, daß wir bald einen neuen Stil
haben werden, dann sei es geboten, modern und historisch
zu arbeiten. Prof, von Lange empfahl Ehrfurcht vor
dem Alten, herzliche Liebe zum Neuen. Gurlitt er-
innerte daran, wie sehr wir uns freuen, wenn wir einmal
eine Kirche finden, die noch nicht 2- oder 3mal historisch
restauriert ist. Die Experimente der historischen Restaurie-
rungen haben ein außerordentlich schlechtes Ergebnis gehabt.
Keine Zerstörer haben schlimmer gewütet, als das 19. Jahr-
hundert, und am schlimmsten ist es da geworden, wo die
Restaurierung »am richtigsten« war. Wir müssen den Mut
besitzen, unsre Formensprache zu reden. Prof. Clernen:
»Kein Sammler entwertet seine Originale, indem er Nach-
ahmungen daneben stellt; warum handeln wir beim Restaurie-
ren nicht ebenso? Wir kommen aus einem historischen
Jahrhundert; die Zukunft wird nicht so unter historischem
Einfluß stehen. Ich bin gewiß, im Jahre 1915 wird man
nicht mehr nach dem Stil fragen, sondern in zeitgemäßen
Formen schaffen.« Prof. Dehio möchte beide Richtungen
als berechtigt anerkannt sehen. Die Gemütswerte werden
ihre Bedeutung nicht verlieren. Er bitte aber die Vertreter
der modernen Richtung, sie möchten von Zeit zu Zeit auch
einmal tolerant sein, nicht gegen Prof. Webers historische
Richtung, aber gegen Anschauungen wie die der Hamburger.
Diese umfassende, erst an eine besondere Aufgabe
gleichsam als Schulbeispiel anknüpfende, dann allgemein
theoretische Aussprache über die Stilfrage bei Wiederher-
stellung alter Baulichkeiten war das weitaus wichtigste Er-
gebnis der Verhandlungen des 10. Denkmalpflegetags.
deren ursprüngliche Form unzweifelhaft feststeht. Bei solchen unumgäng-
lichen Erläuterungsarbeiten gehe allerdings viel malerischer Reiz, viel
Stimmungswert verloren. Deshalb solle man solche Arbeiten nur den ge-
nauesten Kennern des betreffenden alten Stils anvertrauen; sie sind repro-
duktive Spezialistenarbeit, die den feinsten Geschmack erfordert. Dagegen
sollen alle Erneuerungen selbständiger Bauteile, alle Vergrößerungen, An-
und Aufbauten nicht in dem Stile des Bauwerks, sondern in freier moderner
Formgebung ausgeführt werden, und wenn ein Baudenkmal mit bisher
nicht vorhanden gewesenen Wandmalereien oder mit gemalten Fenstern
oder Einrichtungsstücken ausgestattet wird, sollen diese gleichfalls nicht
in dem Stile des Bauwerks oder betreffenden Bauteils, sondern gleichfalls
in modernem Stil ausgeführt werden. Dies ist der Standpunkt des weitaus
größten Teils der jüngeren — nicht bloß der jüngsten — deutschen
Architekten.
Gerade die Ehrfurcht vor unsern alten Baudenkmälern soll uns von
dem Versuch abhalten, ihnen Bauteile anzufügen, die im besten Falle
mehr oder minder gelungene Imitationen und geeignet sind, den ursprüng-
lichen Baugedanken zu verwischen. So verhältnismäßig wenig Künstler
es noch gibt, die fähig sind, größere Bau- und Wiederherstellungsarbeiten
in moderner Formengebung gut zu lösen, so wenig Architekten gibt es,
welche die Formensprache früherer Jahrhunderte so beherrschen, daß sie
wirklich künstlerische Leistungen damit zustande brächten. 90 von 100 in
altem Stile restaurierte Bauten kann man nur mit dem Ausdruck des Be-
dauerns betrachten; die Nachahmung neben dem Alten hat eine ungewollte
Dissonanz ergeben, die störender ist als der Gegensatz zwischen Alt und
Neu. Es ist kein Unglück, daß die Marienburg und die Hohkönigsburg
hergestellt worden sind, aber es ist lebhaft zu bedauern, wenn jetzt mehr
und mehr rheinische Burgen »stilrein« restauriert werden. Verkehrt ist es,
alle Restaurierungsarbeiten des 19. Jahrhunderts in Bausch und Bogen zu
verdammen, einzelne solcher Bauten von Schmidt, Ungewitter, Heideloff,
Essenwein, Schäfer verdienen Anerkennung, aber im ganzen ist uns die
alte Formensprache zu wenig vertraut, als daß da künstlerisch einwand-
freie Leistungen möglich wären.
Der Kernpunkt ist die Frage: Was ist Stil? Ist Stil — nach Semper —
die Übereinstimmung einer Kunsterscheinung mit ihrer Entstehungsge-
schichte, mit allen Vorbedingungen und Umständen ihres Werdens, so
dürfen wir von einem modernen Stil sprechen. Es ist keine Phrase, wenn
wir sagen: Unsere Bauten sollen das Kunstempfinden unsrer Zeit wieder-
spiegeln, als Dokumente der schöpferischen Kraft unsrer Zeit auf die
Nachwelt kommen. Mag auch das Kunstempfinden unsrer Tage etwas
schnell wechseln, so fehlt unsrer modernen Kunstentwicklung doch nicht
die Kontinuität. Wir wollen genaues Studium des Alten, wollen aber frei
werden vom Stil; wir wollen über dem Stil stehen und ihn nach dem
Empfinden unsrer Zeit umgestalten, weiterbilden. Solche Werke haben
wir: den Werken Schäfers — dem Universitätsbau zu Marburg und der
Kirche zu Karlsruhe —, stehen als moderne Bauten in Formen unsrer
Zeit Theodor Fischers Universität zu Jena und Kirche zu Schwabing ge-
genüber, glänzende Beispiele von Werken eines Meisters, der über den
Stilen steht. Und noch könnte man eine ganze Reihe schätzenswerter
Leistungen moderner Architekten nennen, die das Jahrhundert überdauern
werden, von Martin Dülfer, Fritz Schumacher, Schmitz, Billing, Hoffmann
und anderen. Diese Bauten sind die Vertreter der Richtung, die wir
modern nennen. Wie in der Architektur, geht auch durch die moderne
Plastik und Malerei ein frischer lebendiger Zug. Männer wie Otto Guß-
mann in Dresden sind den Aufgaben der Denkmalpflege durchaus ge-
wachsen. Wir sind also auf gutem Wege und haben Leistungen hinter
uns, die uns berechtigten, auf dem Gebiete der Denkmalpflege mitzu-
wirken. Man soll deshalb den modern empfindenden Künstlern auch
die Gelegenheit geben, ihre Kräfte zu erproben und zu betätigen. (Starker
Beifall.)
An die beiden Vorträge schloß sich eine lebhafte Aussprache, an der
sich eine Reihe der hervorragendsten Vertreter der Denkmalpflege be-
teiligten. Prof, von Lange (Tübingen), Gurlitt und Cie men ver-
traten auf das nachdrücklichste die moderne Auffassung. Auch Prof.
Stiehl meinte, wenn auch der neue Stil noch nicht vorhanden sei, lägen
Beschreibung der Abbildungen.
Tafel 17 u. 18. Wohnhaus des Herrn Georg Strauch in Bre-
men. Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge, B. D. A. in Bremen.
Das Haus ist das Wohnhaus eines Bremer Großkaufmanns. Das
Gelände liegt etwas über Straßenhöhe; wegen des lebhaften Verkehrs auf
der Chaussee wurde das Gebäude weit von der Straße zurückgelegt. Durch
den schönen alten Baumbestand wurde die Längenausdehnung des Ge-
bäudes festgelegt. Die Anordnungen der Treppen und die Lage der Räume
zu einander wurden durch bestimmte Wünsche des Bauherrn bedingt; auch
waren die vorhandenen Einrichtungen von Salon und Herrenzimmer leider
für die Anordnung im Grundriß maßgebend. Die Anrichte hat geringe
Geschoßhöhe und das Fremdenzimmer-Obergeschoß ist aufgetreppt ange-
ordnet, so daß sich zwischen beide eine Nähstube, vom Podest der Treppe
zum Obergeschoß und vom Austritt der Nebentreppe aus zugänglich, ein-
schieben ließ. — Das Material ist für den Sockel Kalkstein, darüber an den
Hauptfronten Hilssandstein, an der Rückseite gekämmter Putz; für das
Erdgeschoß an den Hauptfronten Hilssandstein, sonst Zementputz; für das
Obergeschoß Zementputz. Die Verzierungen, Gesimse usw. sind aus Sand-
stein, ebenso der mit Kupfer gedeckte Dacherker. Das Hauptdach ist mit
Biberschwänzen eingedeckt; die Schornsteine sind in roten Ziegeln mit
Wohnhaus des Herrn Strauch in Bremen. Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge,
Heizungsverkleidung mit Schrankaufsatz B.D. A. in Bremen.
im Speisezimmer.
29
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
Heft 3
Wohnhaus des Herrn Strauch in Bremen.
Halle des Erdgeschosses.
Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge,
B. D.A. in Bremen.
doch alle Anzeichen dafür vor, daß wir bald einen neuen Stil
haben werden, dann sei es geboten, modern und historisch
zu arbeiten. Prof, von Lange empfahl Ehrfurcht vor
dem Alten, herzliche Liebe zum Neuen. Gurlitt er-
innerte daran, wie sehr wir uns freuen, wenn wir einmal
eine Kirche finden, die noch nicht 2- oder 3mal historisch
restauriert ist. Die Experimente der historischen Restaurie-
rungen haben ein außerordentlich schlechtes Ergebnis gehabt.
Keine Zerstörer haben schlimmer gewütet, als das 19. Jahr-
hundert, und am schlimmsten ist es da geworden, wo die
Restaurierung »am richtigsten« war. Wir müssen den Mut
besitzen, unsre Formensprache zu reden. Prof. Clernen:
»Kein Sammler entwertet seine Originale, indem er Nach-
ahmungen daneben stellt; warum handeln wir beim Restaurie-
ren nicht ebenso? Wir kommen aus einem historischen
Jahrhundert; die Zukunft wird nicht so unter historischem
Einfluß stehen. Ich bin gewiß, im Jahre 1915 wird man
nicht mehr nach dem Stil fragen, sondern in zeitgemäßen
Formen schaffen.« Prof. Dehio möchte beide Richtungen
als berechtigt anerkannt sehen. Die Gemütswerte werden
ihre Bedeutung nicht verlieren. Er bitte aber die Vertreter
der modernen Richtung, sie möchten von Zeit zu Zeit auch
einmal tolerant sein, nicht gegen Prof. Webers historische
Richtung, aber gegen Anschauungen wie die der Hamburger.
Diese umfassende, erst an eine besondere Aufgabe
gleichsam als Schulbeispiel anknüpfende, dann allgemein
theoretische Aussprache über die Stilfrage bei Wiederher-
stellung alter Baulichkeiten war das weitaus wichtigste Er-
gebnis der Verhandlungen des 10. Denkmalpflegetags.
deren ursprüngliche Form unzweifelhaft feststeht. Bei solchen unumgäng-
lichen Erläuterungsarbeiten gehe allerdings viel malerischer Reiz, viel
Stimmungswert verloren. Deshalb solle man solche Arbeiten nur den ge-
nauesten Kennern des betreffenden alten Stils anvertrauen; sie sind repro-
duktive Spezialistenarbeit, die den feinsten Geschmack erfordert. Dagegen
sollen alle Erneuerungen selbständiger Bauteile, alle Vergrößerungen, An-
und Aufbauten nicht in dem Stile des Bauwerks, sondern in freier moderner
Formgebung ausgeführt werden, und wenn ein Baudenkmal mit bisher
nicht vorhanden gewesenen Wandmalereien oder mit gemalten Fenstern
oder Einrichtungsstücken ausgestattet wird, sollen diese gleichfalls nicht
in dem Stile des Bauwerks oder betreffenden Bauteils, sondern gleichfalls
in modernem Stil ausgeführt werden. Dies ist der Standpunkt des weitaus
größten Teils der jüngeren — nicht bloß der jüngsten — deutschen
Architekten.
Gerade die Ehrfurcht vor unsern alten Baudenkmälern soll uns von
dem Versuch abhalten, ihnen Bauteile anzufügen, die im besten Falle
mehr oder minder gelungene Imitationen und geeignet sind, den ursprüng-
lichen Baugedanken zu verwischen. So verhältnismäßig wenig Künstler
es noch gibt, die fähig sind, größere Bau- und Wiederherstellungsarbeiten
in moderner Formengebung gut zu lösen, so wenig Architekten gibt es,
welche die Formensprache früherer Jahrhunderte so beherrschen, daß sie
wirklich künstlerische Leistungen damit zustande brächten. 90 von 100 in
altem Stile restaurierte Bauten kann man nur mit dem Ausdruck des Be-
dauerns betrachten; die Nachahmung neben dem Alten hat eine ungewollte
Dissonanz ergeben, die störender ist als der Gegensatz zwischen Alt und
Neu. Es ist kein Unglück, daß die Marienburg und die Hohkönigsburg
hergestellt worden sind, aber es ist lebhaft zu bedauern, wenn jetzt mehr
und mehr rheinische Burgen »stilrein« restauriert werden. Verkehrt ist es,
alle Restaurierungsarbeiten des 19. Jahrhunderts in Bausch und Bogen zu
verdammen, einzelne solcher Bauten von Schmidt, Ungewitter, Heideloff,
Essenwein, Schäfer verdienen Anerkennung, aber im ganzen ist uns die
alte Formensprache zu wenig vertraut, als daß da künstlerisch einwand-
freie Leistungen möglich wären.
Der Kernpunkt ist die Frage: Was ist Stil? Ist Stil — nach Semper —
die Übereinstimmung einer Kunsterscheinung mit ihrer Entstehungsge-
schichte, mit allen Vorbedingungen und Umständen ihres Werdens, so
dürfen wir von einem modernen Stil sprechen. Es ist keine Phrase, wenn
wir sagen: Unsere Bauten sollen das Kunstempfinden unsrer Zeit wieder-
spiegeln, als Dokumente der schöpferischen Kraft unsrer Zeit auf die
Nachwelt kommen. Mag auch das Kunstempfinden unsrer Tage etwas
schnell wechseln, so fehlt unsrer modernen Kunstentwicklung doch nicht
die Kontinuität. Wir wollen genaues Studium des Alten, wollen aber frei
werden vom Stil; wir wollen über dem Stil stehen und ihn nach dem
Empfinden unsrer Zeit umgestalten, weiterbilden. Solche Werke haben
wir: den Werken Schäfers — dem Universitätsbau zu Marburg und der
Kirche zu Karlsruhe —, stehen als moderne Bauten in Formen unsrer
Zeit Theodor Fischers Universität zu Jena und Kirche zu Schwabing ge-
genüber, glänzende Beispiele von Werken eines Meisters, der über den
Stilen steht. Und noch könnte man eine ganze Reihe schätzenswerter
Leistungen moderner Architekten nennen, die das Jahrhundert überdauern
werden, von Martin Dülfer, Fritz Schumacher, Schmitz, Billing, Hoffmann
und anderen. Diese Bauten sind die Vertreter der Richtung, die wir
modern nennen. Wie in der Architektur, geht auch durch die moderne
Plastik und Malerei ein frischer lebendiger Zug. Männer wie Otto Guß-
mann in Dresden sind den Aufgaben der Denkmalpflege durchaus ge-
wachsen. Wir sind also auf gutem Wege und haben Leistungen hinter
uns, die uns berechtigten, auf dem Gebiete der Denkmalpflege mitzu-
wirken. Man soll deshalb den modern empfindenden Künstlern auch
die Gelegenheit geben, ihre Kräfte zu erproben und zu betätigen. (Starker
Beifall.)
An die beiden Vorträge schloß sich eine lebhafte Aussprache, an der
sich eine Reihe der hervorragendsten Vertreter der Denkmalpflege be-
teiligten. Prof, von Lange (Tübingen), Gurlitt und Cie men ver-
traten auf das nachdrücklichste die moderne Auffassung. Auch Prof.
Stiehl meinte, wenn auch der neue Stil noch nicht vorhanden sei, lägen
Beschreibung der Abbildungen.
Tafel 17 u. 18. Wohnhaus des Herrn Georg Strauch in Bre-
men. Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge, B. D. A. in Bremen.
Das Haus ist das Wohnhaus eines Bremer Großkaufmanns. Das
Gelände liegt etwas über Straßenhöhe; wegen des lebhaften Verkehrs auf
der Chaussee wurde das Gebäude weit von der Straße zurückgelegt. Durch
den schönen alten Baumbestand wurde die Längenausdehnung des Ge-
bäudes festgelegt. Die Anordnungen der Treppen und die Lage der Räume
zu einander wurden durch bestimmte Wünsche des Bauherrn bedingt; auch
waren die vorhandenen Einrichtungen von Salon und Herrenzimmer leider
für die Anordnung im Grundriß maßgebend. Die Anrichte hat geringe
Geschoßhöhe und das Fremdenzimmer-Obergeschoß ist aufgetreppt ange-
ordnet, so daß sich zwischen beide eine Nähstube, vom Podest der Treppe
zum Obergeschoß und vom Austritt der Nebentreppe aus zugänglich, ein-
schieben ließ. — Das Material ist für den Sockel Kalkstein, darüber an den
Hauptfronten Hilssandstein, an der Rückseite gekämmter Putz; für das
Erdgeschoß an den Hauptfronten Hilssandstein, sonst Zementputz; für das
Obergeschoß Zementputz. Die Verzierungen, Gesimse usw. sind aus Sand-
stein, ebenso der mit Kupfer gedeckte Dacherker. Das Hauptdach ist mit
Biberschwänzen eingedeckt; die Schornsteine sind in roten Ziegeln mit
Wohnhaus des Herrn Strauch in Bremen. Architekten: Carl Eeg & Ed. Runge,
Heizungsverkleidung mit Schrankaufsatz B.D. A. in Bremen.
im Speisezimmer.
29