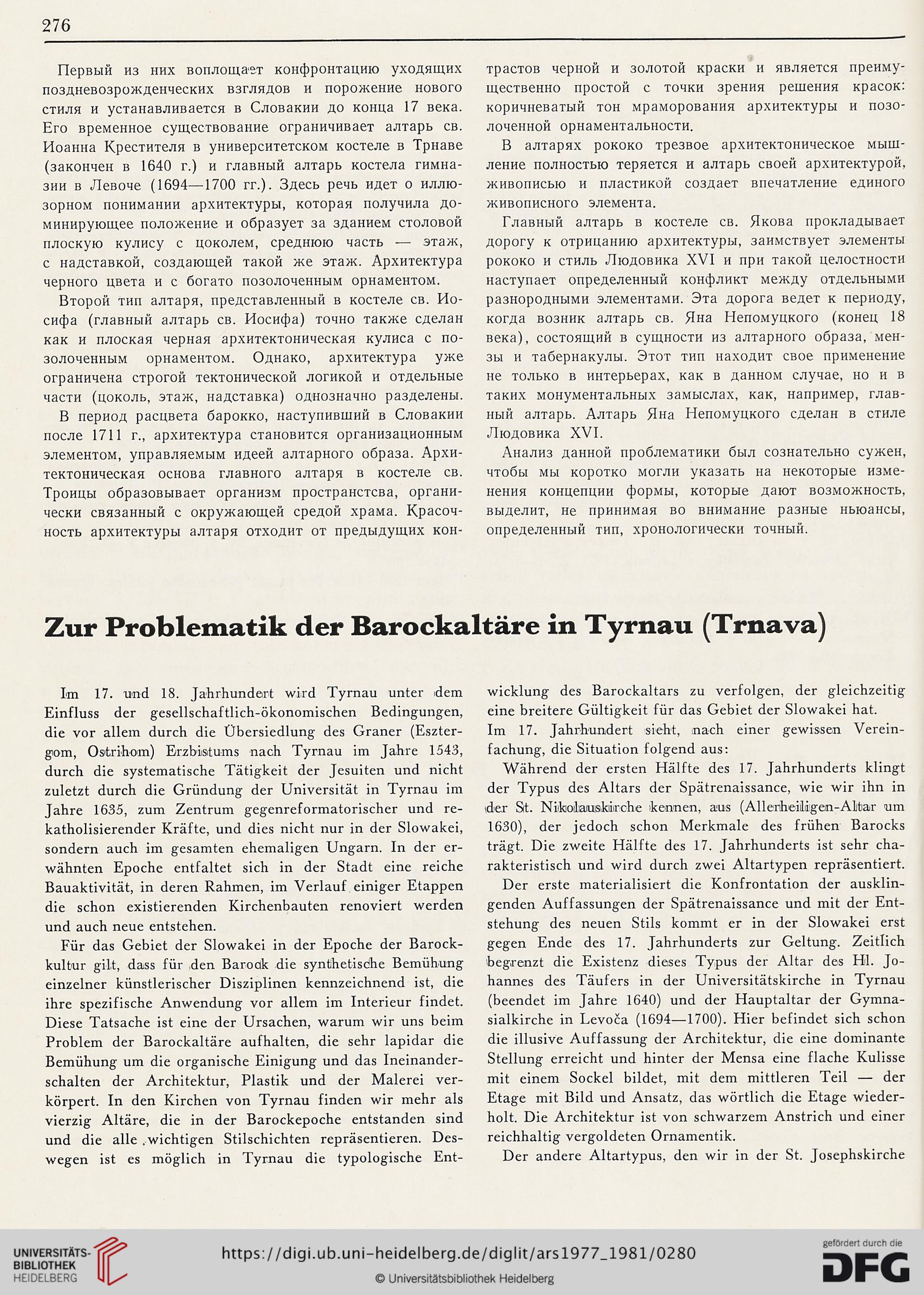276
riepBblft H3 HHX BOn.lOmaST KOHfjjpOHTailHIO yXOAaillHX
no3AHeBO3po>KAeHaecKHx bswiaaob h nopoxenne hobofo
cthjih h ycTanasjiHBaeTca b Cjiobskhh ao kohub 17 Bexa.
Ero BpeweHHoe cymecTBOBaHHe orpaHHiHBaer a.nrapb cb.
IdoaHHa KpecTHTejiii b ynmepcHTeTCKOM KOCTejie b TpnaBe
(aaKOHaen b 1640 r.) h rjiaBiibiö ajiTapt KOCTeJia phmhs-
3hh b JleBoae (1694—1700 rr.). 3Aecb peqb habt o hjijiio-
30PH0M HOHHM3HHH apXHTBKTypbl, KOTOpajl nOJiyHHJia AO-
MHHHpyiomee noJioMenne h oôpaayeT sa sashhcm ctojioboh
njiocKyio KyjiHcy c uokojicm, cpeAHioio hsctb — ara/ii,
c HaACTaBKoň, co3AaiomeH TaKoft >i<e 3Ta>K. ApxHTeKTypa
HepHoro u,BeTa h c óoraio noaojioaeHHbiM opnaMeHTOM.
BTopoft thh ajiTapa, npeACTaBJieHHHH b KOCTeae cb. Ho-
CHcfia (rjiaBHbiň a/iTapb cb. HocHjia) tohho TaKHte cAeJian
KäK h njiocKaa nepnan apxHTeKTOHHHecKaa Ky-iiHca c no-
3OJiOHeHHbiM opHaMeHTOM. Oah3ko, apxHTeKTypa yjKe
orpaHHaena erporoň TeKTOHmecKOÖ jiofhkoh h OTAeJibHbie
H3CTH (lIOKOJIb, 3T3JK, HaACTSBKa) 0AHO3H3HH0 pa3AeJieHbI.
B nepHOA pacitBera óapoKKo, HacTynHBiiiHH b Cjiob3khh
nocjie 1711 r., apxHTeKTypa ct3hobhtch opraHH3aijHOHHbiM
sjíeMeHTOM, ynpaBJíaeMMM HAeeň ajrrapHoro oöpasa. Apxn-
TeKTOHHHecKan ocHOBa rjiaBHoro ajiTapa b koctcjic cb.
TpoHAbi oópaaoBbiBaeT opranH3M npocTpancTCBa, oprann-
qecKH cBH33HHbiň c OKpyJKaromeÄ cpeAoft xpaMa. Kpacoa-
HocTb apxHTeKTypbi ajiTapu otxoaht ot npeAMAymnx koh-
TpaCTOB qepHOH H 3OJIOTOH KpaCKH H HBJíaeTCH npeHMy-
mecTBenHo npocTOH c tohkh spennu peineHHn KpacoK:
KOpHMIieBaTblH TOH MpaMOpOBaHHH apXHTBKTypbl H 11030-
JIOaeHHOH OpHaMeHTajIbHOCTH.
B ajiTapax pokoko Tpe3Boe apxHTeKTOHHuecKoe mmui-
jieHHe noJiHOCTbio TepaeTca h ajrrapb cBoeň apxHTeKTypoií,
>KHBonHCbio h njiacTHKOH c03AaeT BneqaTJieHHe eAHHoro
IKHBOHHCHOrO 3JieM6HTa.
rjiaBHMH ajiTapb b KocTejie cb. ÍIkobs npoKJiaAbiBaeï
Aopory k orpnuaiiHio apxHTeKTypbi, 3aHMCTByeT s/icmci-itli
pOKOKO H CTHJIb JIlOAOBHKa XVI H npH T3K0H IjeJlOCTHOCTH
HacTynaeT onpeAeaeHHbiň kohJijihkt mbikav OTAëJibHbiMH
pa3HopoAHbiMH 3JieMeHTaMH. 3ra Aopora bcact k nepučily,
KorAa B03HHK ajiTapb cb. 51 na HenoMyiiKoro (Koneii 18
BeKa), COCTOHIIlHH B CyiUHOCTH H3 ajiTapHoro 0Čpa3a, MeH-
3M h TaóepHaKyjibi. 3tot thii hsxoaht CBoe npHMeneHHe
ne TOJibKo b HHTepbepax, kbk b ashhom cjiyqae, ho h b
tskhx MOHyMeHTajibHbix 3aMbicjiax, KaK, nanpHMep, rjias-
Hbifi ajiTapb. AjiTapb flna HenoMypKoro cAe.aaii b ciHJie
JIlOAOBHKa XVI.
AnajiH3 AaHHoft npoóJieMaTHKH ßbiji cosnaTejibHO cyiKen,
HTOÖbl Mbl KOpOTKO MOIVIH yK333Tb Ha HeKOTOpbie H3M6-
HeHHH KOHItenUHH cjlOpMbl, KOTOpbie AaiOT BO3MOJKHOCTB,
BbiAejiHT, ne npHHHMan bo BHHMaHHe pa3Hbie Hbioancw,
onpeAeJieHHbifi thh, xpoHojioranecKH tohhmh.
Zur Problematik der Barockaltäre in Tyrnau (Trnava)
Im 17. und 18. Jahrhundert wird Tyrnau unter dem
Einfluss der gesellschaftlich-ökonomischen Bedingungen,
die vor allem durch die Übersiedlung des Graner (Eszter-
gom, Ostrihom) Erzbistums nach Tyrnau im Jahre 1543,
durch die systematische Tätigkeit der Jesuiten und nicht
zuletzt durch die Gründung der Universität in Tyrnau im
Jahre 1635, zum Zentrum gegenreformatorischer und re-
katholisierender Kräfte, und dies nicht nur in der Slowakei,
sondern auch im gesamten ehemaligen Ungarn. In der er-
wähnten Epoche entfaltet sich in der Stadt eine reiche
Bauaktivität, in deren Rahmen, im Verlauf einiger Etappen
die schon existierenden Kirchenbauten renoviert werden
und auch neue entstehen.
Für das Gebiet der Slowakei in der Epoche der Barock-
kultur gilt, dass für den Barook die synthetische Bemühung
einzelner künstlerischer Disziplinen kennzeichnend ist, die
ihre spezifische Anwendung vor allem im Interieur findet.
Diese Tatsache ist eine der Ursachen, warum wir uns beim
Problem der Barockaltäre aufhalten, die sehr lapidar die
Bemühung um die organische Einigung und das Ineinander-
schalten der Architektur, Plastik und der Malerei ver-
körpert. In den Kirchen von Tyrnau finden wir mehr als
vierzig Altäre, die in der Barockepoche entstanden sind
und die alle . wichtigen Stilschichten repräsentieren. Des-
wegen ist es möglich in Tyrnau die typologische Ent-
wicklung des Barockaltars zu verfolgen, der gleichzeitig
eine breitere Gültigkeit für das Gebiet der Slowakei hat.
Im 17. Jahrhundert sieht, nach einer gewissen Verein-
fachung, die Situation folgend aus:
Während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts klingt
der Typus des Altars der Spätrenaissance, wie wir ihn in
ider St. Niikolauiskiirche kennen, aus (Allerheiligen-Altar um
1630), der jedoch schon Merkmale des frühen Barocks
trägt. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ist sehr cha-
rakteristisch und wird durch zwei Altartypen repräsentiert.
Der erste materialisiert die Konfrontation der ausklin-
genden Auffassungen der Spätrenaissance und mit der Ent-
stehung des neuen Stils kommt er in der Slowakei erst
gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur Geltung. Zeitlich
begrenzt die Existenz dieses Typus der Altar des Hl. Jo-
hannes des Täufers in der Universitätskirche in Tyrnau
(beendet im Jahre 1640) und der Hauptaltar der Gymna-
sialkirche in Levoča (1694—1700). Hier befindet sich schon
die illusive Auffassung der Architektur, die eine dominante
Stellung erreicht und hinter der Mensa eine flache Kulisse
mit einem Sockel bildet, mit dem mittleren Teil — der
Etage mit Bild und Ansatz, das wörtlich die Etage wieder-
holt. Die Architektur ist von schwarzem Anstrich und einer
reichhaltig vergoldeten Ornamentik.
Der andere Altartypus, den wir in der St. Josephskirche
riepBblft H3 HHX BOn.lOmaST KOHfjjpOHTailHIO yXOAaillHX
no3AHeBO3po>KAeHaecKHx bswiaaob h nopoxenne hobofo
cthjih h ycTanasjiHBaeTca b Cjiobskhh ao kohub 17 Bexa.
Ero BpeweHHoe cymecTBOBaHHe orpaHHiHBaer a.nrapb cb.
IdoaHHa KpecTHTejiii b ynmepcHTeTCKOM KOCTejie b TpnaBe
(aaKOHaen b 1640 r.) h rjiaBiibiö ajiTapt KOCTeJia phmhs-
3hh b JleBoae (1694—1700 rr.). 3Aecb peqb habt o hjijiio-
30PH0M HOHHM3HHH apXHTBKTypbl, KOTOpajl nOJiyHHJia AO-
MHHHpyiomee noJioMenne h oôpaayeT sa sashhcm ctojioboh
njiocKyio KyjiHcy c uokojicm, cpeAHioio hsctb — ara/ii,
c HaACTaBKoň, co3AaiomeH TaKoft >i<e 3Ta>K. ApxHTeKTypa
HepHoro u,BeTa h c óoraio noaojioaeHHbiM opnaMeHTOM.
BTopoft thh ajiTapa, npeACTaBJieHHHH b KOCTeae cb. Ho-
CHcfia (rjiaBHbiň a/iTapb cb. HocHjia) tohho TaKHte cAeJian
KäK h njiocKaa nepnan apxHTeKTOHHHecKaa Ky-iiHca c no-
3OJiOHeHHbiM opHaMeHTOM. Oah3ko, apxHTeKTypa yjKe
orpaHHaena erporoň TeKTOHmecKOÖ jiofhkoh h OTAeJibHbie
H3CTH (lIOKOJIb, 3T3JK, HaACTSBKa) 0AHO3H3HH0 pa3AeJieHbI.
B nepHOA pacitBera óapoKKo, HacTynHBiiiHH b Cjiob3khh
nocjie 1711 r., apxHTeKTypa ct3hobhtch opraHH3aijHOHHbiM
sjíeMeHTOM, ynpaBJíaeMMM HAeeň ajrrapHoro oöpasa. Apxn-
TeKTOHHHecKan ocHOBa rjiaBHoro ajiTapa b koctcjic cb.
TpoHAbi oópaaoBbiBaeT opranH3M npocTpancTCBa, oprann-
qecKH cBH33HHbiň c OKpyJKaromeÄ cpeAoft xpaMa. Kpacoa-
HocTb apxHTeKTypbi ajiTapu otxoaht ot npeAMAymnx koh-
TpaCTOB qepHOH H 3OJIOTOH KpaCKH H HBJíaeTCH npeHMy-
mecTBenHo npocTOH c tohkh spennu peineHHn KpacoK:
KOpHMIieBaTblH TOH MpaMOpOBaHHH apXHTBKTypbl H 11030-
JIOaeHHOH OpHaMeHTajIbHOCTH.
B ajiTapax pokoko Tpe3Boe apxHTeKTOHHuecKoe mmui-
jieHHe noJiHOCTbio TepaeTca h ajrrapb cBoeň apxHTeKTypoií,
>KHBonHCbio h njiacTHKOH c03AaeT BneqaTJieHHe eAHHoro
IKHBOHHCHOrO 3JieM6HTa.
rjiaBHMH ajiTapb b KocTejie cb. ÍIkobs npoKJiaAbiBaeï
Aopory k orpnuaiiHio apxHTeKTypbi, 3aHMCTByeT s/icmci-itli
pOKOKO H CTHJIb JIlOAOBHKa XVI H npH T3K0H IjeJlOCTHOCTH
HacTynaeT onpeAeaeHHbiň kohJijihkt mbikav OTAëJibHbiMH
pa3HopoAHbiMH 3JieMeHTaMH. 3ra Aopora bcact k nepučily,
KorAa B03HHK ajiTapb cb. 51 na HenoMyiiKoro (Koneii 18
BeKa), COCTOHIIlHH B CyiUHOCTH H3 ajiTapHoro 0Čpa3a, MeH-
3M h TaóepHaKyjibi. 3tot thii hsxoaht CBoe npHMeneHHe
ne TOJibKo b HHTepbepax, kbk b ashhom cjiyqae, ho h b
tskhx MOHyMeHTajibHbix 3aMbicjiax, KaK, nanpHMep, rjias-
Hbifi ajiTapb. AjiTapb flna HenoMypKoro cAe.aaii b ciHJie
JIlOAOBHKa XVI.
AnajiH3 AaHHoft npoóJieMaTHKH ßbiji cosnaTejibHO cyiKen,
HTOÖbl Mbl KOpOTKO MOIVIH yK333Tb Ha HeKOTOpbie H3M6-
HeHHH KOHItenUHH cjlOpMbl, KOTOpbie AaiOT BO3MOJKHOCTB,
BbiAejiHT, ne npHHHMan bo BHHMaHHe pa3Hbie Hbioancw,
onpeAeJieHHbifi thh, xpoHojioranecKH tohhmh.
Zur Problematik der Barockaltäre in Tyrnau (Trnava)
Im 17. und 18. Jahrhundert wird Tyrnau unter dem
Einfluss der gesellschaftlich-ökonomischen Bedingungen,
die vor allem durch die Übersiedlung des Graner (Eszter-
gom, Ostrihom) Erzbistums nach Tyrnau im Jahre 1543,
durch die systematische Tätigkeit der Jesuiten und nicht
zuletzt durch die Gründung der Universität in Tyrnau im
Jahre 1635, zum Zentrum gegenreformatorischer und re-
katholisierender Kräfte, und dies nicht nur in der Slowakei,
sondern auch im gesamten ehemaligen Ungarn. In der er-
wähnten Epoche entfaltet sich in der Stadt eine reiche
Bauaktivität, in deren Rahmen, im Verlauf einiger Etappen
die schon existierenden Kirchenbauten renoviert werden
und auch neue entstehen.
Für das Gebiet der Slowakei in der Epoche der Barock-
kultur gilt, dass für den Barook die synthetische Bemühung
einzelner künstlerischer Disziplinen kennzeichnend ist, die
ihre spezifische Anwendung vor allem im Interieur findet.
Diese Tatsache ist eine der Ursachen, warum wir uns beim
Problem der Barockaltäre aufhalten, die sehr lapidar die
Bemühung um die organische Einigung und das Ineinander-
schalten der Architektur, Plastik und der Malerei ver-
körpert. In den Kirchen von Tyrnau finden wir mehr als
vierzig Altäre, die in der Barockepoche entstanden sind
und die alle . wichtigen Stilschichten repräsentieren. Des-
wegen ist es möglich in Tyrnau die typologische Ent-
wicklung des Barockaltars zu verfolgen, der gleichzeitig
eine breitere Gültigkeit für das Gebiet der Slowakei hat.
Im 17. Jahrhundert sieht, nach einer gewissen Verein-
fachung, die Situation folgend aus:
Während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts klingt
der Typus des Altars der Spätrenaissance, wie wir ihn in
ider St. Niikolauiskiirche kennen, aus (Allerheiligen-Altar um
1630), der jedoch schon Merkmale des frühen Barocks
trägt. Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts ist sehr cha-
rakteristisch und wird durch zwei Altartypen repräsentiert.
Der erste materialisiert die Konfrontation der ausklin-
genden Auffassungen der Spätrenaissance und mit der Ent-
stehung des neuen Stils kommt er in der Slowakei erst
gegen Ende des 17. Jahrhunderts zur Geltung. Zeitlich
begrenzt die Existenz dieses Typus der Altar des Hl. Jo-
hannes des Täufers in der Universitätskirche in Tyrnau
(beendet im Jahre 1640) und der Hauptaltar der Gymna-
sialkirche in Levoča (1694—1700). Hier befindet sich schon
die illusive Auffassung der Architektur, die eine dominante
Stellung erreicht und hinter der Mensa eine flache Kulisse
mit einem Sockel bildet, mit dem mittleren Teil — der
Etage mit Bild und Ansatz, das wörtlich die Etage wieder-
holt. Die Architektur ist von schwarzem Anstrich und einer
reichhaltig vergoldeten Ornamentik.
Der andere Altartypus, den wir in der St. Josephskirche