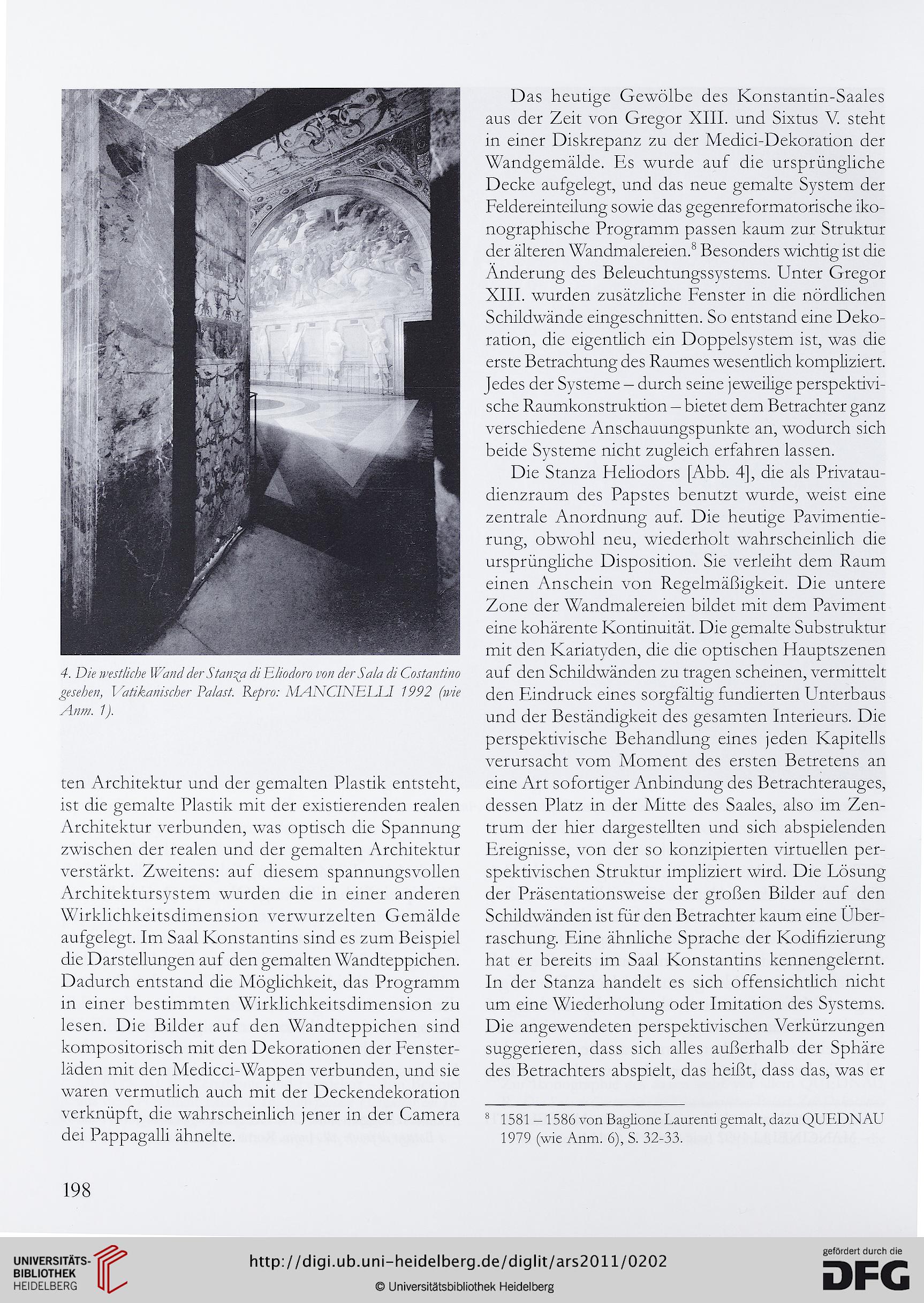L D/ř Uü/V Ar AL/LAro w/? Ar KZ? A
<g&rřA%, IK/ZÁ^AfA^f P^Att. Rč^ro.* AL4XLIXELLJ /PL? (Wř
R[%%y. 7^).
ten Architektur und der gemalten Plastik entsteht,
ist die gemalte Plastik mit der existierenden realen
Architektur verbunden, was optisch die Spannung
zwischen der realen und der gemalten Architektur
verstärkt. Zweitens: auf diesem spannungsvollen
Architektursystem wurden die in einer anderen
Wirklichkeitsdimension verwurzelten Gemälde
aufgelegt. Im Saal Konstantins sind es zum Beispiel
die Darstellungen auf den gemalten Wandteppichen.
Dadurch entstand die Möglichkeit, das Programm
in einer bestimmten Wirklichkeitsdimension zu
lesen. Die Bilder auf den Wandteppichen sind
kompositorisch mit den Dekorationen der Fenster-
läden mit den Medicci-Wappen verbunden, und sie
waren vermutlich auch mit der Deckendekoration
verknüpft, die wahrscheinlich jener in der Camera
dei Pappagalli ähnelte.
Das heutige Gewölbe des Konstantin-Saales
aus der Zeit von Gregor XIII. und Sixtus V steht
in einer Diskrepanz zu der Medici-Dekoration der
Wandgemälde. Es wurde auf die ursprüngliche
Decke aufgelegt, und das neue gemalte System der
Feldereinteilung sowie das gegenreformatorische iko-
nographische Programm passen kaum zur Struktur
der älteren Wandmalereien^ Besonders wichtig ist die
Änderung des Beleuchtungssystems. Unter Gregor
XIII. wurden zusätzliche Fenster in die nördlichen
Schildwände eingeschnitten. So entstand eine Deko-
ration, die eigentlich ein Doppelsystem ist, was die
erste Betrachtung des Raumes wesentlich kompliziert.
Jedes der Systeme — durch seine jeweilige perspektivi-
sche Raumkonstruktion — bietet dem Betrachter ganz
verschiedene Anschauungspunkte an, wodurch sich
beide Systeme nicht zugleich erfahren lassen.
Die Stanza Heliodors [Abb. 4], die als Privatau-
dienzraum des Papstes benutzt wurde, weist eine
zentrale Anordnung auf. Die heutige Pavimentie-
rung, obwohl neu, wiederholt wahrscheinlich die
ursprüngliche Disposition. Sie verleiht dem Raum
einen Anschein von Regelmäßigkeit. Die untere
Zone der Wandmalereien bildet mit dem Paviment
eine kohärente Kontinuität. Die gemalte Sub struktur
mit den Kariatyden, die die optischen Hauptszenen
auf den Schildwänden zu tragen scheinen, vermittelt
den Eindruck eines sorgfältig fundierten Unterhaus
und der Beständigkeit des gesamten Interieurs. Die
perspektivische Behandlung eines jeden Kapitells
verursacht vom Moment des ersten Betretens an
eine Art sofortiger Anbindung des Betrachterauges,
dessen Platz in der Mitte des Saales, also im Zen-
trum der hier dargestellten und sich abspielenden
Ereignisse, von der so konzipierten virtuellen per-
spektivischen Struktur impliziert wird. Die Lösung
der Präsentationsweise der großen Bilder auf den
Schildwänden ist für den Betrachter kaum eine Über-
raschung. Eine ähnliche Sprache der Kodihzierung
hat er bereits im Saal Konstantins kennengelernt.
In der Stanza handelt es sich offensichtlich nicht
um eine Wiederholung oder Imitation des Systems.
Die angewendeten perspektivischen Verkürzungen
suggerieren, dass sich alles außerhalb der Sphäre
des Betrachters abspielt, das heißt, dass das, was er
1581 — 1586 von Baglione Laufend gemalt, dazu QUEDNAU
1979 (wie Anm. 6), S. 32-33.
198