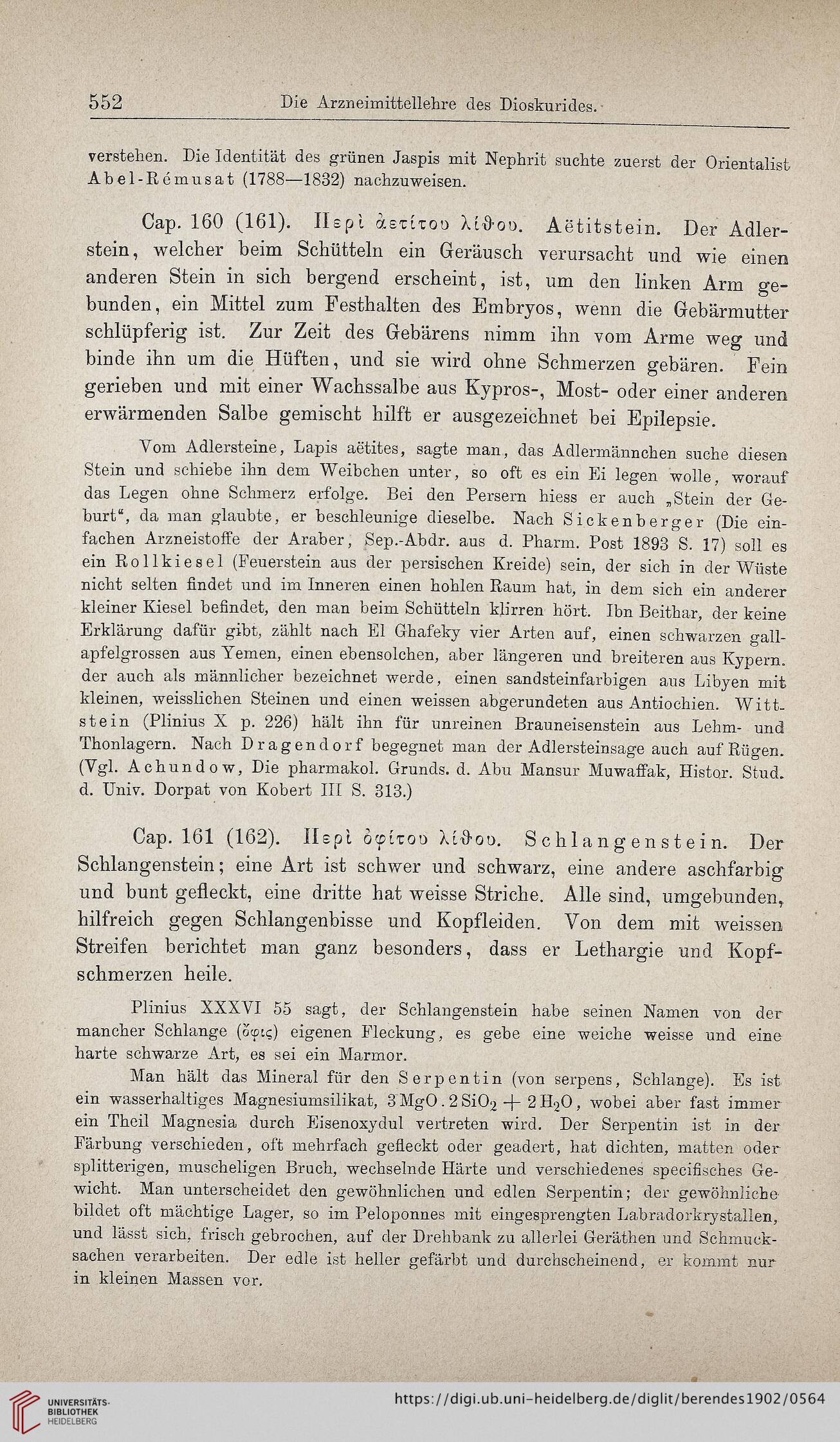552
Die Arzneimittellehre des Dioskurides.
verstehen. Die Identität des grünen Jaspis mit Nephrit suchte zuerst der Orientalist
Abel-Remusat (1788—1832) nachzuweisen.
Cap. 160 (161). IIεpί άετίτου λίθου. Aetitstein. Der Adler-
stein, welcher beim Schütteln ein Geräusch verursacht und wie einen
anderen Stein in sich bergend erscheint, ist, um den linken Arm ge-
bunden, ein Mittel zum Festhalten des Embryos, wenn die Gebärmutter
schlüpferig ist. Zur Zeit des Gebärens nimm ihn vom Arme weg und
binde ihn um die Hüften, und sie wird ohne Schmerzen gebären. Fein
gerieben und mit einer Wachssalbe aus Kypros-, Most- oder einer anderen
erwärmenden Salbe gemischt hilft er ausgezeichnet bei Epilepsie.
Vom Adlersteine, Lapis aetites, sagte man, das Adlermännchen suche diesen
Stein und schiebe ihn dem Weibchen unter, so oft es ein Ei legen wolle, worauf
das Legen ohne Schmerz erfolge. Bei den Persern hiess er auch „Stein der Ge-
burt“, da man glaubte, er beschleunige dieselbe. Nach Sickenberger (Die ein-
fachen Arzneistoffe der Araber, Sep.-Abdr. aus d. Pharm. Post 1893 S. 17) soll es
ein Rollkiesel (Feuerstein aus der persischen Kreide) sein, der sich in der Wüste
nicht selten findet und im Inneren einen hohlen Raum hat, in dem sich ein anderer
kleiner Kiesel befindet, den man beim Schütteln klirren hört. Ibn Beithar, der keine
Erklärung dafür gibt, zählt nach El Ghafeky vier Arten auf, einen schwarzen gall-
apfelgrossen aus Yemen, einen ebensolchen, aber längeren und breiteren aus Kypern.
der auch als männlicher bezeichnet werde, einen sandsteinfarbigen aus Libyen mit
kleinen, weisslichen Steinen und einen weissen abgerundeten aus Antiochien. Witt,
stein (Plinius X p. 226) hält ihn für unreinen Brauneisenstein aus Lehm- und
Thonlagern. Nach Dragendorf begegnet man der Adlersteinsage auch auf Rügen.
(Vgl. Achundow, Die pharmakol. Grunds, d. Abu Mansur Muwaffak, Histor. Stud.
d. Univ. Dorpat von Kobert III S. 313.)
Cap. 161 (162). Περί δφίτου λίθου. S c h 1 a n g e n s t e i n. Der
Schlangenstein; eine Art ist schwer und schwarz, eine andere aschfarbig
und bunt gefleckt, eine dritte hat weisse Striche. Alle sind, umgebunden,
hilfreich gegen Schlangenbisse und Kopfleiden. Von dem mit weissen
Streifen berichtet man ganz besonders, dass er Lethargie und Kopf-
schmerzen heile.
Plinius XXXVI 55 sagt, der Schlangenstein habe seinen Namen von der
mancher Schlange (δφις) eigenen Fleckung, es gebe eine weiche weisse und eine
harte schwarze Art, es sei ein Marmor.
Man hält das Mineral für den Serpentin (von serpens, Schlange). Es ist
ein wasserhaltiges Magnesiumsilikat, 3 MgO. 2 S1O2 + 2 HjO, wobei aber fast immer
ein Theil Magnesia durch Eisenoxydul vertreten wird. Der Serpentin ist in der
Färbung verschieden, oft mehrfach gefleckt oder geadert, hat dichten, matten oder
splitterigen, muscheligen Bruch, wechselnde Härte und verschiedenes specifisches Ge-
wicht. Man unterscheidet den gewöhnlichen und edlen Serpentin; der gewöhnliche
bildet oft mächtige Lager, so im Peloponnes mit eingesprengten Labradorkrystallen,
und lässt sich, frisch gebrochen, auf der Drehbank zu allerlei Geräthen und Schmuck-
sachen verarbeiten. Der edle ist heller gefärbt und durchscheinend, er kommt nur
in kleinen Massen vor.
Die Arzneimittellehre des Dioskurides.
verstehen. Die Identität des grünen Jaspis mit Nephrit suchte zuerst der Orientalist
Abel-Remusat (1788—1832) nachzuweisen.
Cap. 160 (161). IIεpί άετίτου λίθου. Aetitstein. Der Adler-
stein, welcher beim Schütteln ein Geräusch verursacht und wie einen
anderen Stein in sich bergend erscheint, ist, um den linken Arm ge-
bunden, ein Mittel zum Festhalten des Embryos, wenn die Gebärmutter
schlüpferig ist. Zur Zeit des Gebärens nimm ihn vom Arme weg und
binde ihn um die Hüften, und sie wird ohne Schmerzen gebären. Fein
gerieben und mit einer Wachssalbe aus Kypros-, Most- oder einer anderen
erwärmenden Salbe gemischt hilft er ausgezeichnet bei Epilepsie.
Vom Adlersteine, Lapis aetites, sagte man, das Adlermännchen suche diesen
Stein und schiebe ihn dem Weibchen unter, so oft es ein Ei legen wolle, worauf
das Legen ohne Schmerz erfolge. Bei den Persern hiess er auch „Stein der Ge-
burt“, da man glaubte, er beschleunige dieselbe. Nach Sickenberger (Die ein-
fachen Arzneistoffe der Araber, Sep.-Abdr. aus d. Pharm. Post 1893 S. 17) soll es
ein Rollkiesel (Feuerstein aus der persischen Kreide) sein, der sich in der Wüste
nicht selten findet und im Inneren einen hohlen Raum hat, in dem sich ein anderer
kleiner Kiesel befindet, den man beim Schütteln klirren hört. Ibn Beithar, der keine
Erklärung dafür gibt, zählt nach El Ghafeky vier Arten auf, einen schwarzen gall-
apfelgrossen aus Yemen, einen ebensolchen, aber längeren und breiteren aus Kypern.
der auch als männlicher bezeichnet werde, einen sandsteinfarbigen aus Libyen mit
kleinen, weisslichen Steinen und einen weissen abgerundeten aus Antiochien. Witt,
stein (Plinius X p. 226) hält ihn für unreinen Brauneisenstein aus Lehm- und
Thonlagern. Nach Dragendorf begegnet man der Adlersteinsage auch auf Rügen.
(Vgl. Achundow, Die pharmakol. Grunds, d. Abu Mansur Muwaffak, Histor. Stud.
d. Univ. Dorpat von Kobert III S. 313.)
Cap. 161 (162). Περί δφίτου λίθου. S c h 1 a n g e n s t e i n. Der
Schlangenstein; eine Art ist schwer und schwarz, eine andere aschfarbig
und bunt gefleckt, eine dritte hat weisse Striche. Alle sind, umgebunden,
hilfreich gegen Schlangenbisse und Kopfleiden. Von dem mit weissen
Streifen berichtet man ganz besonders, dass er Lethargie und Kopf-
schmerzen heile.
Plinius XXXVI 55 sagt, der Schlangenstein habe seinen Namen von der
mancher Schlange (δφις) eigenen Fleckung, es gebe eine weiche weisse und eine
harte schwarze Art, es sei ein Marmor.
Man hält das Mineral für den Serpentin (von serpens, Schlange). Es ist
ein wasserhaltiges Magnesiumsilikat, 3 MgO. 2 S1O2 + 2 HjO, wobei aber fast immer
ein Theil Magnesia durch Eisenoxydul vertreten wird. Der Serpentin ist in der
Färbung verschieden, oft mehrfach gefleckt oder geadert, hat dichten, matten oder
splitterigen, muscheligen Bruch, wechselnde Härte und verschiedenes specifisches Ge-
wicht. Man unterscheidet den gewöhnlichen und edlen Serpentin; der gewöhnliche
bildet oft mächtige Lager, so im Peloponnes mit eingesprengten Labradorkrystallen,
und lässt sich, frisch gebrochen, auf der Drehbank zu allerlei Geräthen und Schmuck-
sachen verarbeiten. Der edle ist heller gefärbt und durchscheinend, er kommt nur
in kleinen Massen vor.