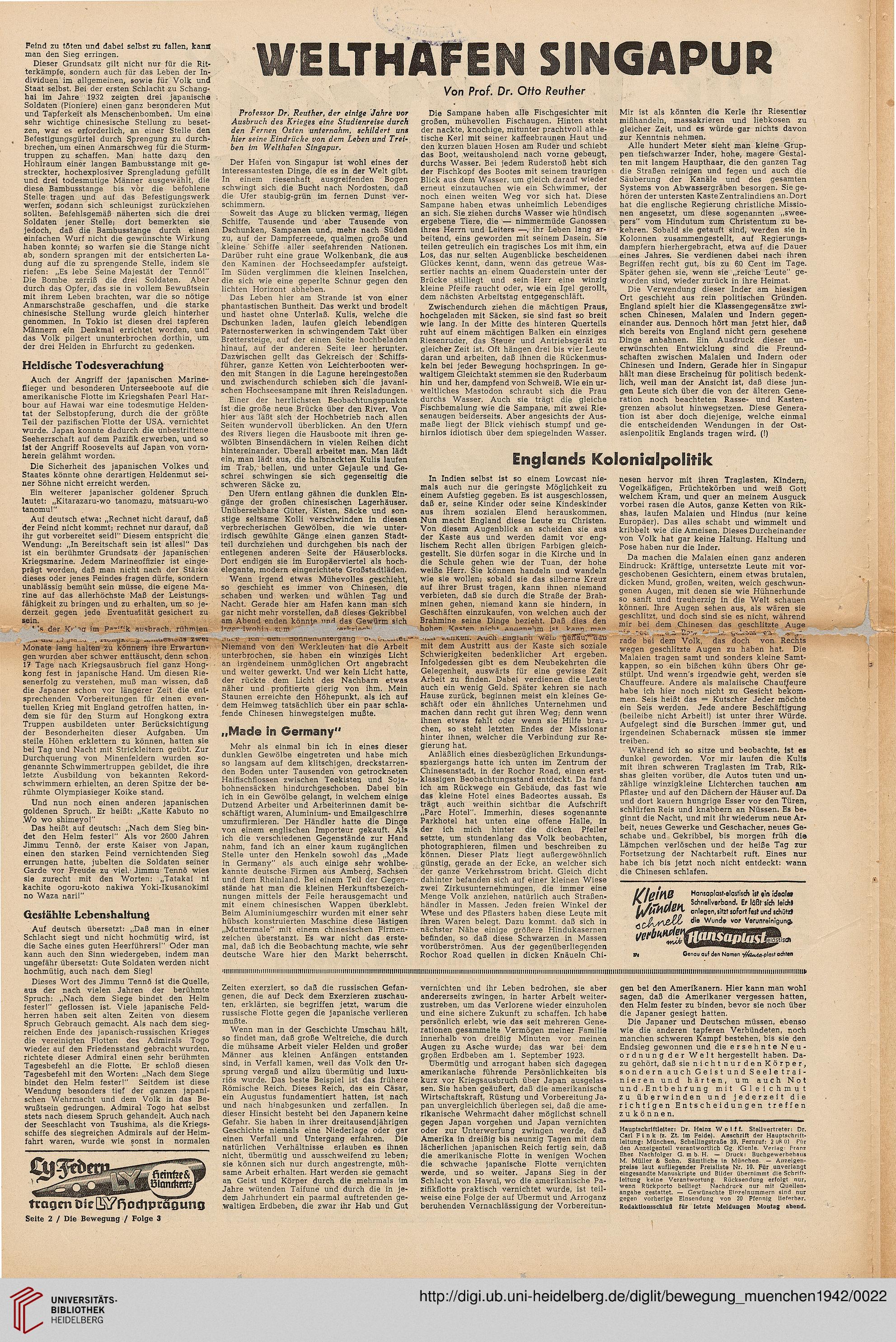Feind zu töten und dabei selbst zu fallen, kann
man den Sieg erringen.
Dieser Grundsatz gilt nicht nur für die Rit-
terkämpfe, sondern auch für das Leben der In-
dividuen im allgemeinen, sowie für Volk und
Staat selbst. Bei der ersten Schlacht zu Schang-
hai im Jahre 1932 zeigten drei japanische
Soldaten (Pioniere) einen ganz besonderen Mut
und Tapferkeit als Menschenbombefi. Um eine
sehr wichtige chinesische Stellung zu beset-
zen, war es erforderlich, an einer Stelle den
Befestigungsgürtel durch Sprengung zu durch-
brechen, um einen Anmarschweg für die Sturm-
truppen zu schaffen. Man hatte dazu den
Hohlraum einer langen Bambusstange mit ge-
streckter, hochexplosiver Sprengladung gefüllt
und drei todesmutige Männer ausgewählt, die
diese Bambusstange bis vor die befohlene
Stelle tragen und auf das Befestigungswerk
werfen, sodann sich schleunigst zurückziehen
sollten. Befehlsgemäß näherten sich die drei
Soldaten jener Stelle; dort bemerkten sie
jedoch, daß die Bambusstange durch einen
einfachen Wurf nicht die gewünschte Wirkung
haben konnte; so warfen sie die Stange nicht
ab, sondern sprangen mit der entsicherten La-
dung auf die zu sprengende Stelle, indem sie
riefen: ,,Es lebe Seine Majestät der Tennö!"
Die Bombe zerriß die drei Soldaten. Aber
durch das Opfer, das sie in vollem Bewußtsein
mit ihrem Leben brachten, war die so nötige
Anmarschstraße geschaffen, und die starke
chinesische Stellung wurde gleich hinterher
genommen. In Tokio ist diesen drei tapferen
Männern ein Denkmal errichtet worden, und
das Volk pilgert ununterbrochen dorthin, um
der drei Helden in Ehrfurcht zu gedenken.
Heldische Todesverachtung
Auch der Angriff der japanischen Marine-
flieger und besonderen Unterseeboote auf die
amerikanische Flotte im Kriegshafen Pearl Har-
bour auf Hawai war eine todesmutige Helden-
tat der Selbstopferung, durch die der größte
Teil der pazifischen "Flotte der USA. vernichtet
wurde. Japan konnte dadurch die unbestrittene
Seeherrschaft auf dem Pazifik erwerben, und so
Ist der Angriff Roosevelts auf Japan von vorn-
herein gelähmt worden.
Die Sicherheit des japanischen Volkes und
Staates könnte ohne derartigen Heldenmut sei-
ner Söhne nicht erreicht werden.
Ein weiterer japanischer goldener Spruch
lautet: „Kitarazaru-wo tanomazu, matsuaru-wo
tanomu!"
Auf deutsch etwa: „Rechnet nicht darauf, daß
der Feind nicht kommt; rechnet nur darauf, daß
ihr gut vorbereitet seidl" Diesem entspricht die
Wendung: „In Bereitschaft sein ist allesl" Das
ist ein berühmter Grundsatz der japanischen
Kriegsmarine. Jedem Marineoffizier ist einge-
prägt worden, daß man nicht nach der Stärke
dieses oder jenes Feindes fragen dürfe, sondern
unablässig bemüht sein müsse, die eigene Ma-
rine auf das allerhöchste Maß der Leistungs-
fähigkeit zu bringen und zu erhalten, um so je-
derzeit gegen jede Eventualität gesichert zu
sein.
' 's der Kr"->d im P»~!".k ausbrach, rühmten
^ i.i -fm—, n^xiyjv* ..^ rf.litL»esLons zwei
Monate lang halten zu können") ihre Erwartun-
gen wurden aber schwer enttäuscht, denn schon.
17 Tage nach Kriegsausbruch fiel ganz Hong-
kong fest in japanische Hand. Um diesen Rie-
senerfolg zu verstehen, muß man wissen, daß
die Japaner schon vor längerer Zeit die ent-
sprechenden Vorbereitungen für einen even-
tuellen Krieg mit England getroffen hatten, in-
dem sie für den Sturm auf Hongkong extra
Truppen ausbildeten unter Berücksichtigung
der Besonderheiten dieser Aufgaben. Um
steile Höhen erklettern zu können, hatten sie
bei Tag und Nacht mit Strickleitern geübt. Zur
Durchquerung von Minenfeldern wurden so-
genannte Schwimmertruppen gebildet, die ihre
letzte Ausbildung von bekannten Rekord-
schwimmern erhielten, an deren Spitze der be-
rühmte Olympiasieger Koike stand.
Und nun noch einen anderen japanischen
goldenen Spruch. Er heißt: „Katte Kabuto no
Wo wo shimeyo!"
Das heißt auf deutsch: „Nach dem Sieg bin-
det den Helm fester!" Als vor 2600 Jahren
Jiminu Tennö, der erste Kaiser von Japan,
einen den starken Feind vernichtenden Sieg
errungen hatte, jubelten die Soldaten seiner
Garde vor Freude zu viel.' Jimmu Tennö wies
sie zurecht mit den Worten: „Tatakai ni
kachite ogoru-koto nakiwa Yoki-Ikusanokimi
no Waza naril"
Gestählte Lebenshaltung
Auf deutsch übersetzt: „Daß man in einer
Schlacht siegt und nicht hochmütig wird, ist
die Sache eines guten Heerführers!" Oder man
kann auch den Sinn wiedergeben, indem man
ungefähr übersetzt: Gute Soldaten werden nicht
hochmütig, auch nach dem Sieg!
Dieses Wort des Jimmu Tenno ist die Quelle,
aus der nach vielen Jahren der berühmte
Spruch: „Nach dem Siege bindet den Helm
fester!" geflossen ist. Viele japanische Feld-
herren haben seit alten Zeiten von diesem
Spruch Gebrauch gemacht. Als nach dem sieg-
reichen Ende des japanisch-russischen Krieges
die vereinigten Flotten des Admirals Togo
wieder auf den Friedensstand gebracht wurden,
richtete dieser Admiral einen sehr berühmten
Tagesbefehl an die Flotte. Er schloß diesen
Tagesbefehl mit den Worten: „Nach dem Siege
bindet den Helm fester!" Seitdem ist diese
Wendung besonders tief der ganzen japani-
schen Wehrmacht und dem Volk in das Be-
wußtsein gedrungen. Admiral Togo hat selbst
stets nach diesem Spruch gehandelt. Auch nach
der Seeschlacht von Tsushima, als die Kriegs-
schiffe des siegreichen Admirals auf der Heim-
fahrt waren, wurde wie sonst in normalen
WELTHAFEN SINGAPUR
Professor Dr. Reuther, der einige Jahre vor
Ausbruch des Krieges eine Studienreise durch
den Fernen Osten unternahm, schildert uns
hier seine Eindrücke von dem Leben und Trei-
ben im Welthafen Singapur.
Der Hafen von Singapur ist wohl eines der
interessantesten Dinge, die es in der Welt gibt.
In einem riesenhaft ausgreifenden Bogen
schwingt sich die Bucht nach Nordosten, daß
die Ufer staubig-grün im fernen Dunst ver-
schlimmern.
Soweit das Auge zu blicken vermag, liegen
Schiffe, Tausende und aber Tausende von
Dschunken, Sampanen und, mehr nach Süden
zu, auf der Dampferreede, qualmen große und
kleine Schiffe aller seefahrenden Nationen.
Darüber ruht eine graue Wolkenbank, die aus
den Kaminen der Hochseedampfer aufsteigt.
Im Süden verglimmen die kleinen Inselchen,
die sich wie eine geperlte Schnur gegen den
lichten Horizont abheben.
Das Leben hier am Strande ist von einer
phantastischen Buntheit. Das werkt und brodelt
und hastet ohne Unterlaß. Kulis, welche die
Dschunken laden, laufen gleich lebendigen
Paternosterwerken in schwingendem Takt über
Brettersteige, auf der einen Seite hochbeladen
hinauf, auf der anderen Seite leer herunter.
Dazwischen gellt das Gekreisch der Schiffs-
führer, ganze Ketten von Leichterbooten wer-
den mit Stangen in die Lagune hereingestoßen
und zwischendurch schieben sich die javani-
schen Hochseesampane mit ihren Reisladungen.
Einer der herrlichsten Beobachtungspunkte
ist die große neue Brücke über den River. Von
hier aus läßt sich der Hochbetrieb nach allen
Seiten wundervoll überblicken. An den Ufern
des Rivers liegen die Hausboote mit ihren ge-
wölbten Binsendächern in vielen Reihen dicht
hintereinander, überall arbeitet man. Man lädt
ein, man lädt aus, die halbnackten Kulis laufen
im Trab, bellen, und unter Gejaule und Ge-
schrei schwingen sie sich gegenseitig die
schweren Säcke zu.
Den Ufern entlang gähnen die dunklen Ein-
gänge der großen chinesischen Lagerhäuser.
Unübersehbare Güter, Kisten, Säcke und son-
stige seltsame Kolli verschwinden in diesen
verbrecherischen Gewölben, die wie unter-
irdisch gewühlte Gänge einen ganzen Stadt-
teil durchziehen und durchgehen bis nach der
entlegenen anderen Seite der Häuserblocks.
Dort endigen sie im Europäerviertel als hoch-
elegante, modern eingerichtete Großstadtläden.
Wenn irgend etwas Mühevolles geschieht,
so geschieht es immer von Chinesen, die
schaben und werken und wühlen Tag und
Nacht. Gerade hier am Hafen kann man sich
gar nicht mehr vorstellen, daß dieses Gekribbel
am Abend enden könnje und das Gewürm sich
Iwivfnlih zvm ««•Vyto'* •
„luue ton oen oonnenuniergang o*... i.->_^„iei."
Niemand von den Werkleuten hat die Arbeit
unterbrochen, sie haben ein winziges Licht
an irgendeinem unmöglichen Ort angebracht
und weiter gewerkt. Und wer kein Licht hatte,
der rückte. dem Licht des Nachbarn etwas
näher und profitierte gierig von ihm. Mein
Staunen erreichte den Höhepunkt, als ich auf
dem Heimweg tatsächlich über ein paar schla-
fende Chinesen hinwegsteigen mußte.
„Made in Germany"
Mehr als einmal bin ich in eines dieser
dunklen Gewölbe eingetreten und habe mich
so langsam auf dem klitschigen, dreckstarren-
den Boden unter Tausenden von getrockneten
Haifischflossen zwischen Teekisten und Soja-
bohnensäcken hindurchgeschoben. Dabei bin
ich in ein Gewölbe gelangt, in welchem einige
Dutzend Arbeiter und Arbeiterinnen damit be-
schäftigt waren, Aluminium- und Emailgeschirre
umzufirmieren. Der Händler hatte die Dinge
von einem englischen Importeur gekauft. Als
ich die verschiedenen Gegenstände zur Hand
nahm, fand ich an einer kaum zugänglichen
Stelle unter den Henkeln sowohl das „Made
in Germany" als auch einige sehr wohlbe-
kannte deutsche Firmen aus Amberg, Sachsen
und dem Rheinland. Bei einem Teil der Gegen-
stände hat man die kleinen Herkunftsbezeich-
nungen mittels der Feile herausgemacht und
mit einem chinesischen Wappen überklebt.
Beim Aluminiumgeschirr wurden mit einer sehr
hübsch konstruierten Maschine diese lästigen
„Muttermale" mit einem chinesischen Firmen-
zeichen überstanzt. Es war nicht das erste-
mal, daß ich die Beobachtung machte, wie sehr
deutsche Ware hier den Markt beherrscht.
Von Prof. Dr. Otto Reuther .
Die Sampane haben alle Fischgesichter mit
großen, mühevollen Fischaugen. Hinten steht
der nackte, knochige, mitunter prachtvoll athle-
tische Kerl mit seiner kaffeebraunen Haut und
den kurzen blauen Hosen am Ruder und schiebt
das Boot, weitausholend nach vorne gebeugt,
durchs Wasser. Bei jedem Ruderstoß hebt sich
der Fischkopf des Bootes mit seinem traurigen
Blick aus dem Wasser, um gleich darauf wieder
erneut einzutauchen wie ein Schwimmer, der
noch einen weiten Weg vor sich hat. Diese
Sampane haben etwas unheimlich Lebendiges
an sich. Sie ziehen durchs Wasser wie hündisch
ergebene Tiere, die — nimmermüde Genossen
ihres Herrn und Leiters —, ihr Leben lang ar-
beitend, eins geworden mit seinem Dasein. Sie
teilen getreulich ein tragisches Los mit ihm, ein
Los, das nur selten Augenblicke bescheidenen
Glückes kennt, dann, wenn das getreue Was-
sertier nachts an einem Quaderstein unter der
Brücke stilliegt und sein Herr eine winzig
kleine Pfeife raucht oder, wie ein Igel gerollt,
dem nächsten Arbeitstag entgegenschläft.
Zwischendurch ziehen die mächtigen Praus,
hochgeladen mit Säcken, sie sind fast so breit
wie lang. In der Mitte des hinteren Querteils
ruht auf einem mächtigen Balken ein einziges
Riesenruder, das Steuer und Antriebsgerät zu
gleicher Zeit ist. Oft hängen drei bis vier Leute
daran und arbeiten, daß ihnen die Rückenmus-
keln bei jeder Bewegung hochspringen. In ge-
waltigem Gleichtakt stemmen sie den Ruderbaum
hin und her, dampfend von Schweiß. Wie ein ur-
weltliches Mastodon schraubt sich die Prau
durchs Wasser. Auch sie trägt die gleiche
Fischbemalung wie die Sampane, mit zwei Rie-
senaugen beiderseits. Aber angesichts der Aus-
maße liegt der Blick viehisch stumpf und ge-
hirnlos idiotisch über dem spiegelnden Wasser.
Mir ist als könnten die Kerle ihr Riesentier
mißhandeln, massakrieren und liebkosen zu
gleicher Zeit, und es würde gar nichts davon
zur Kenntnis nehmen.
Alle hundert Meter sieht man kleine Grup-
pen tiefschwarzer Inder, hohe, magere Gestal-
ten mit langem Haupthaar, die den ganzen Tag
die Straßen reinigen und fegen und auch die
Säuberung der Kanäle und des gesamten
Systems von Abwassergräben besorgen. Sie ge-
hören der untersten Kaste Zentralindiens an.Dort
hat die englische Regierung christliche Missio-
nen angesetzt, um diese sogenannten „swee-
pers" vom Hindutum zum Christentum zu be-
kehren. Sobald sie getauft sind, werden sie in
Kolonnen zusammengestellt, auf Regierungs-
dampfern hierhergebracht, etwa auf die Dauer
eines Jahres. Sie verdienen dabei nach ihren
Begriffen recht gut, bis zu 60 Cent im Tage.
Später gehen sie, wenn sie „reiche Leute" ge-
worden sind, wieder zurück in ihre Heimat.
Die Verwendung dieser Inder am hiesigen
Ort geschieht aus rein politischen Gründen.
England spielt hier die Klassengegensätze zwi-
schen Chinesen, Malaien und Indern gegen-
einander aus. Dennoch hört man jetzt hier, daß
sich bereits von England nicht gern gesehene
Dinge anbahnen. Ein Ausdruck dieser un-
erwünschten Entwicklung sind die Freund-
schaften zwischen Malaien und Indern oder
Chinesen und Indern. Gerade hier in Singapur
hält man diese Erscheinug für politisch bedenk-
lich, weil man der Ansicht ist, daß diese jun-
gen Leute sich über die von der älteren Gene-
ration noch beachteten Rasse- und Kasten-
grenzen absolut hinwegsetzen. Diese Genera-
tion ist aber doch diejenige, welche einmal
die entscheidenden Wendungen in der Ost-
asienpolitik Englands tragen wird. (!)
Englands Kolonialpolitik
In Indien selbst ist so einem Lowcast nie-
mals auch nur die geringste Möglichkeit zu
einem Aufstieg gegeben. Es ist ausgeschlossen,
daß er, seine Kinder oder seine Kindeskinder
aus ihrem sozialen Elend herauskommen.
Nun macht England diese Leute zu Christen.
Von diesem Augenblick an scheiden sie aus
der Kaste aus und werden damit vor eng-
lischem Recht allen übrigen Farbigen gleich-
gestellt. Sie dürfen sogar in die Kirche und in
die Schule gehen wie der Tuan, der hohe
weiße Herr. Sie können handeln und wandeln
wie sie wollen; sobald sie das silberne Kreuz
auf ihrer Brust tragen, kann ihnen niemand
verbieten, daß sie durch die Straße der Brah-
minen gehen, niemand kann sie hindern, in
Geschäften einzukaufen, von welchen auch der
Brahmine seine Dinge bezieht. Daß dies den
hobprt TOc+eri nir?*»* an.'lPn^hm Lc* V^nrt man
i »xiiitöi. Auch Eugiana weiu g^lratifTOSfl
mit dem Austritt aus der Kaste sich soziale
Schwierigkeiten bedenklicher Art ergeben.
Infolgedessen gibt es dem Neubekehrten die
Gelegenheit, auswärts für eine gewisse Zeit
Arbeit zu rinden. Dabei verdienen die Leute
auch ein wenig Geld. Später kehren sie nach
Hause zurück, beginnen meist ein kleines Ge-
schäft oder ein ähnliches Unternehmen und
machen dann recht gut ihren Weg; denn wenn
ihnen etwas fehlt oder wenn sie Hilfe brau-
chen, so steht letzten Endes der Missionar
hinter ihnen, welcher die Verbindung zur Re-
gierung hat.
Anläßlich eines diesbezüglichen Erkundungs-
spaziergangs hatte ich unten im Zentrum der
Chinesenstadt, in der Rochor Road, einen erst-
klassigen Beobachtungsstand entdeckt. Da fand
ich am Rückwege ein Gebäude, das fast wie
das kleine Hotel eines Badeortes aussah. Es
trägt auch weithin sichtbar die Aufschrift
„Parc Hotel". Immerhin, dieses sogenannte
Parkhotel hat unten eine offene Halle, in
der ich mich hinter die dicken Pfeiler
setzte, um stundenlang das Volk beobachten,
photographieren, filmen und beschreiben zu
können. Dieser Platz liegt außergewöhnlich
günstig, gerade an der Ecke, an welcher sich
der ganze Verkehrsstrom bricht. Gleich dicht
dahinter befanden sich auf einer kleinen Wiese
zwei Zirkusunternehmungen, die immer eine
Menge Volk anziehen, natürlich auch Straßen-
händler in Massen. Jeden freien Winkel der
Wiese und des Pflasters haben diese Leute mit
ihren Waren belegt. Dazu kommt, daß sich in
nächster Nähe einige größere Hindukasernen
befinden, so daß diese Schwarzen in Massen
vorüberströmen. Aus der gegenüberliegenden
Rochor Road quellen in dicken Knäueln Chi-
nesen hervor mit ihren Traglasten, Kindern,
Vogelkäfigen, Früchtekörben und weiß Gott
welchem Kram, und quer an meinem Ausguck
vorbei rasen die Autos, ganze Ketten von Rik-
shas, laufen Malaien und Hindus (nur keine
Europäer). Das alles schabt und wimmelt und
kribbelt wie die Ameisen. Dieses Durcheinander
von Volk hat gar keine Haltung. Haltung und
Pose haben nur die Inder.
Da machen die Malaien einen ganz anderen
Eindruck: Kräftige, untersetzte Leute mit vor-
geschobenen Gesichtern, einem etwas brutalen,
dicken Mund, großen, weiten, weich geschwun-
genen Augen, mit denen sie wie Hühnerhunde
so sanft und treuherzig in die Welt schauen
können. Ihre Augen sehen aus, als wären sie
geschlitzt, und doch sind sie es nicht, während
mir bei dem Chinesen das geschlitzte Auge
-> 5#& Sp> '-' U <?-.-. * „-
rade bei dem Volk, das doch von Rechts
wegen geschlitzte Augen zu haben hat. Die
Malaien tragen samt und sonders kleine Samt-
kappen, so ein bißchen kühn übers Ohr ge-
stülpt. Und wenn's irgendwie geht, werden sie
Chauffeure. Andere als malaiische Chauffeure
habe ich hier noch nicht zu Gesicht bekom-
men. Seis heißt das = Kutscher Jeder möchte
ein Seis werden. Jede andere Beschäftigung
(beileibe nicht Arbeit!) ist unter ihrer Würde.
Aufgelegt sind die Burschen immer gut, und
irgendeinen Schabernack müssen sie immer
treiben.
Während ich so sitze und beobachte, ist ei
dunkel geworden. Vor mir laufen die Kulis
mit ihren schweren Traglasten im Trab, Rik-
shas gleiten vorüber, die Autos tuten und un-
zählige winzigkleine Lichterchen tauchen am
Pflaster und auf den Dächern der Häuser auf. Da
und dort kauern hungrige Esser vor den Türen,
schlürfen Reis und knabbern an Nüssen. Es be-
ginnt die Nacht, und mit ihr wiederum neue Ar-
beit, neues Gewerke und Geschacher, neues Ge-
schähe und Gekribbel, bis morgen früh die
Lämpchen verlöschen und der heiße Tag zur
Fortsetzung der Nachtarbeit ruft. Eines nur
habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt: wann
die Chinesen schlafen.
f/lßfUß Hansoplast-elastiseh ist ein idealst
lj f~ rlnu Schnellverbond. EHäßf »ich leichl
na anle8en',if2'sofor'fesl und sdlG w
^cA/H&w d'e Wund» vof Verunreinigung
Genau auf den Namen v^^.ptasf achten
■lIIIIIIIMIirilll]IMIII1IIIIMIIIflI)llIIIMIItlMMrillllllIIII1llinilIIIf1IIII1IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIt1IIIIIilllltllllllIIIIIII(IMIllIllI|lllllllIIIIIIIIItIllIIIIIII1l
trogen öieQjtZfiochprciQtmg
Seite 2 / Die Bewegung / Folge 3
Zeiten exerziert, so daß die russischen Gefan-
genen, die auf Deck dem Exerzieren zuschau-
ten, erklärten, sie begriffen jetzt, warum die
russische Flotte gegen die japanische verlieren
mußte.
Wenn man in der Geschichte Umschau hält,
so findet man, daß große Weltreiche, die durch
die mühsame Arbeit vieler Helden und großer
Männer aus kleinen Anfängen entstanden
sind, in Verfall kamen, weil das Volk den Ur-
sprung vergaß und allzu übermütig und luxu-
riös wurde. Das beste Beispiel ist das frühere
Römische Reich. Dieses Reich, das ein Cäsar,
ein Augustus fundamentiert hatten, ist nach
und nach hinabgesunken und zerfallen. In
dieser Hinsicht besteht bei den Japanern keine
Gefahr. Sie haben in ihrer dreitausendjährigen
Geschichte niemals eine Niederlage oder gar
einen Verfall und Untergang erfahren. Die
natürlichen Verhältnisse erlauben es ihnen
nicht, übermütig und ausschweifend zu leben;
sie können sich nur durch angestrengte, müh-
same Arbeit erhalten. Hart werden sie gemacht
an Geist und Körper durch die mehrmals im
Jahre wütenden Taifune und durch die in je-
dem Jahrhundert ein paarmal auftretenden ge-
waltigen Erdbeben, die zwar ihr Hab und Gut
vernichten und ihr Leben bedrohen, sie aber
andererseits zwingen, in harter Arbeit weiter-
zustreben, um das Verlorene wieder einzuholen
und eine sichere Zukunft zu schaffen. Ich habe
persönlich erlebt, wie das seit mehreren Gene-
rationen gesammelte Vermögen meiner Familie
innerhalb von dreißig Minuten vor meinen
Augen zu Asche wurde; das war bei dem
großen Erdbeben am 1. September 1923.
übermütig und arrogant haben sich dagegen
amerikanische führende Persönlichkeiten bis
kurz vor Kriegsausbruch über Japan ausgelas-
sen. Sie haben geäußert, daß die amerikanische
Wirtschaftskraft, Rüstung und Vorbereitung Ja-
pan unvergleichlich überlegen sei, daß die ame-
rikanische Wehrmacht daher möglichst schnell
gegen Japan vorgehen und Japan vernichten
oder zur Unterwerfung zwingen werde, daß
Amerika in dreißig bis neunzig Tagen mit dem
lächerlichen japanischen Reich fertig sein, daß
die amerikanische Flotte in wenigen Wochen
die schwache japanische Flotte vernichten
werde, und so weiter. Japans Sieg in der
Schlacht von Hawai, wo die amerikanische Pa-
zifikflotte praktisch vernichtet wurde, ist teil-
weise eine Folge der auf Übermut und Arroganz
beruhenden Vernachlässigung der Vorbereitun-
gen bei den Amerikanern. Hier kann man wohl
sagen, daß die Amerikaner vergessen hatten,
den Helm fester zu binden, bevor sie noch über
die Japaner gesiegt hatten.
Die Japaner und Deutschen müssen, ebenso
wie die anderen tapferen Verbündeten, noch
manchen schweren Kampf bestehen, bis sie den
Endsieg gewonnen und die ersehnte Neu-
ordnung der Welt hergestellt haben. Da-
zu gehört, daß sie nicht nur den Körper,
sondern auch Geist und Seele trai-
nieren und härten, um auch Not
und.Entbehrung mit Gleichmut
zu überwinden und jederzeit die
richtigen Entscheidungen treffen
zu können.
Hauptschriftleiter: Dr. Heinz W o 1 f f. Stellvertreter: Dr.
Carl Fink (z. Zt. im Felde). Anschrift der Hauptschrift-
leitung: München, Schellingstraße 39, Fernruf: 2 UH (II Für
den Anzeigenteil verantwortlich Gg. Kienle. Verlag: Franz
Eher Nachfolger G. m b. H. — Druck: Buchgewerbehans
M. Müller & Sohn. Sämtliche In München. — Anzeigen-
preise laut aufliegender Preisliste Nr. 10. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte und Bilder übernimmt die Schrifl-
leitung keine Verantwortung. Rücksendung erfolgt nur,
wenn Rückporto beiliegt Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet, — Gewünschte Einzelnummern sind nur
gegen vorherige Einsendung von 20 Pfennig lieferbar.
Redaktionsschluß für letzte Meldungen Montag abend.
man den Sieg erringen.
Dieser Grundsatz gilt nicht nur für die Rit-
terkämpfe, sondern auch für das Leben der In-
dividuen im allgemeinen, sowie für Volk und
Staat selbst. Bei der ersten Schlacht zu Schang-
hai im Jahre 1932 zeigten drei japanische
Soldaten (Pioniere) einen ganz besonderen Mut
und Tapferkeit als Menschenbombefi. Um eine
sehr wichtige chinesische Stellung zu beset-
zen, war es erforderlich, an einer Stelle den
Befestigungsgürtel durch Sprengung zu durch-
brechen, um einen Anmarschweg für die Sturm-
truppen zu schaffen. Man hatte dazu den
Hohlraum einer langen Bambusstange mit ge-
streckter, hochexplosiver Sprengladung gefüllt
und drei todesmutige Männer ausgewählt, die
diese Bambusstange bis vor die befohlene
Stelle tragen und auf das Befestigungswerk
werfen, sodann sich schleunigst zurückziehen
sollten. Befehlsgemäß näherten sich die drei
Soldaten jener Stelle; dort bemerkten sie
jedoch, daß die Bambusstange durch einen
einfachen Wurf nicht die gewünschte Wirkung
haben konnte; so warfen sie die Stange nicht
ab, sondern sprangen mit der entsicherten La-
dung auf die zu sprengende Stelle, indem sie
riefen: ,,Es lebe Seine Majestät der Tennö!"
Die Bombe zerriß die drei Soldaten. Aber
durch das Opfer, das sie in vollem Bewußtsein
mit ihrem Leben brachten, war die so nötige
Anmarschstraße geschaffen, und die starke
chinesische Stellung wurde gleich hinterher
genommen. In Tokio ist diesen drei tapferen
Männern ein Denkmal errichtet worden, und
das Volk pilgert ununterbrochen dorthin, um
der drei Helden in Ehrfurcht zu gedenken.
Heldische Todesverachtung
Auch der Angriff der japanischen Marine-
flieger und besonderen Unterseeboote auf die
amerikanische Flotte im Kriegshafen Pearl Har-
bour auf Hawai war eine todesmutige Helden-
tat der Selbstopferung, durch die der größte
Teil der pazifischen "Flotte der USA. vernichtet
wurde. Japan konnte dadurch die unbestrittene
Seeherrschaft auf dem Pazifik erwerben, und so
Ist der Angriff Roosevelts auf Japan von vorn-
herein gelähmt worden.
Die Sicherheit des japanischen Volkes und
Staates könnte ohne derartigen Heldenmut sei-
ner Söhne nicht erreicht werden.
Ein weiterer japanischer goldener Spruch
lautet: „Kitarazaru-wo tanomazu, matsuaru-wo
tanomu!"
Auf deutsch etwa: „Rechnet nicht darauf, daß
der Feind nicht kommt; rechnet nur darauf, daß
ihr gut vorbereitet seidl" Diesem entspricht die
Wendung: „In Bereitschaft sein ist allesl" Das
ist ein berühmter Grundsatz der japanischen
Kriegsmarine. Jedem Marineoffizier ist einge-
prägt worden, daß man nicht nach der Stärke
dieses oder jenes Feindes fragen dürfe, sondern
unablässig bemüht sein müsse, die eigene Ma-
rine auf das allerhöchste Maß der Leistungs-
fähigkeit zu bringen und zu erhalten, um so je-
derzeit gegen jede Eventualität gesichert zu
sein.
' 's der Kr"->d im P»~!".k ausbrach, rühmten
^ i.i -fm—, n^xiyjv* ..^ rf.litL»esLons zwei
Monate lang halten zu können") ihre Erwartun-
gen wurden aber schwer enttäuscht, denn schon.
17 Tage nach Kriegsausbruch fiel ganz Hong-
kong fest in japanische Hand. Um diesen Rie-
senerfolg zu verstehen, muß man wissen, daß
die Japaner schon vor längerer Zeit die ent-
sprechenden Vorbereitungen für einen even-
tuellen Krieg mit England getroffen hatten, in-
dem sie für den Sturm auf Hongkong extra
Truppen ausbildeten unter Berücksichtigung
der Besonderheiten dieser Aufgaben. Um
steile Höhen erklettern zu können, hatten sie
bei Tag und Nacht mit Strickleitern geübt. Zur
Durchquerung von Minenfeldern wurden so-
genannte Schwimmertruppen gebildet, die ihre
letzte Ausbildung von bekannten Rekord-
schwimmern erhielten, an deren Spitze der be-
rühmte Olympiasieger Koike stand.
Und nun noch einen anderen japanischen
goldenen Spruch. Er heißt: „Katte Kabuto no
Wo wo shimeyo!"
Das heißt auf deutsch: „Nach dem Sieg bin-
det den Helm fester!" Als vor 2600 Jahren
Jiminu Tennö, der erste Kaiser von Japan,
einen den starken Feind vernichtenden Sieg
errungen hatte, jubelten die Soldaten seiner
Garde vor Freude zu viel.' Jimmu Tennö wies
sie zurecht mit den Worten: „Tatakai ni
kachite ogoru-koto nakiwa Yoki-Ikusanokimi
no Waza naril"
Gestählte Lebenshaltung
Auf deutsch übersetzt: „Daß man in einer
Schlacht siegt und nicht hochmütig wird, ist
die Sache eines guten Heerführers!" Oder man
kann auch den Sinn wiedergeben, indem man
ungefähr übersetzt: Gute Soldaten werden nicht
hochmütig, auch nach dem Sieg!
Dieses Wort des Jimmu Tenno ist die Quelle,
aus der nach vielen Jahren der berühmte
Spruch: „Nach dem Siege bindet den Helm
fester!" geflossen ist. Viele japanische Feld-
herren haben seit alten Zeiten von diesem
Spruch Gebrauch gemacht. Als nach dem sieg-
reichen Ende des japanisch-russischen Krieges
die vereinigten Flotten des Admirals Togo
wieder auf den Friedensstand gebracht wurden,
richtete dieser Admiral einen sehr berühmten
Tagesbefehl an die Flotte. Er schloß diesen
Tagesbefehl mit den Worten: „Nach dem Siege
bindet den Helm fester!" Seitdem ist diese
Wendung besonders tief der ganzen japani-
schen Wehrmacht und dem Volk in das Be-
wußtsein gedrungen. Admiral Togo hat selbst
stets nach diesem Spruch gehandelt. Auch nach
der Seeschlacht von Tsushima, als die Kriegs-
schiffe des siegreichen Admirals auf der Heim-
fahrt waren, wurde wie sonst in normalen
WELTHAFEN SINGAPUR
Professor Dr. Reuther, der einige Jahre vor
Ausbruch des Krieges eine Studienreise durch
den Fernen Osten unternahm, schildert uns
hier seine Eindrücke von dem Leben und Trei-
ben im Welthafen Singapur.
Der Hafen von Singapur ist wohl eines der
interessantesten Dinge, die es in der Welt gibt.
In einem riesenhaft ausgreifenden Bogen
schwingt sich die Bucht nach Nordosten, daß
die Ufer staubig-grün im fernen Dunst ver-
schlimmern.
Soweit das Auge zu blicken vermag, liegen
Schiffe, Tausende und aber Tausende von
Dschunken, Sampanen und, mehr nach Süden
zu, auf der Dampferreede, qualmen große und
kleine Schiffe aller seefahrenden Nationen.
Darüber ruht eine graue Wolkenbank, die aus
den Kaminen der Hochseedampfer aufsteigt.
Im Süden verglimmen die kleinen Inselchen,
die sich wie eine geperlte Schnur gegen den
lichten Horizont abheben.
Das Leben hier am Strande ist von einer
phantastischen Buntheit. Das werkt und brodelt
und hastet ohne Unterlaß. Kulis, welche die
Dschunken laden, laufen gleich lebendigen
Paternosterwerken in schwingendem Takt über
Brettersteige, auf der einen Seite hochbeladen
hinauf, auf der anderen Seite leer herunter.
Dazwischen gellt das Gekreisch der Schiffs-
führer, ganze Ketten von Leichterbooten wer-
den mit Stangen in die Lagune hereingestoßen
und zwischendurch schieben sich die javani-
schen Hochseesampane mit ihren Reisladungen.
Einer der herrlichsten Beobachtungspunkte
ist die große neue Brücke über den River. Von
hier aus läßt sich der Hochbetrieb nach allen
Seiten wundervoll überblicken. An den Ufern
des Rivers liegen die Hausboote mit ihren ge-
wölbten Binsendächern in vielen Reihen dicht
hintereinander, überall arbeitet man. Man lädt
ein, man lädt aus, die halbnackten Kulis laufen
im Trab, bellen, und unter Gejaule und Ge-
schrei schwingen sie sich gegenseitig die
schweren Säcke zu.
Den Ufern entlang gähnen die dunklen Ein-
gänge der großen chinesischen Lagerhäuser.
Unübersehbare Güter, Kisten, Säcke und son-
stige seltsame Kolli verschwinden in diesen
verbrecherischen Gewölben, die wie unter-
irdisch gewühlte Gänge einen ganzen Stadt-
teil durchziehen und durchgehen bis nach der
entlegenen anderen Seite der Häuserblocks.
Dort endigen sie im Europäerviertel als hoch-
elegante, modern eingerichtete Großstadtläden.
Wenn irgend etwas Mühevolles geschieht,
so geschieht es immer von Chinesen, die
schaben und werken und wühlen Tag und
Nacht. Gerade hier am Hafen kann man sich
gar nicht mehr vorstellen, daß dieses Gekribbel
am Abend enden könnje und das Gewürm sich
Iwivfnlih zvm ««•Vyto'* •
„luue ton oen oonnenuniergang o*... i.->_^„iei."
Niemand von den Werkleuten hat die Arbeit
unterbrochen, sie haben ein winziges Licht
an irgendeinem unmöglichen Ort angebracht
und weiter gewerkt. Und wer kein Licht hatte,
der rückte. dem Licht des Nachbarn etwas
näher und profitierte gierig von ihm. Mein
Staunen erreichte den Höhepunkt, als ich auf
dem Heimweg tatsächlich über ein paar schla-
fende Chinesen hinwegsteigen mußte.
„Made in Germany"
Mehr als einmal bin ich in eines dieser
dunklen Gewölbe eingetreten und habe mich
so langsam auf dem klitschigen, dreckstarren-
den Boden unter Tausenden von getrockneten
Haifischflossen zwischen Teekisten und Soja-
bohnensäcken hindurchgeschoben. Dabei bin
ich in ein Gewölbe gelangt, in welchem einige
Dutzend Arbeiter und Arbeiterinnen damit be-
schäftigt waren, Aluminium- und Emailgeschirre
umzufirmieren. Der Händler hatte die Dinge
von einem englischen Importeur gekauft. Als
ich die verschiedenen Gegenstände zur Hand
nahm, fand ich an einer kaum zugänglichen
Stelle unter den Henkeln sowohl das „Made
in Germany" als auch einige sehr wohlbe-
kannte deutsche Firmen aus Amberg, Sachsen
und dem Rheinland. Bei einem Teil der Gegen-
stände hat man die kleinen Herkunftsbezeich-
nungen mittels der Feile herausgemacht und
mit einem chinesischen Wappen überklebt.
Beim Aluminiumgeschirr wurden mit einer sehr
hübsch konstruierten Maschine diese lästigen
„Muttermale" mit einem chinesischen Firmen-
zeichen überstanzt. Es war nicht das erste-
mal, daß ich die Beobachtung machte, wie sehr
deutsche Ware hier den Markt beherrscht.
Von Prof. Dr. Otto Reuther .
Die Sampane haben alle Fischgesichter mit
großen, mühevollen Fischaugen. Hinten steht
der nackte, knochige, mitunter prachtvoll athle-
tische Kerl mit seiner kaffeebraunen Haut und
den kurzen blauen Hosen am Ruder und schiebt
das Boot, weitausholend nach vorne gebeugt,
durchs Wasser. Bei jedem Ruderstoß hebt sich
der Fischkopf des Bootes mit seinem traurigen
Blick aus dem Wasser, um gleich darauf wieder
erneut einzutauchen wie ein Schwimmer, der
noch einen weiten Weg vor sich hat. Diese
Sampane haben etwas unheimlich Lebendiges
an sich. Sie ziehen durchs Wasser wie hündisch
ergebene Tiere, die — nimmermüde Genossen
ihres Herrn und Leiters —, ihr Leben lang ar-
beitend, eins geworden mit seinem Dasein. Sie
teilen getreulich ein tragisches Los mit ihm, ein
Los, das nur selten Augenblicke bescheidenen
Glückes kennt, dann, wenn das getreue Was-
sertier nachts an einem Quaderstein unter der
Brücke stilliegt und sein Herr eine winzig
kleine Pfeife raucht oder, wie ein Igel gerollt,
dem nächsten Arbeitstag entgegenschläft.
Zwischendurch ziehen die mächtigen Praus,
hochgeladen mit Säcken, sie sind fast so breit
wie lang. In der Mitte des hinteren Querteils
ruht auf einem mächtigen Balken ein einziges
Riesenruder, das Steuer und Antriebsgerät zu
gleicher Zeit ist. Oft hängen drei bis vier Leute
daran und arbeiten, daß ihnen die Rückenmus-
keln bei jeder Bewegung hochspringen. In ge-
waltigem Gleichtakt stemmen sie den Ruderbaum
hin und her, dampfend von Schweiß. Wie ein ur-
weltliches Mastodon schraubt sich die Prau
durchs Wasser. Auch sie trägt die gleiche
Fischbemalung wie die Sampane, mit zwei Rie-
senaugen beiderseits. Aber angesichts der Aus-
maße liegt der Blick viehisch stumpf und ge-
hirnlos idiotisch über dem spiegelnden Wasser.
Mir ist als könnten die Kerle ihr Riesentier
mißhandeln, massakrieren und liebkosen zu
gleicher Zeit, und es würde gar nichts davon
zur Kenntnis nehmen.
Alle hundert Meter sieht man kleine Grup-
pen tiefschwarzer Inder, hohe, magere Gestal-
ten mit langem Haupthaar, die den ganzen Tag
die Straßen reinigen und fegen und auch die
Säuberung der Kanäle und des gesamten
Systems von Abwassergräben besorgen. Sie ge-
hören der untersten Kaste Zentralindiens an.Dort
hat die englische Regierung christliche Missio-
nen angesetzt, um diese sogenannten „swee-
pers" vom Hindutum zum Christentum zu be-
kehren. Sobald sie getauft sind, werden sie in
Kolonnen zusammengestellt, auf Regierungs-
dampfern hierhergebracht, etwa auf die Dauer
eines Jahres. Sie verdienen dabei nach ihren
Begriffen recht gut, bis zu 60 Cent im Tage.
Später gehen sie, wenn sie „reiche Leute" ge-
worden sind, wieder zurück in ihre Heimat.
Die Verwendung dieser Inder am hiesigen
Ort geschieht aus rein politischen Gründen.
England spielt hier die Klassengegensätze zwi-
schen Chinesen, Malaien und Indern gegen-
einander aus. Dennoch hört man jetzt hier, daß
sich bereits von England nicht gern gesehene
Dinge anbahnen. Ein Ausdruck dieser un-
erwünschten Entwicklung sind die Freund-
schaften zwischen Malaien und Indern oder
Chinesen und Indern. Gerade hier in Singapur
hält man diese Erscheinug für politisch bedenk-
lich, weil man der Ansicht ist, daß diese jun-
gen Leute sich über die von der älteren Gene-
ration noch beachteten Rasse- und Kasten-
grenzen absolut hinwegsetzen. Diese Genera-
tion ist aber doch diejenige, welche einmal
die entscheidenden Wendungen in der Ost-
asienpolitik Englands tragen wird. (!)
Englands Kolonialpolitik
In Indien selbst ist so einem Lowcast nie-
mals auch nur die geringste Möglichkeit zu
einem Aufstieg gegeben. Es ist ausgeschlossen,
daß er, seine Kinder oder seine Kindeskinder
aus ihrem sozialen Elend herauskommen.
Nun macht England diese Leute zu Christen.
Von diesem Augenblick an scheiden sie aus
der Kaste aus und werden damit vor eng-
lischem Recht allen übrigen Farbigen gleich-
gestellt. Sie dürfen sogar in die Kirche und in
die Schule gehen wie der Tuan, der hohe
weiße Herr. Sie können handeln und wandeln
wie sie wollen; sobald sie das silberne Kreuz
auf ihrer Brust tragen, kann ihnen niemand
verbieten, daß sie durch die Straße der Brah-
minen gehen, niemand kann sie hindern, in
Geschäften einzukaufen, von welchen auch der
Brahmine seine Dinge bezieht. Daß dies den
hobprt TOc+eri nir?*»* an.'lPn^hm Lc* V^nrt man
i »xiiitöi. Auch Eugiana weiu g^lratifTOSfl
mit dem Austritt aus der Kaste sich soziale
Schwierigkeiten bedenklicher Art ergeben.
Infolgedessen gibt es dem Neubekehrten die
Gelegenheit, auswärts für eine gewisse Zeit
Arbeit zu rinden. Dabei verdienen die Leute
auch ein wenig Geld. Später kehren sie nach
Hause zurück, beginnen meist ein kleines Ge-
schäft oder ein ähnliches Unternehmen und
machen dann recht gut ihren Weg; denn wenn
ihnen etwas fehlt oder wenn sie Hilfe brau-
chen, so steht letzten Endes der Missionar
hinter ihnen, welcher die Verbindung zur Re-
gierung hat.
Anläßlich eines diesbezüglichen Erkundungs-
spaziergangs hatte ich unten im Zentrum der
Chinesenstadt, in der Rochor Road, einen erst-
klassigen Beobachtungsstand entdeckt. Da fand
ich am Rückwege ein Gebäude, das fast wie
das kleine Hotel eines Badeortes aussah. Es
trägt auch weithin sichtbar die Aufschrift
„Parc Hotel". Immerhin, dieses sogenannte
Parkhotel hat unten eine offene Halle, in
der ich mich hinter die dicken Pfeiler
setzte, um stundenlang das Volk beobachten,
photographieren, filmen und beschreiben zu
können. Dieser Platz liegt außergewöhnlich
günstig, gerade an der Ecke, an welcher sich
der ganze Verkehrsstrom bricht. Gleich dicht
dahinter befanden sich auf einer kleinen Wiese
zwei Zirkusunternehmungen, die immer eine
Menge Volk anziehen, natürlich auch Straßen-
händler in Massen. Jeden freien Winkel der
Wiese und des Pflasters haben diese Leute mit
ihren Waren belegt. Dazu kommt, daß sich in
nächster Nähe einige größere Hindukasernen
befinden, so daß diese Schwarzen in Massen
vorüberströmen. Aus der gegenüberliegenden
Rochor Road quellen in dicken Knäueln Chi-
nesen hervor mit ihren Traglasten, Kindern,
Vogelkäfigen, Früchtekörben und weiß Gott
welchem Kram, und quer an meinem Ausguck
vorbei rasen die Autos, ganze Ketten von Rik-
shas, laufen Malaien und Hindus (nur keine
Europäer). Das alles schabt und wimmelt und
kribbelt wie die Ameisen. Dieses Durcheinander
von Volk hat gar keine Haltung. Haltung und
Pose haben nur die Inder.
Da machen die Malaien einen ganz anderen
Eindruck: Kräftige, untersetzte Leute mit vor-
geschobenen Gesichtern, einem etwas brutalen,
dicken Mund, großen, weiten, weich geschwun-
genen Augen, mit denen sie wie Hühnerhunde
so sanft und treuherzig in die Welt schauen
können. Ihre Augen sehen aus, als wären sie
geschlitzt, und doch sind sie es nicht, während
mir bei dem Chinesen das geschlitzte Auge
-> 5#& Sp> '-' U <?-.-. * „-
rade bei dem Volk, das doch von Rechts
wegen geschlitzte Augen zu haben hat. Die
Malaien tragen samt und sonders kleine Samt-
kappen, so ein bißchen kühn übers Ohr ge-
stülpt. Und wenn's irgendwie geht, werden sie
Chauffeure. Andere als malaiische Chauffeure
habe ich hier noch nicht zu Gesicht bekom-
men. Seis heißt das = Kutscher Jeder möchte
ein Seis werden. Jede andere Beschäftigung
(beileibe nicht Arbeit!) ist unter ihrer Würde.
Aufgelegt sind die Burschen immer gut, und
irgendeinen Schabernack müssen sie immer
treiben.
Während ich so sitze und beobachte, ist ei
dunkel geworden. Vor mir laufen die Kulis
mit ihren schweren Traglasten im Trab, Rik-
shas gleiten vorüber, die Autos tuten und un-
zählige winzigkleine Lichterchen tauchen am
Pflaster und auf den Dächern der Häuser auf. Da
und dort kauern hungrige Esser vor den Türen,
schlürfen Reis und knabbern an Nüssen. Es be-
ginnt die Nacht, und mit ihr wiederum neue Ar-
beit, neues Gewerke und Geschacher, neues Ge-
schähe und Gekribbel, bis morgen früh die
Lämpchen verlöschen und der heiße Tag zur
Fortsetzung der Nachtarbeit ruft. Eines nur
habe ich bis jetzt noch nicht entdeckt: wann
die Chinesen schlafen.
f/lßfUß Hansoplast-elastiseh ist ein idealst
lj f~ rlnu Schnellverbond. EHäßf »ich leichl
na anle8en',if2'sofor'fesl und sdlG w
^cA/H&w d'e Wund» vof Verunreinigung
Genau auf den Namen v^^.ptasf achten
■lIIIIIIIMIirilll]IMIII1IIIIMIIIflI)llIIIMIItlMMrillllllIIII1llinilIIIf1IIII1IIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIt1IIIIIilllltllllllIIIIIII(IMIllIllI|lllllllIIIIIIIIItIllIIIIIII1l
trogen öieQjtZfiochprciQtmg
Seite 2 / Die Bewegung / Folge 3
Zeiten exerziert, so daß die russischen Gefan-
genen, die auf Deck dem Exerzieren zuschau-
ten, erklärten, sie begriffen jetzt, warum die
russische Flotte gegen die japanische verlieren
mußte.
Wenn man in der Geschichte Umschau hält,
so findet man, daß große Weltreiche, die durch
die mühsame Arbeit vieler Helden und großer
Männer aus kleinen Anfängen entstanden
sind, in Verfall kamen, weil das Volk den Ur-
sprung vergaß und allzu übermütig und luxu-
riös wurde. Das beste Beispiel ist das frühere
Römische Reich. Dieses Reich, das ein Cäsar,
ein Augustus fundamentiert hatten, ist nach
und nach hinabgesunken und zerfallen. In
dieser Hinsicht besteht bei den Japanern keine
Gefahr. Sie haben in ihrer dreitausendjährigen
Geschichte niemals eine Niederlage oder gar
einen Verfall und Untergang erfahren. Die
natürlichen Verhältnisse erlauben es ihnen
nicht, übermütig und ausschweifend zu leben;
sie können sich nur durch angestrengte, müh-
same Arbeit erhalten. Hart werden sie gemacht
an Geist und Körper durch die mehrmals im
Jahre wütenden Taifune und durch die in je-
dem Jahrhundert ein paarmal auftretenden ge-
waltigen Erdbeben, die zwar ihr Hab und Gut
vernichten und ihr Leben bedrohen, sie aber
andererseits zwingen, in harter Arbeit weiter-
zustreben, um das Verlorene wieder einzuholen
und eine sichere Zukunft zu schaffen. Ich habe
persönlich erlebt, wie das seit mehreren Gene-
rationen gesammelte Vermögen meiner Familie
innerhalb von dreißig Minuten vor meinen
Augen zu Asche wurde; das war bei dem
großen Erdbeben am 1. September 1923.
übermütig und arrogant haben sich dagegen
amerikanische führende Persönlichkeiten bis
kurz vor Kriegsausbruch über Japan ausgelas-
sen. Sie haben geäußert, daß die amerikanische
Wirtschaftskraft, Rüstung und Vorbereitung Ja-
pan unvergleichlich überlegen sei, daß die ame-
rikanische Wehrmacht daher möglichst schnell
gegen Japan vorgehen und Japan vernichten
oder zur Unterwerfung zwingen werde, daß
Amerika in dreißig bis neunzig Tagen mit dem
lächerlichen japanischen Reich fertig sein, daß
die amerikanische Flotte in wenigen Wochen
die schwache japanische Flotte vernichten
werde, und so weiter. Japans Sieg in der
Schlacht von Hawai, wo die amerikanische Pa-
zifikflotte praktisch vernichtet wurde, ist teil-
weise eine Folge der auf Übermut und Arroganz
beruhenden Vernachlässigung der Vorbereitun-
gen bei den Amerikanern. Hier kann man wohl
sagen, daß die Amerikaner vergessen hatten,
den Helm fester zu binden, bevor sie noch über
die Japaner gesiegt hatten.
Die Japaner und Deutschen müssen, ebenso
wie die anderen tapferen Verbündeten, noch
manchen schweren Kampf bestehen, bis sie den
Endsieg gewonnen und die ersehnte Neu-
ordnung der Welt hergestellt haben. Da-
zu gehört, daß sie nicht nur den Körper,
sondern auch Geist und Seele trai-
nieren und härten, um auch Not
und.Entbehrung mit Gleichmut
zu überwinden und jederzeit die
richtigen Entscheidungen treffen
zu können.
Hauptschriftleiter: Dr. Heinz W o 1 f f. Stellvertreter: Dr.
Carl Fink (z. Zt. im Felde). Anschrift der Hauptschrift-
leitung: München, Schellingstraße 39, Fernruf: 2 UH (II Für
den Anzeigenteil verantwortlich Gg. Kienle. Verlag: Franz
Eher Nachfolger G. m b. H. — Druck: Buchgewerbehans
M. Müller & Sohn. Sämtliche In München. — Anzeigen-
preise laut aufliegender Preisliste Nr. 10. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte und Bilder übernimmt die Schrifl-
leitung keine Verantwortung. Rücksendung erfolgt nur,
wenn Rückporto beiliegt Nachdruck nur mit Quellen-
angabe gestattet, — Gewünschte Einzelnummern sind nur
gegen vorherige Einsendung von 20 Pfennig lieferbar.
Redaktionsschluß für letzte Meldungen Montag abend.