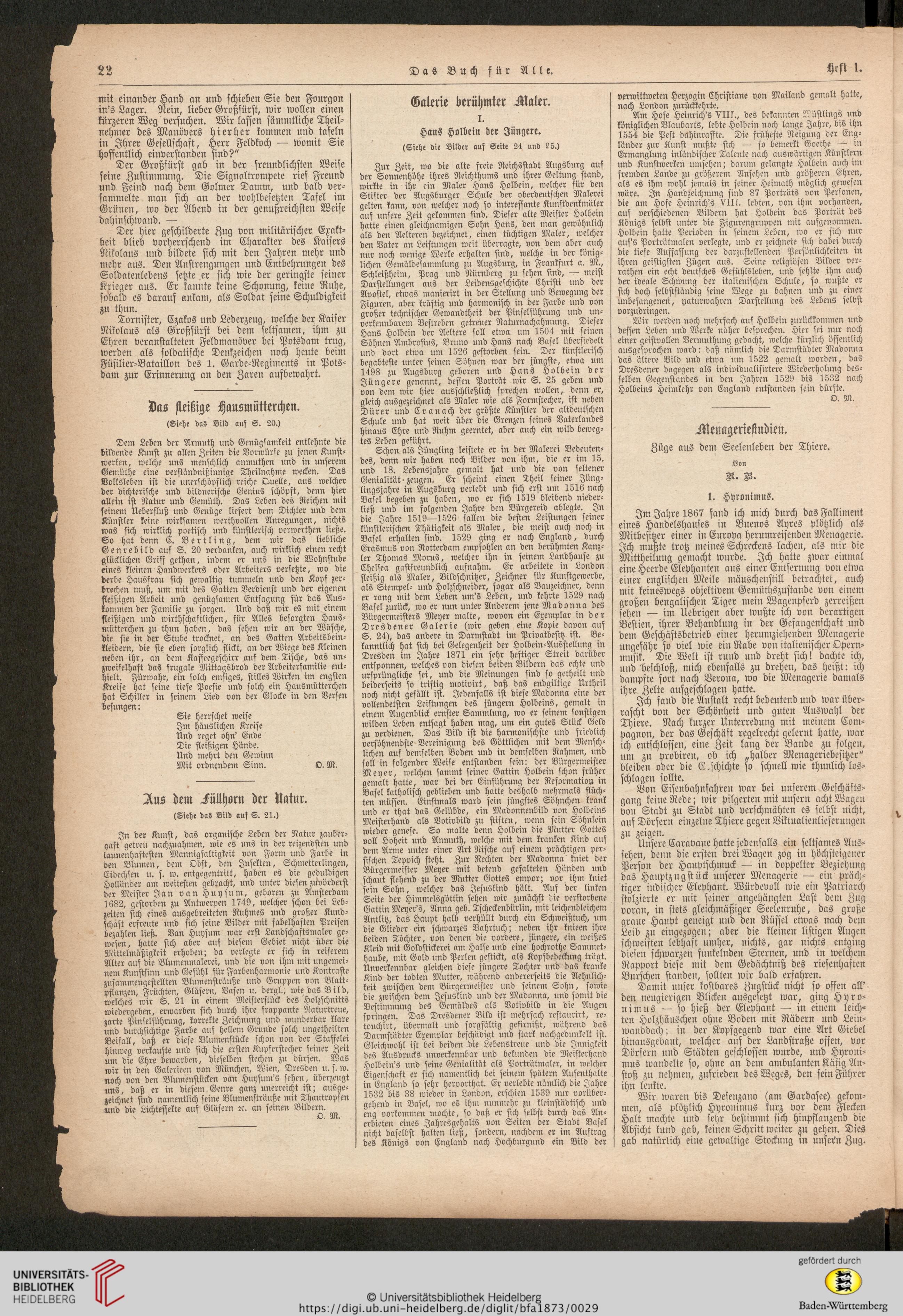22
Das Buch für Alle
Heft 1.
mit einander Hand an und fohieben Sie den FIourgon
in’8 Lager. Nein, lieber Großfürft, wir wollen einen
kürzeren Weg verſuchen. Wir lafjen ſämmtliche Theil⸗
nehmer des Manbvers hierher kommen und tafeln
in Ihrer Geſellſchaft, Herr Feldkoch — womit Sie
hoffentlich einverſtanden ſind?“
Der Großfürſt gab in der freundlichſten Weiſe
ſeine Zuſtimmung. Die Signaltrompete rief Freund
und Feind nach dem Golmer Damm, und bald ver-
ſammelte man ſich an der wohlbeſetzten Tafel im
Grünen, wo der Abend in der genußreichſten Weiſe
dahinſchwand. —
Der hier geſchilderte Zug von militäriſcher Exgkt—
heit blieb vorherrſchend im Charakter des Kaiſers
Nikolaus und bildete ſich mit den Jahren mehr und
mehr aus. Den Anſtrengungen und Entbehrungen des
Soldatenlebens ſetzte er ſich wie der geringſte ſeiner
Krieger aus. Ex kannte keine Schonung, keine Ruhe,
ſobald es darauf ankam, als Soldat ſeine Schuldigkeit
zu thun.
Torniſter, Czakos und Lederzeug, welche der Kaiſer
Nikolaus als Großfürſt bei dem ſeltſamen, ihm zu
Ehren veranſtalteten Feldmanöver bei Potsdam trug,
werden als ſoldatiſche Denkzeichen noch heute beim
Füſilier⸗Bataillon des 1. Garde-Regiments in Pots⸗
dam zur Erinnerung an den Zaren aufbewahrt.
Das Aleißige Hausmütterchen.
(Siehe das Bild auf S. 20.)
Dem Leben der Armuth und SGenügfamfeit entlehnte die
Bildende Kunft zu allen Zeiten die Vorwürfe zu jenen Kunft-
werfen, welche ung menſchlich anmuthen und in unſerem
Gemüthe eine verſtändnißinnige Theilnahme wecken. Das
Volksleben iſt die unerſchöpflich reiche Quelle, aus welcher
der dichteriſche und bildneriſche Genius ſchöpft, denn hier
allein iſt Natur und Gemüth. Das Leben des Reichen mit
ſeinem Ueberfluß und Genüge liefert dem Dichter und dem
Künſtler keine wirkſamen werthvollen Anregungen, nichts
was ſich wirklich poetiſch und künſtleriſch verwerthen ließe.
So hat denn EC. Bertling, dem wir das liebliche
SGenrebild auf S, 20 verdanken, au wirklich einen recht
glücklichen Griff gethan, indem er uns in die Wohnfiube
eines kleinen Handwerkers oder Arbeiters verſetzte, wo die
derbe Hausfrau ſich gewaltig tummeln und den Kopf zer—
brechen muß, um mit des Gatten Verdienſt und der eigenen
fleißigen Arbeit und genügſamen Entſagung für das Ausz
kommen der Familie zu ſorgen. Und daß wir es mit einem
fleißigen und wirthſchaftlichen, für Alles beſorgten Haus:
mütterhen zu thun haben, das ſehen wir an der Wäſche,
die fie in der Stube trodnet, an des Gatten Arbeitsbein-
Heidern, die fie eben forglich flidt, an der Wiege des Kleinen
neben ihr, an dem Kaffeegefchirr auf dem. Tijdhe, das un
zweifelhaft daS frugale Mittagsbrod der Arbeiterfamilie ent:
hielt. Fürwahr, ein ſolch emſiges, ſtilles Wirken im engſten
Kreiſe hat feine tiefe Poeſie und foldh ein Hausmütterchen
Hat Schiller in feinem Lied von der Ölode in den Verjen
beſungen:
Sie herrſchet weiſe
Im häuslichen Kreiſe
Und reget ohn' Ende
Die fleißigen Hände.
Und mehrt den Gewinn
Mit ordnendem Sinn. O. M.
Aus dem Füllhorn der Uatur.
(Siehe das Bild auf S. 21.)
In der Kunſt, das organiſche Leben der Natur zauber—
gaft getreu nachzuahmen, wie es uns in der reizendſten und
launenhafteſten Mannigfaltigkeit von Form und Farbe in
den Blumen, dem Obſt, den Inſekten, Schmetterlingen,
Eidechſen u. ſ. w. entgegentritt, haben es die geduldigen
Hollander am weiteſten gebracht, und unter dieſen zuvörderſt
der Meiſter Jan van Huyſum, geboren zu Amſterdam
1682, geſtorben zu Antwerpen 1749, welcher ſchon bei Leb⸗
zeiten ſich eines ausgebreiteten Ruhmes und großer Kund⸗
ſchaft erfreute und ſich feine Bilder mit fabelhaften Preiſen
bezahlen ließ. Van Huyſum war erſt Landſchaftsmaler ge⸗
wejen, Hatte fich aber auf diefem Gebiet nicht über die
Mittehnäßigkeit erhoben; da verlegte er ſich in reiferem
Alter auf die Blumenmalerei, und die von ihm mit ungemei:
nem Kunftfinn und Gefühl für Farbenharmonie und Kontrafte
zuſammengeſtellten Blunienſträuße und Sruppen von Blatt-
pflanzen, Früchten, Gläſern, Vaſen u. dergl., wie das Bild,
welches wir S. 21 in einem Meiſterſtück des Holzſchnitts
wiedergeben, erwarben ſich durch ihre frappante Naturtreue,
zarte Pinſelführung, korrekte Zeichnung und wunderbar klare
und duͤrchſichtige Farbe auf hellem Grunde ſolch ungetheilten
Beifall, daß er dieſe Blumenſtücke ſchon von der Staffelei
hinweg verkaufte und fich die erften Kupferftecher feiner Zeit
uͤm die Ehre bewarben, dieſelben ſtechen zu dürfen. Was
wir in den Galerieen von München, Wien, Dresden u. ſ. w.
noch von den Blumenſtücken van Huyſum's ſehen, überzeugt
uns, daß er in diefem, Genre ganz unerreicht iſt; ausge—
geichnet find namentlich feine Blumenſträuße mit Thautropfen
aınd die Lichteffekte auf Gläfern 20. an feinen Bildern. nn
N O. M.
*
Galerie berühmker Maler.
J.
Hans Holbein der Jüngere.
(Siehe die Bilder auf Seite 24 und 25.)
Bur Beit, wo die alte freie NeihSftadt Augsburg auf
der Sonnenhöhe ihres RNeichthumS und ihrer Geltung fand,
wirkte in ihr ein Maler Han8 Holbein, welcher für den
Stifter. der Augsburger Schule der oberdeutfhen Malerei
gelten kann, von welcher noch ſo intereſſante Kunſtdenkmäler
auf unjere Zeit gefommen find. Diefer alte Meiſter Holbein
Hatte einen gleidnamigen Sohn Hans, den man gewöhnlich
al8 den Melteren bezeichnet, einen tlıchtigen Maler, welcher
den Vater an Leiftungen weit überragte, von dem aber auch
nur noch wenige Werke erhalten find, welde in der König-
lichen Gemäldejammlung zu Augsburg, in Frankfurt a. M.,
Schleißheim, Prag und Nürnberg zu fehen find, — meift
Darſtellungen aus der Leidensgefchichte Chrifti und der
MApoftel, etwas manierirt in der Stellung und Bewegung der
Figuren, aber kräftig und harmoniſch in der Farbe und von
groͤßer iechniſcher Gewandtheit der Pinſelführung und un—
verkennbarem Beſtreben getreuer Naturnadhahmung. Dieſer
Hans Holbein der Weltere fol etwa um 1504 mit feinen
Söhnen Ambrofius, Bruno und Hans nach Baſel überſiedelt
und dort etwa um 1526 geftorben fein. Der künſtleriſch
hegabtefte unter feinen Söhnen war der jüngfte, etwa um
1498 zu Augsburg geboren und Hans Holbein der
Süngere genannt, defjen Porträt wir S. 25 geben und
von dem wir hier ausſchließlich ſprechen wollen, denn er,
gleich ausgezeichnet als Maler wie als Formſtecher, iſt neben
Dürer und Cranach der größte Künſtler der altdeutſchen
Schule und hat weit über die Grenzen ſeines Vaterlandes
hinaus Ehre uͤnd Ruhm geerntet, aber auch ein wild beweg⸗
te8 Leben geführt.
Schon als Jüngling Teiftete er in der Malerei Bedeuten:
de8, denn wir Haben noch Bilder von ihm, die er im 15,
und 18. Lebensjahre gemalt Hat und die von feltener
Genialität · zeugen. Er ſcheint einen Theil feiner Jüng—
lingsjahre in Augsburg verlebt und fih erft um 1516 nach
Bafjel begeben zu haben, wo er fi 1519 bleibend nieder:
ließ und im folgenden Jahre den Bürgereid ablegte. In
die Jahre 1519 1526 fallen die beſten Leiſtungen ſeiner
künſtleriſchen Thätigkeit als Maler, die meiſt auch noch in
Bafel erhalten find. 1529 ging er nad England, durch
Srasmu8 von Rotterdam empfohlen an den berühmten Nanz:
ler Thomas Morus, welcher ihn in feinem LandhHaufe zu
Chelſea gaftfreundlich aufnahm. Cr arbeitete in London
fleißig als Maler, Bildjdhniger, Zeichner für Kunſtgewerbe,
als Stempel⸗ und Holzſchneider, ſogar als Bauzeichner, denn
er rang mit dem Leben um's Leben, und kehrte 1529 nach
Baſel zurück, wo er nun unter Anderem jene Madonna des
Bürgermeiſters Meyer malte, wovon ein Exemplar in der
Dresdener Galerie (wir geben eine Kopie davon auf
S, 24), da3 andere in Darmftadt im Privatbefis. ft. Bes
kanntlich hat {ich bei Gelegenheit der Holbein-Ausftellung in
Dresden im Jahre 1871 ein fehr Heftiger Streit darlıber
entſponnen, welches von dieſen beiden Bildern das echte und
urſprüngliche ſei, und die Meinungen ſind ſo getheilt und
beiderſeits ſo triftig motivirt, daß das endgiltige Urtheil
noch nicht gefällt iſt. Jedenfalls iſt dieſe Madonna eine der
vollendeiſten Leiſtungen des jüngern Holbeins, gemalt in
einem Augenblick ernſter Sammlung, wo er ſeinem ſonſtigen
milden Leben entſagt haben mag, um ein gutes Stück Geld
zu verdienen. Das Bild iſt die harmoniſchſte und friedlich
verföhnendfte- Vereinigung des Göttlichen mit dem Menſch⸗
lichen auf demſelben Boden und in demſelben Rahmen, und
ſoll in folgender Weiſe entſtanden fein: der Bürgermeiſter
Meyer, welchen ſammt ſeiner Gattin Holbein ſchon früher
gemaͤlt hatte, war bei der Einführung der Reformation in
Baſel kalholifch geblieben und hatte deshalb mehrmals flüch—
ten müffen. Einſtmals ward ſein jüngſtes Söhnchen krank
und er that das Gelübde, ein Madonnenbild von Holbeins
Meiſterhand als Votivbild zu ſtiften, wenn ſein Söhnlein
wieder geneſe. So malte denn Holbein die Mutter Gottes
voll Hoheit und Anmuth, welche mit dem kranken Kind auf
dem Arme unter einer Art Niſche auf einem prächtigen per—
fiſchen Teppich ſteht. Zur Rechten der Madonna kniet der
Bürgermeiſter Meyer mit betend gefalteten Händen und
ſchaut flehend zu der Mutter Gottes empor; vor ihm kniet
fein Sohn, welcher das Jeſuskind hält. Auf der linken
Seite der Himmelsgöttin ſehen wir zunächſt die verſtorbene
Gattin Meyer's, Anna geb. Tſcheckenbürlin, mit leichenbleichem
Antlitz, das Haupt halb verhüllt durch ein Schweißtuch, um
die Glieder ein ſchwarzes Bahrtuch; neben ihr knieen ihre
beiden Töchter, von denen die vordere, jüngere, ein weißes
Kleid mit Goldftiderei am Halfe und eine‘ Hochrothe Sammet-
Haube, mit Gold und Perlen geftidt, als Kopfbededkung trägt,
Unverfennbar gleidhen diefe jüngere Tochter und das Franke
Kind der todien Mutter, während andererfeits die Mehnlich-
keit zwiſchen dem Bürgermeiſter und feinem Sohn, fowie
die zwiſchen dem Jeſuskind und der Madonna, und ſomit die
Beftimmung des Gemäldes als Votivbild in die Augen
ſpringen. Das Dresdener Bild iſt mehrfach reftaurirt, re:
touchirt, übermalt und ſorgfältig gefirnißt, während das
Darmſtädter Exemplar beſchädigt und ſtark nachgedunkelt iſt.
Gleichwohl iſt bei beiden die Lebenstreue und die Innigkeit
des Ausdrucks unverkennbar und bekunden die Meiſterhand
Holbein's und ſeine Genialität als Porträtmaler, in welcher
Eigenſchaft er ſich namentlich bei ſeinem ſpätern Aufenthalte
in England ſo ſehr hervorthat. Er verlebte nämlich die Jahre
1532 bis 38 wieder in London, erſchien 1539 nur vorüber⸗
gehend in Baſel, wo es ihm nunmehr zu kleinſtädtiſch und
eng vorkommen mochte, ſo daß er ſich ſelbſt durch das An⸗
erbieten eines Jahresgehalts von Seiten der Stadt Baſel
nicht daſelbſt halten ließ, ſondern, nachdem er im Auftrag
des Königs von England nach Hochburgund ein Bild der
verwittweten Herzogin Chriſtiane von Mailand gemalt hatte,
nach London zurückkehrte.
Am Hofe Heinrich's VIII., des bekannten Lüftlings und
königlichen Blaubarts, lebte Holbein noch lange Jahre, bis ihn
1551 die Peſt dahinraffte. Die früheſte Neigung der Eng⸗
lander zur Kunſt mußte ſich — ſo bemerkt Goethe — in
Ermanglung inländiſcher Talente nach auswärtigen Künſtlern
und Kuͤnſtwerken umſehen; darum gelangte Holbein auch im
fremden Lande zu größerem Anſehen und größeren Ehren,
als es ihm wohl jemals in ſeiner Heimath möglich geweſen
wäre, In Handzeichnung ſind 87 Porträts von Perſonen,
die am Hofe Heinrich’8s VII. lebten, von ihm vorhanden,
auf verſchiedenen Bildern hat Holbein das Porträt Des
Königs felbit unter die Figurengruppen mit aufgenommen.
Holbein Hatte Perioden in feinem Leben, wo er fich nur
auf's Borträtmalen verlegte, und er zeichnete fich dabei Durch
die tiefe Auffaffung der darzuftellenden Perfönlichkeiten in
ihren geiftigjten Zügen aus, Seine religibjen Bilder ver-
rathen ein echt deutiches SGefühlsleben, und fehlte ihm auch
der ideale Schwung der italienifhen Schule, fo wußte er
fi doch felbfiftändig feine Wege zu bahnen und zu einer
unbefangenen, naturwahren Darſtellung des Lebens ſelbſt
vorzudringen.
Wir werden noch mehrfach auf Holbein zurückkommen und
deſſen Leben und Werke näher beſprechen. Hier ſei nur noch
einer geiſtvollen Vermuthung gedacht, welche kürzlich öffentlich
ausgeſprochen ward: daß nämlich die Darmſtädter Madonna
das ältere Bild und etwa um 1522 gemalt worden, das
Dresdener dagegen als individualiſirtere Wiederholung des—
ſelben Gegenſtandes in den Jahren 1529 bis 1532 nach
Holbeins Heimkehr von England entſtanden ſein dürfte.
O. M.
Menagerieſtudien.
Züge aus dem Seelenleben der Thiere.
Von
A. DB.
1. Hyronimus.
Im Jahre 1867 fand ich mich durch das Falliment
eines Handelshauſes in Buenos Ayres plötzlich als
Mitbeſitzer einer in Europa herumreiſenden Menagerie.
Ich mußte trotz meines Schreckens lachen, als mir die
Mittheilung gemacht wurde. Ich hatte zwar einmal
eine Heerde Elephanten aus einer Entfernung von etwa
einer engliſchen Meile mäuschenſtill betrachtet, auch
mit keineswegs objektivem Gemüthszuſtande von einem
großen bengaͤliſchen Tiger mein Wagenpferd zerreißen
ſehen — im Uebrigen aber wußte ich von derartigen
Beſtien, ihrer Behandlung in der Gefangenſchaft und
dem Geſchäftsbetrieb einer herumziehenden Menagerie
ungefähr ſo viel wie ein Rabe von italieniſcher Opern⸗—
muſik. Die Welt iſt rund und dreht ſich! dachte ich,
und beſchloß, mich ebenfalls zu drehen, das Heißt: ich
dampfte fort nach Verona, wo die Menagerie damals
ihre Zelte aufgeſchlagen hatte.
Ich fand die Anſtalt recht bedeutend und war über⸗
raſcht von der Schönheit und guten Auswahl der
Thiere. Nach kurzer Unterredung mit meinem Com—
pagnon, der das Geſchäft regelrecht gelernt hatte, war
ich entſchloſſen, eine Zeit lang der Bande zu folgen,
uin zu probiren, ob ich „hälber Menageriebeſitzer“
bleiben oder die Cſchichte ſo ſchnell wie thunlich los⸗
ſchlagen ſollte.
Von Eiſenbahnfahren war bei unſerem Geſchäfts—
gang keine Rede; wir pilgerten mit unſern acht Wagen
von Stadt zu Stadt und verſchmähten es ſelbſt nicht,
auf Dörfern einzelne Thiere gegen Viktualienlieferungen
zu zeigen.
Unſere Caravane hatte jedenfalls ein ſeltſames Aus⸗
ſehen, denn die erſten drei Wagen zog in höchſteigener
Perſon der Hauptſchmuck — in doppelter Beziehung
das Hauptz ugſt ück unſerer Menagerie — ein‘ präch-
tiger indiſcher Elephant. Würdevoll wie ein Patriarch
ſtoͤlzierte er mit ſeiner angehängten Laſt dem Zug
voran, in ſtets gleichmäßiger Seelenruhe, das große
graue Haupt geneigt und den Rüſſel etwas nach dem
Leib zu eingezogen; aber die kleinen liſtigen Augen
ſchweiften lebhaft umher, nichts, gar nicht? entging
dieſen ſchwarzen funkelnden Sternen, und in welchem
Rapport dieſe mit dem Gedächtniß des rieſenhaften
Burſchen ſtanden, ſollten wir bald erfahren.
Damit unſer koſtbares Zugſtück nicht ſo offen all'
den neugierigen Blicken ausgeſetzt war, ging Hyro—
nimus — ſo hieß der Elephant — in einem leich—
ten Holzhäuschen ohne Boden mit Rädern und Lein—
wanddach; in der Kopfgegend war eine Art Giebel
hinausgebaut, welcher auf der Landſtraße offen, vor
Dörfern und Städten geſchloſſen wurde, und Hyroni—
mus wandelte ſo, ohne an dem ambulanten Käfig An—
ſtoß zu nehmen, zufrieden des Weges, den ſein Führer
ihn lenkte.
Wir waren bis Deſenzano (am Gardaſee) gekom—
men, als plötzlich Hyronimus kurz vor dem Flecken
Halt machte und fehr beftimmt fich Hinpflanzend die
Äbſicht kund gab, feinen Schritt weiter zu gehen. Dies
gab natürlich eine gewaltige Stodung in unjern Zug.