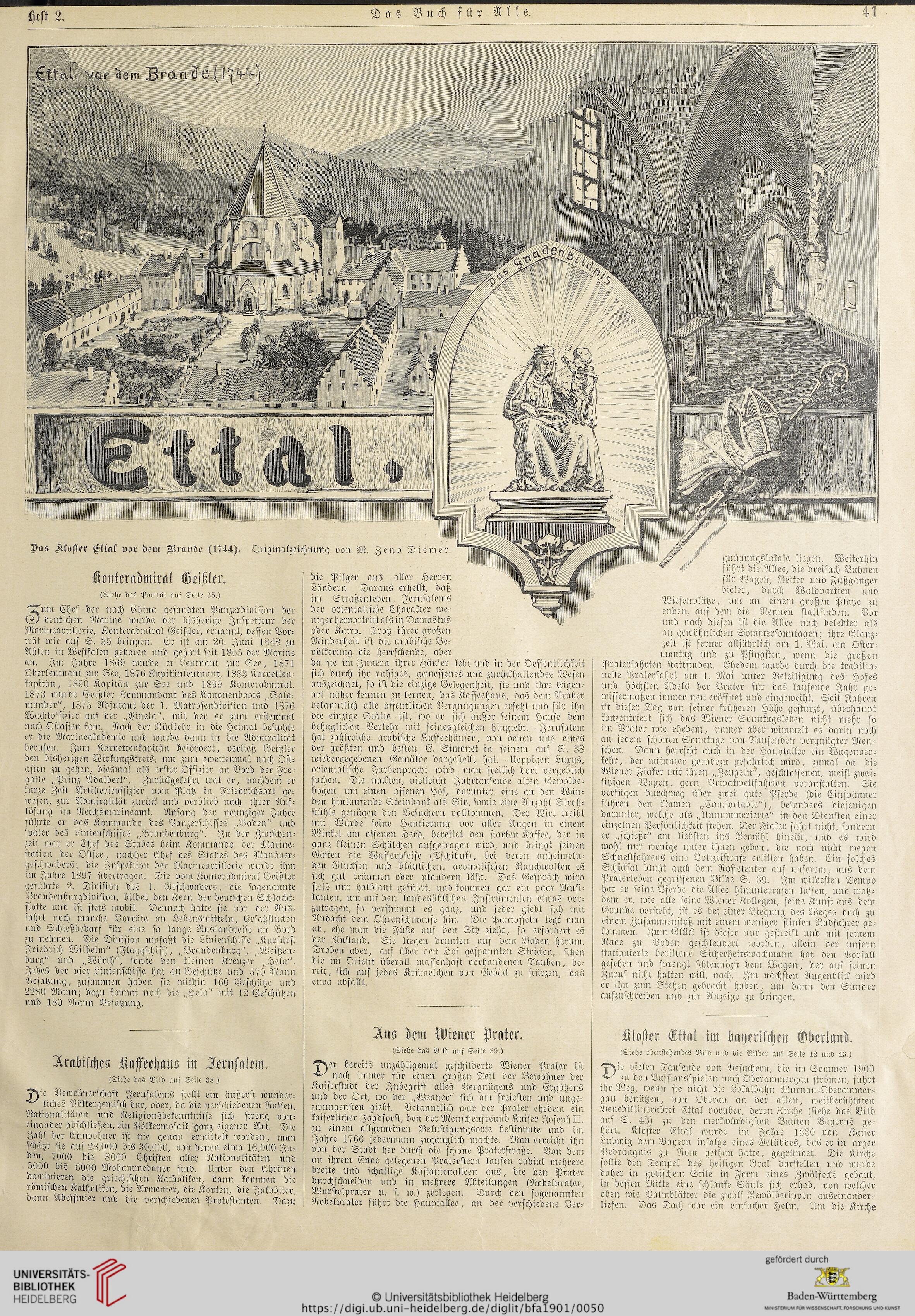Heft 2.
Das Buch für Alle.
Aas Kloster tzltak vor dem Mraiide (1744). Originalzeichnung von M. Zeno Di einer.
die Pilger aus aller Herren
Ländern. Daraus erhellt, daß
im Straßenleben Jerusalems
der orientalische Charakter we-
niger hervortritt als in Damaskus D"
oder Kairo. Trotz ihrer großen
Minderheit ist die arabische Be-
völkerung die herrschende, aber
da sie im Innern ihrer Häuser lebt und in der Oeffentlichkeit
sich durch ihr ruhiges, gemessenes und zurückhaltendes Wesen
auszeichnet, so ist die einzige Gelegenheit, sie und ihre Eigen-
art näher kennen zu lernen, das Kaffeehaus, das dem Araber
bekanntlich alle öffentlichen Vergnügungen ersetzt und für ihn
die einzige Stätte ist, wo er sich außer seinem Hause dein
behaglichen Verkehr mit seinesgleichen hingiebt. Jerusalem
hat zahlreiche arabische Kaffeehäuser, von denen uns eines
der größten und besten E. Simonet in seinem auf S. 38
wiedergegebeuen Gemälde dargestellt hat. Ueppigen Luxus,
orientalische Farbenpracht wird man freilich dort vergeblich
suchen. Die nackten, vielleicht Jahrtausende alten Gewölbe-
bogen um einen offenen Hof, darunter eine an den Wän-
den hinlaufende Steinbank als Sitz, sowie eine Anzahl Stroh-
stühle genügen den Besuchern vollkommen. Der Wirt treibt
mit Würde seine Hantierung vor aller Augen in einem
Winkel an: offenen Herd, bereitet den starken Kaffee, der in
ganz kleinen Schälchen aufgetragen wird, und bringt seinen
Gästen die Wasserpfeife (Tschibuk), bei deren anheimeln-
den Glucksen und bläulichen, aromatischen Rauchwolken es
sich gut träumen oder plaudern läßt. Das Gespräch wird
stets nur halblaut geführt, und kommen gar ein paar Musi-
kanten, um auf den landesüblichen Instrumenten etwas vor-
zutragen, so verstummt es ganz, und jeder giebt sich mit
Andacht dem Ohrenschmause hin. Dis Pantoffeln legt man
ab, ehe man die Füße auf den Sitz zieht, so erfordert es
der Anstand. Sie liegen drunten auf dem Boden herum.
Droben aber, auf über deu Hof gespannten Stricken, fitzen
die im Orient überall massenhaft vorhandenen Tauben, be-
reit, sich auf jedes Krümelchen von Gebäck zu stürzen, das
etwa nbfällt.
W!!W I gnügungsloknle liegen. Weiterhin
führt die Allee, die dreifach Bahnen
für Wagen, Reiter und Fußgänger
bietet, durch Waldpartien und
Wiesenplätze, um an einein großen Platze zu
enden, auf dem die Nennen stattfinden. Vor
und nach diesen ist die Allee noch belebter als
an gewöhnlichen Sommersonntagen; ihre Glanz-
zeit ist ferner alljährlich am 1. Mai, am Oster-
montag und zu Pfingsten, wenn die großen
Praterfahrten stattfinden. Ehedem wurde durch die traditio-
nelle Praterfahrt am 1. Mai unter Beteiligung des Hofes
und höchsten Adels der Prater für das laufende Jahr ge-
wissermaßen immer neu eröffnet und eingeweiht. Seit Jahren
ist dieser Tag von seiner früheren Höhe gestürzt, überhaupt
konzentriert sich das Wiener Sonntagsleben nicht mehr so
im Prater wie ehedem, immer aber wimmelt es darin noch
an jedem schöllen Sonntage von Tausenden vergnügter Men-
schen. Dann herrscht auch in der Hauptallee ein Wagenver-
kehr, der mitunter geradezu gefährlich wird, zumal da die
Wiener Fiaker mit ihren „Zeugelu'st geschloffenen, meist zwei-
sitzigen Wagen, gern Privatwettfahrten veranstalten. Sie
verfügen durchweg über zwei gute Pferde (die Einspänner
führen den Namen „Comfortable"), besonders diejenigen
darunter, welche als „Unnummerierte" in den Diensten einer-
einzelnen Persönlichkeit stehen. Der Fiaker fährt nicht, sondern
er „schießt" am liebsten ins Gewühl hinein, und es wird
wohl nur wenige unter ihnen geben, die noch nicht wegen
Schnellfahrens eine Polizeistrafs erlitten haben. Ein solches
Schicksal blüht auch dem Rosselenker auf unserem, aus den:
Praterleben gegriffenen Bilde S. 39. Im wildesten Tempo
hat er seine Pferde die Allee hinunterrasen lassen, und trotz-
dem er, wie alle seine Wiener Kollegen, seine Kunst aus dem
Grunde versteht, ist es bei einer Biegung des Weges doch zu
einem Zusammenstoß mit einem weniger flinken Radfahrer ge-
kommen. Zum Glück ist dieser nur gestreift und mit seinem
Rade zu Boden geschleudert worden, allein der unfern
stationierte berittene Sicherheitswachmann hat den Vorfall
gesehen und sprengt schleunigst dem Wagen, der auf seinen
Zuruf nicht halten will, nach. Im nächsten Augenblick wird
er ihn zum Stehen gebracht haben, um dann den Sünder
auszuschreiben und zur Anzeige zu bringen.
Konteradmiral Geißler.
^um Chef der nach China gesandten Panzerdivision der
deutschen Marine wurde der bisherige Inspekteur der
Marineartillerie, Konteradmiral Geißler, ernannt, dessen Por-
trät wir auf S. 85 bringen. Er ist nur 20. Juni 1848 zn
Ahlen in Westfalen geboren und gehört seit 1805 der Marine
an. Im Jahre 1809 wurde er Leutnant zur See, 1871
Oberleutnant zur See, 1876 Kapitänleutnant, 1883 Korvetten-
kapitän, 1890 Kapitän zur See und 1899 Konteradmiral.
1873 wurde Geißler Kommandant des Kanonenboots „Sala-
mander", 1875 Adjutant der 1. Matrosendivifion und 1876
Wachtoffizier auf der „Vineta", mit der er zum erstenmal
nach Ostasien kam. Nach der Rückkehr in die Heimat besuchte
er die Marinenkahemie und wurde dann in die Admiralität
berufen. Zum Korvettenkapitän befördert, verließ Geißler
den bisherigen Wirkungskreis, um zum zweitenmal nach Ost-
afien zu gehen, diesmal als erster Offizier an Bord der Fre-
gatte „Prinz Adalbert". Zurückgekehrt trat er, nachdem er
kurze Zeit Artillerieoffizier vom Platz in Friedrichsort ge-
wesen, zur Admiralität zurück uud verblieb nach ihrer Auf-
lösung im Reichsmarineamt. Anfang der neunziger Jahre
führte er das Kommando des Panzerschiffes „Baden" rind
später des Linienschiffes „Brandenburg". In der Zwischen-
zeit war er Chef des Stabes beim Kommando der Marine-
station der Ostsee, nachher Chef des Stabes des Manöver-
geschwaders; die Inspektion der Marineartillerie wurde ihm
im Jahre 1897 übertragen. Die von: Konteradmiral Geißler
geführte 2. Division des 1. Geschwaders, die sogenannte
Brandenburgdivision, bildet den Kern der deutschen Schlacht-
flotte und ist stets mobil. Dennoch hatte sie vor der Aus-
fahrt noch manche Vorräte an Lebensmitteln, Ersatzstücken
und Schießbedarf für eine so lange Auslandreise an Bord
zu nehmen. Die Division umfaßt die Linienschiffe „Kurfürst
Friedrich Wilhelm" (Flaggschiff), „Brandenburg", „Weißen-
burg" und „Wörth", sowie den kleinen Kreuzer „Hela".
Jedes der vier Linienschiffe hat 40 Geschütze und 570 Mann
Besatzung, zusammen haben sie mithin 160 Geschütze und
2280 Mann; dazu kommt noch die „Hela" mit 12 Geschützen
und 180 Alaun Besatzung.
I
-
MW
u, Wu
WNAWI^^
8
Arabisches Kaffeehaus m Jerusalem.
(Siehe das Bild auf Seite 38 )
?)ie Bewohnerschaft Jerusalems stellt ein äußerst wunder-
licheS Völkergemisch dar, oder, da die verschiedenen Rassen,
Nationalitäten und Religionsbekenntnisse sich streng von-
einander abschließen, ein Völkermosaik ganz eigener Art. Die
Zahl der Einwohner ist nie genan ermittelt worden, man
schätzt sie auf 28,000 bis 30,000, von denen etwa 16,000 Ju-
den, 7000 bis 8000 Christen aller Nationalitäten und
5000 bis 6000 Mohammedaner sind. Unter den Christen
dominieren die griechischen Katholiken, dann kommen die
römischen Katholiken, dis Armenier, die Kopten, die Jakobiter,
dann Abessinier und die verschiedenen Protestanten. Dazu
Aus -em Wiener Prater.
(Siehe das Bild auf Seile 39.)
?>er bereits unzähligemal geschilderte Wiener Prater ist
noch immer für einen großen Teil der Bewohner der
Kaiserstadt der Inbegriff alles Vergnügens und Ergötzens
und der Ort, wo der „Weaner" sich am freiesten und unge-
zwungensten giebt. Bekanntlich war der Prater ehedem ein
kaiserlicher Jagdforst, den der Menschenfreund Kaiser Joseph II.
zu einem allgemeinen Belustigungsorts bestimmte und im
Jahre 1766 jedermann zugänglich machte. Man erreicht ihn
von der Stadt her durch die schöne Praterstraße. Von dem
an ihrem Ende gelegenen Praterstern laufen radial mehrere
breite und schattige Kastanienalleen aus, die den Prater-
durchschneiden und in mehrere Abteilungen (Nobelprater,
Wurstelprater u. s. w.) zerlegen. Durch den sogenannten
Nobelprater führt die Hauptallee, an der verschiedene Ver-
Kloäer Ettal im bayerischen Oberland.
(Siehe ovensiehendes Bild und die Bilder auf Seite 42 und 43.)
-^ie vielen Tausends von Besuchern, die im Sommer 1900
zu den Passionsspielen nach Oberammergau strömen, führt
ihr Weg, wenn sie nicht die Lokalbahn Murnau-Oberammer-
gau benützen, von Oberau au der alten, weitberühmten
Benediktinerabtei Ettal vorüber, deren Kirche (siehe das Bild
auf S. 43) zu den merkwürdigsten Bauten Bayerns ge-
hört. Kloster Ettal wurde in: Jahre 1330 von Kaiser-
Ludwig den: Bayern infolge eines Gelübdes, das er in arger
Bedrängnis zu Non: gethau hatte, gegründet. Die Kirche
sollte den Tempel des heiligen Gral darstellen und wurde
daher in gotischen: Stile in Form eines Zwölfecks gebaut,
in dessen Mitte eine schlanke Säule sich erhob, von welcher
oben wie Palmblätter die zwölf Gewölberippen auseinander-
liefen. Das Dach war ein einfacher Helm. Um die Kirchs
Das Buch für Alle.
Aas Kloster tzltak vor dem Mraiide (1744). Originalzeichnung von M. Zeno Di einer.
die Pilger aus aller Herren
Ländern. Daraus erhellt, daß
im Straßenleben Jerusalems
der orientalische Charakter we-
niger hervortritt als in Damaskus D"
oder Kairo. Trotz ihrer großen
Minderheit ist die arabische Be-
völkerung die herrschende, aber
da sie im Innern ihrer Häuser lebt und in der Oeffentlichkeit
sich durch ihr ruhiges, gemessenes und zurückhaltendes Wesen
auszeichnet, so ist die einzige Gelegenheit, sie und ihre Eigen-
art näher kennen zu lernen, das Kaffeehaus, das dem Araber
bekanntlich alle öffentlichen Vergnügungen ersetzt und für ihn
die einzige Stätte ist, wo er sich außer seinem Hause dein
behaglichen Verkehr mit seinesgleichen hingiebt. Jerusalem
hat zahlreiche arabische Kaffeehäuser, von denen uns eines
der größten und besten E. Simonet in seinem auf S. 38
wiedergegebeuen Gemälde dargestellt hat. Ueppigen Luxus,
orientalische Farbenpracht wird man freilich dort vergeblich
suchen. Die nackten, vielleicht Jahrtausende alten Gewölbe-
bogen um einen offenen Hof, darunter eine an den Wän-
den hinlaufende Steinbank als Sitz, sowie eine Anzahl Stroh-
stühle genügen den Besuchern vollkommen. Der Wirt treibt
mit Würde seine Hantierung vor aller Augen in einem
Winkel an: offenen Herd, bereitet den starken Kaffee, der in
ganz kleinen Schälchen aufgetragen wird, und bringt seinen
Gästen die Wasserpfeife (Tschibuk), bei deren anheimeln-
den Glucksen und bläulichen, aromatischen Rauchwolken es
sich gut träumen oder plaudern läßt. Das Gespräch wird
stets nur halblaut geführt, und kommen gar ein paar Musi-
kanten, um auf den landesüblichen Instrumenten etwas vor-
zutragen, so verstummt es ganz, und jeder giebt sich mit
Andacht dem Ohrenschmause hin. Dis Pantoffeln legt man
ab, ehe man die Füße auf den Sitz zieht, so erfordert es
der Anstand. Sie liegen drunten auf dem Boden herum.
Droben aber, auf über deu Hof gespannten Stricken, fitzen
die im Orient überall massenhaft vorhandenen Tauben, be-
reit, sich auf jedes Krümelchen von Gebäck zu stürzen, das
etwa nbfällt.
W!!W I gnügungsloknle liegen. Weiterhin
führt die Allee, die dreifach Bahnen
für Wagen, Reiter und Fußgänger
bietet, durch Waldpartien und
Wiesenplätze, um an einein großen Platze zu
enden, auf dem die Nennen stattfinden. Vor
und nach diesen ist die Allee noch belebter als
an gewöhnlichen Sommersonntagen; ihre Glanz-
zeit ist ferner alljährlich am 1. Mai, am Oster-
montag und zu Pfingsten, wenn die großen
Praterfahrten stattfinden. Ehedem wurde durch die traditio-
nelle Praterfahrt am 1. Mai unter Beteiligung des Hofes
und höchsten Adels der Prater für das laufende Jahr ge-
wissermaßen immer neu eröffnet und eingeweiht. Seit Jahren
ist dieser Tag von seiner früheren Höhe gestürzt, überhaupt
konzentriert sich das Wiener Sonntagsleben nicht mehr so
im Prater wie ehedem, immer aber wimmelt es darin noch
an jedem schöllen Sonntage von Tausenden vergnügter Men-
schen. Dann herrscht auch in der Hauptallee ein Wagenver-
kehr, der mitunter geradezu gefährlich wird, zumal da die
Wiener Fiaker mit ihren „Zeugelu'st geschloffenen, meist zwei-
sitzigen Wagen, gern Privatwettfahrten veranstalten. Sie
verfügen durchweg über zwei gute Pferde (die Einspänner
führen den Namen „Comfortable"), besonders diejenigen
darunter, welche als „Unnummerierte" in den Diensten einer-
einzelnen Persönlichkeit stehen. Der Fiaker fährt nicht, sondern
er „schießt" am liebsten ins Gewühl hinein, und es wird
wohl nur wenige unter ihnen geben, die noch nicht wegen
Schnellfahrens eine Polizeistrafs erlitten haben. Ein solches
Schicksal blüht auch dem Rosselenker auf unserem, aus den:
Praterleben gegriffenen Bilde S. 39. Im wildesten Tempo
hat er seine Pferde die Allee hinunterrasen lassen, und trotz-
dem er, wie alle seine Wiener Kollegen, seine Kunst aus dem
Grunde versteht, ist es bei einer Biegung des Weges doch zu
einem Zusammenstoß mit einem weniger flinken Radfahrer ge-
kommen. Zum Glück ist dieser nur gestreift und mit seinem
Rade zu Boden geschleudert worden, allein der unfern
stationierte berittene Sicherheitswachmann hat den Vorfall
gesehen und sprengt schleunigst dem Wagen, der auf seinen
Zuruf nicht halten will, nach. Im nächsten Augenblick wird
er ihn zum Stehen gebracht haben, um dann den Sünder
auszuschreiben und zur Anzeige zu bringen.
Konteradmiral Geißler.
^um Chef der nach China gesandten Panzerdivision der
deutschen Marine wurde der bisherige Inspekteur der
Marineartillerie, Konteradmiral Geißler, ernannt, dessen Por-
trät wir auf S. 85 bringen. Er ist nur 20. Juni 1848 zn
Ahlen in Westfalen geboren und gehört seit 1805 der Marine
an. Im Jahre 1809 wurde er Leutnant zur See, 1871
Oberleutnant zur See, 1876 Kapitänleutnant, 1883 Korvetten-
kapitän, 1890 Kapitän zur See und 1899 Konteradmiral.
1873 wurde Geißler Kommandant des Kanonenboots „Sala-
mander", 1875 Adjutant der 1. Matrosendivifion und 1876
Wachtoffizier auf der „Vineta", mit der er zum erstenmal
nach Ostasien kam. Nach der Rückkehr in die Heimat besuchte
er die Marinenkahemie und wurde dann in die Admiralität
berufen. Zum Korvettenkapitän befördert, verließ Geißler
den bisherigen Wirkungskreis, um zum zweitenmal nach Ost-
afien zu gehen, diesmal als erster Offizier an Bord der Fre-
gatte „Prinz Adalbert". Zurückgekehrt trat er, nachdem er
kurze Zeit Artillerieoffizier vom Platz in Friedrichsort ge-
wesen, zur Admiralität zurück uud verblieb nach ihrer Auf-
lösung im Reichsmarineamt. Anfang der neunziger Jahre
führte er das Kommando des Panzerschiffes „Baden" rind
später des Linienschiffes „Brandenburg". In der Zwischen-
zeit war er Chef des Stabes beim Kommando der Marine-
station der Ostsee, nachher Chef des Stabes des Manöver-
geschwaders; die Inspektion der Marineartillerie wurde ihm
im Jahre 1897 übertragen. Die von: Konteradmiral Geißler
geführte 2. Division des 1. Geschwaders, die sogenannte
Brandenburgdivision, bildet den Kern der deutschen Schlacht-
flotte und ist stets mobil. Dennoch hatte sie vor der Aus-
fahrt noch manche Vorräte an Lebensmitteln, Ersatzstücken
und Schießbedarf für eine so lange Auslandreise an Bord
zu nehmen. Die Division umfaßt die Linienschiffe „Kurfürst
Friedrich Wilhelm" (Flaggschiff), „Brandenburg", „Weißen-
burg" und „Wörth", sowie den kleinen Kreuzer „Hela".
Jedes der vier Linienschiffe hat 40 Geschütze und 570 Mann
Besatzung, zusammen haben sie mithin 160 Geschütze und
2280 Mann; dazu kommt noch die „Hela" mit 12 Geschützen
und 180 Alaun Besatzung.
I
-
MW
u, Wu
WNAWI^^
8
Arabisches Kaffeehaus m Jerusalem.
(Siehe das Bild auf Seite 38 )
?)ie Bewohnerschaft Jerusalems stellt ein äußerst wunder-
licheS Völkergemisch dar, oder, da die verschiedenen Rassen,
Nationalitäten und Religionsbekenntnisse sich streng von-
einander abschließen, ein Völkermosaik ganz eigener Art. Die
Zahl der Einwohner ist nie genan ermittelt worden, man
schätzt sie auf 28,000 bis 30,000, von denen etwa 16,000 Ju-
den, 7000 bis 8000 Christen aller Nationalitäten und
5000 bis 6000 Mohammedaner sind. Unter den Christen
dominieren die griechischen Katholiken, dann kommen die
römischen Katholiken, dis Armenier, die Kopten, die Jakobiter,
dann Abessinier und die verschiedenen Protestanten. Dazu
Aus -em Wiener Prater.
(Siehe das Bild auf Seile 39.)
?>er bereits unzähligemal geschilderte Wiener Prater ist
noch immer für einen großen Teil der Bewohner der
Kaiserstadt der Inbegriff alles Vergnügens und Ergötzens
und der Ort, wo der „Weaner" sich am freiesten und unge-
zwungensten giebt. Bekanntlich war der Prater ehedem ein
kaiserlicher Jagdforst, den der Menschenfreund Kaiser Joseph II.
zu einem allgemeinen Belustigungsorts bestimmte und im
Jahre 1766 jedermann zugänglich machte. Man erreicht ihn
von der Stadt her durch die schöne Praterstraße. Von dem
an ihrem Ende gelegenen Praterstern laufen radial mehrere
breite und schattige Kastanienalleen aus, die den Prater-
durchschneiden und in mehrere Abteilungen (Nobelprater,
Wurstelprater u. s. w.) zerlegen. Durch den sogenannten
Nobelprater führt die Hauptallee, an der verschiedene Ver-
Kloäer Ettal im bayerischen Oberland.
(Siehe ovensiehendes Bild und die Bilder auf Seite 42 und 43.)
-^ie vielen Tausends von Besuchern, die im Sommer 1900
zu den Passionsspielen nach Oberammergau strömen, führt
ihr Weg, wenn sie nicht die Lokalbahn Murnau-Oberammer-
gau benützen, von Oberau au der alten, weitberühmten
Benediktinerabtei Ettal vorüber, deren Kirche (siehe das Bild
auf S. 43) zu den merkwürdigsten Bauten Bayerns ge-
hört. Kloster Ettal wurde in: Jahre 1330 von Kaiser-
Ludwig den: Bayern infolge eines Gelübdes, das er in arger
Bedrängnis zu Non: gethau hatte, gegründet. Die Kirche
sollte den Tempel des heiligen Gral darstellen und wurde
daher in gotischen: Stile in Form eines Zwölfecks gebaut,
in dessen Mitte eine schlanke Säule sich erhob, von welcher
oben wie Palmblätter die zwölf Gewölberippen auseinander-
liefen. Das Dach war ein einfacher Helm. Um die Kirchs