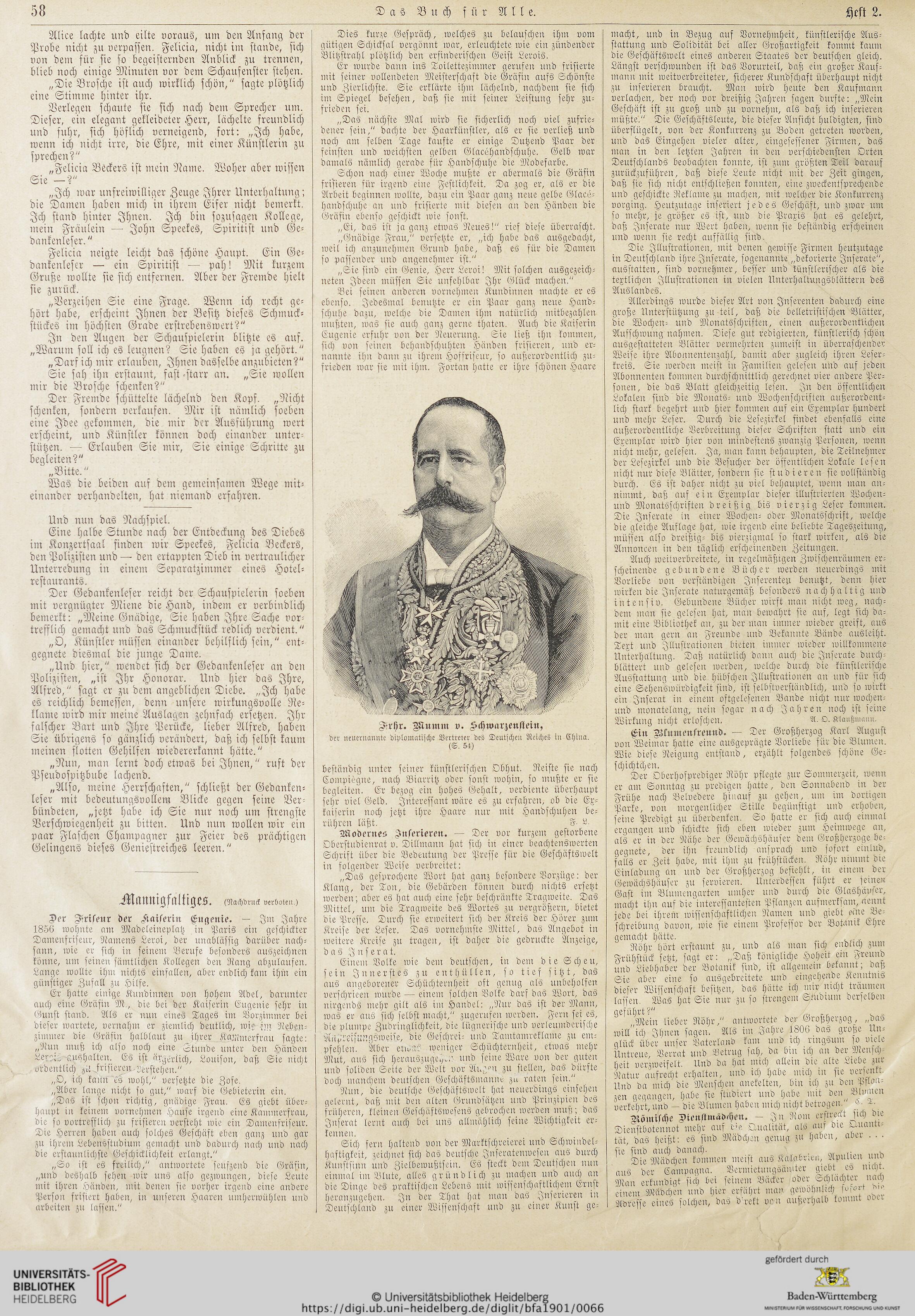58
Das Buch fü r A l l e.
Heft 2.
Alice lachte und eilte voraus, um den Anfang der
Probe nicht zu verpassen. Felicia, nicht im stände, sich
von dein für sie so begeisternde!: Anblick zu trennen,
blieb noch einige Minuten vor dem Schaufenster stehen.
„Die Brosche ist auch wirklich schön," sagte plötzlich
eine Stimme hinter ihr.
Verlegen schaute sie sich nach dein Sprecher um.
Dieser, ein elegant gekleideter Herr, lächelte freundlich
und fuhr, sich höflich verneigend, fort: „Ich habe,
wenn ich nicht irre, die Ehre, mit einer Künstlerin zu
sprechen?"
„Felicia Beckers ist mein Name. Woher aber missen
Sie —?"
„Ich war unfreiwilliger Zeuge Ihrer Unterhaltung;
die Damen haben mich in ihrem Eifer nicht bemerkt.
Ich stand hinter Ihnen. Ich bin sozusagen Kollege,
mein Fräulein — John Speekes, Spiritist und Ge-
dankenleser."
Felicia neigte leicht das schöne Haupt. Ein Ge-
dankenleser — ein Spiritist — pah! Mit kurzem
Gruße wollte sie sich entfernen. Aber der Fremde hielt
sie zurück.
„Verzeihen Sie eine Frage. Wenn ich recht ge-
hört habe, erscheint Ihnen der Besitz dieses Schmuck-
stückes im höchsten Grade erstrebenswert?"
In den Augen der Schauspielerin blitzte es auf.
„Warum foll ich es leugnen? Sie haben es ja gehört."
„Darf ich mir erlauben, Ihnen dasselbe anzubieten?"
Sie sah ihn erstaunt, fast 'starr an. „Sie wollen
mir die Brosche schenken?"
Der Fremde schüttelte lächelnd den Kopf. „Nicht
schenken, sondern verkaufen. Mir ist nämlich soeben
eine Idee gekommen, die mir der Ausführung wert
erscheint, und Künstler können doch einander unter-
stützen. — Erlauben Sie mir, Sie einige Schritte zu
begleiten?"
„Bitte."
Was die beiden auf dem gemeinsamen Wege mit-
einander verhandelten, hat niemand erfahren.
Und nun das Nachspiel.
Eine halbe Stunde nach der Entdeckung des Diebes
im Konzertsaal finden wir Speekes, Felicia Reckers,
den Polizisten und— den ertappten Dieb in vertraulicher
Unterredung in einem Separatzimmer eines Hotel-
restaurants.
Der Gedankenleser reicht der Schauspielerin soeben
mit vergnügter Miene die Hand, indem er verbindlich
bemerkt: „Meine Gnädige, Sie haben Ihre Sache vor-
trefflich gemacht und das Schmuckstück redlich verdient."
„O, Künstler müssen einander behilflich sein," ent-
gegnete diesmal die junge Dame.
„Und hier," wendet sich der Gedankenleser an den
Polizisten, „ist Ihr Honorar. Und hier das Ihre,
Alfred," sagt er zu dem angeblichen Diebe. „Ich habe
es reichlich bemessen, denn unsere wirkungsvolle Re-
klame wird mir meine Auslagen zehnfach ersetzen. Ihr
falscher Bart und Ihre Perücke, lieber Alfred, haben
Sie übrigens so gänzlich verändert, daß ich selbst kaum
meinen stotten Gehilfen wiedererkannt hätte."
„Nun, man lernt doch etwas bei Ihnen," ruft der
Pseudospitzbube lachend.
„Also, meine Herrschaften," schließt der Gedanken-
leser mit bedeutungsvollem Blicke gegen seine Ver-
bündeten, „jetzt habe ich Sie nur noch um strengste
Verschwiegenheit zu bitten. Und nun wollen wir ein
paar Flaschen Champagner zur Feier des prächtigen
Gelingens dieses Geniestreiches leeren."
(Nachdruck verboten.)
Der Friseur der Kaiserin Kugenie. — Jin Jahre
1856 wohnte am Madeleineplatz in Paris ein geschickter
Damenfriseur, Namens Leroi, der unablässig darüber nach-
sann, wie er sich in seinem Berufe besonders auszeichnen
könne, um seinen sämtlichen Kollegen den Rang abzulausen.
Lange wollte ihm nichts einfallen, aber endlich kam ihm ein
günstiger Zufall zu Hilfe.
Er hatte einige Kundinnen von hohem Adel, darunter
auch eine Gräfin M., die bei der Kaiserin Eugenie sehr in
Gunst stand. Als er nun eines Tages im Vorzimmer bei
dieser wartete, vernahm er ziemlich deutlich, ww sm Neben-
zimmer die Gräfin halblaut zu ihrer Kammerfrau sagte:
„Nun muß ich also noch eine Stunde unter den Händen
Ler-m c.ushalten. Es ist är^rlich, Louison, daß Sie nicht
ordentlich zll festeren Perstehen."
„O, ich kann es wohl," versetzte die Zofe.
„Aber lange nicht so gut," warf die Gebieterin ein.
„Das ist schon richtig, gnädige Frau. Es giebt über-
haupt in keinem vornehmen Hause irgend eine Kammerfrau,
die so vortrefflich zu frisieren versteht wie ein Damenfriseur.
Die Herren haben auch solches Geschäft eben ganz und gar
zu ihrem Lebensstudium gemacht und dadurch nach und nach
die erstaunlichste Geschicklichkeit erlangt."
„So ist es freilich," antwortete seufzend die Gräfin,
„und deshalb sehen wir uns also gezwungen, diese Leute
mit ihren Händen, mit denen sie vorher irgend eine andere
Person frisiert haben, in unseren Haaren umherwühlen und
arbeiten zu lassen."
Dies kurze Gespräch, welches zu belauschen ihm vom
gütigen Schicksal vergönnt war, erleuchtete wie ein zündender
Blitzstrahl plötzlich den erfinderischen Geist Lerois.
Er wurde dann ins Toilettezimmer gerufen und frisierte
mit seiner vollendeten Meisterschaft die Gräfin aufs Schönste
und Zierlichste. Sie erklärte ihm lächelnd, nachdem sie sich
im Spiegel besehen, daß sie mit seiner Leistung sehr zu-
frieden sei.
„Das nächste Mal wird sie sicherlich noch viel zufrie-
dener sein," dachte der Haarkünstler, als er sie verließ und
noch am selben Tage kaufte er einige Dutzend Paar der
feinsten und weichsten gelben Glacehandschuhe. Gelb war
damals nämlich gerade für Handschuhe die Modefarbe.
Schon nach einer Woche mußte er abermals die Gräfin
frisieren für irgend eine Festlichkeit. Da zog er, als er die
Arbeit beginnen wollte, dazu ein Paar ganz neue gelbe Glace-
handschuhe an und frisierte mit diesen an den Händen die
Gräfin ebenso geschickt wie sonst.
„Ei, das ist ja ganz etwas Neues!" rief diese überrascht.
„Gnädige Fran," versetzte er, „ich habe das ausgedacht,
weil ich anzunehmen Grund habe, daß es für die Damen
so passender und angenehmer ist."
„Sie sind ein Genie, Herr Leroi! Mit solchen ausgezeich-
neten Ideen müssen Sie unfehlbar Ihr Glück machen."
Bei seinen anderen vornehmen Kundinnen machte er es
ebenso. Jedesmal benutzte er ein Paar ganz neue Hand-
schuhe dazu, welche die Damen ihm natürlich mitbezahlen
mußten, was sie auch ganz gerne thaten. Auch die Kaiserin
Eugenie erfuhr von der Neuerung. Sie ließ ihn kommen,
sich von seinen behandschuhten Händen frisieren, und er-
nannte ihn dann zu ihrem Hoffriseur, so außerordentlich zu-
frieden war sie mit ihm. Fortan hatte er ihre schönen Haare
Arljr. Wumm u. Schwarzenstein,
du iieucuinnnte tuploumtstche ^erUen^du ^eutschcu Nuchu m China.
beständig unter seiner künstlerischen Obhut. Reiste sie nach
Compiögne, nach Biarritz oder sonst wohin, so mußte er sie
begleiten. Er bezog ein hohes Gehalt, verdiente überhaupt
sehr viel Geld. Interessant wäre es zu erfahren, ob dis Ex-
kaiserin noch jetzt ihre Haare nur mit Handschuhen be-
rühren läßt. F. L.
Modernes Inserieren. — Der vor kurzem gestorbene
Oberstlidienrat v. Dillmann hat sich in einer beachtenswerten
Schrift über die Bedeutung der Presse für die Geschäftswelt
in folgender Weise verbreitet:
„Das gesprochene Wort hat ganz besondere Vorzüge: der
Klang, der Ton, die Gebärden können durch nichts ersetzt
werden; aber es hat auch eine sehr beschränkte Tragweite. Das
Mittel, um die Tragweite des Wortes zu vergrößern, bietet
die Presse. Durch sie erweitert sich der Kreis der Hörer zum
Kreise der Leser. Das vornehmste Mittel, das Angebot in
weitere Kreise zu tragen, ist daher die gedruckte Anzeige,
das Inserat.
Einem Volke wie dem deutschen, in dem die Sch eil,
sein Innerstes zu enthüllen, so tief sitzt, das
aus angeborener Schüchternheit oft genug als unbeholfen
verschrieen wnrde — einem solchen Volke darf das Wort, das
nirgends mehr gilt als im Handel: „Nur das ist der Mann,
was er aus sich selbst macht," zugerufen werden. Fern sei es,
die plumpe Zudringlichkeit, die lügnerische und verleumderische
Aüpt'cisungsweise, die Geschrei: und Tamtamreklame zu em-
pfehlen. Aber etwM? weniger Schüchternheit, etwas mehr
Mut, aus sich herauszuge^.' und seine Ware von der gnten
und soliden Seite der Welt vor Aua-m zu stellen, daS dürfte
doch manchem deutschen Geschäftsmanns zn raten sein."^
Nun, die deutsche Geschäftswelt hat neuerdings einsehen
gelernt, daß mit den alten Grundsätzen und Prinzipien des
früheren, kleinen Geschäftswesens gebrochen werden mnß; das
Inserat lernt anch bei uns allmählich seine Wichtigkeit er-
kennen.
Sich fern haltend von der Marktschreierei und Schwindel-
hastigkeit, zeichnet sich das deutsche Jnseratenwesen aus durch
Kunstsinn und Zielbewußtsein. Es steckt dem Deutschen nun
einmal im Blute, alles gründlich zu machen und auch an
die Dinge des praktischen Lebens mit wissenschaftlichem Ernst
heranzugehcn. In der That hat man das Inserieren in
Deutschland zu einer Wissenschaft und zu einer Kunst ge-
macht, und in Bezug auf Vornehmheit, künstlerische Aus-
stattung und Solidität bei aller Großartigkeit kommt kaum
die Geschäftswelt eines anderen Staates der deutschen gleich.
Längst verschwunden ist das Vorurteil, daß ein großer Kauf-
mann mit weitverbreiteter, sicherer Kundschaft überhaupt nicht
zu inserieren braucht. Man wird heute den Kaufmann
verlachen, der noch vor dreißig Jahren sagen durfte: „Mein
Geschäft ist zu groß und zu vornehm, ais daß ich inserieren
müßte." Die Geschäftsleute, die dieser Ansicht huldigten, sind
überflügelt, von der Konkurrenz zu Boden getreten worden,
und das Eingehen vieler alter, eingesessener Firmen, das
man in den letzten Jahren in den verschiedensten Orten
Deutschlands beobachten konnte, ist zum größten Teil darauf
zurückzuführen, daß diese Leute nicht mit der Zeit gingen,
daß sie sich nicht entschließen konnten, eine zweckentsprechende
und geschickte Reklame zu machen, mit welcher die Konkurrenz
vorging. Heutzutage inseriert jedes Geschäft, und zwar um
so mehr, je größer es ist, und die Praxis hat es gelehrt,
daß Inserate nur Wert haben, wenn sie beständig erscheinen
und wenn sie recht auffällig sind.
Die Illustrationen, mit denen gewisse Firmen heutzutage
in Deutschland ihre Inserate, sogenannte „dekorierte Inserate",
ausstatten, sind vornehmer, besser und künstlerischer als die
textlichen Illustrationen in vielen Ilnterhaltungsblättern des
Auslandes.
Allerdings wurde dieser Art von Inserenten dadurch eine
große Unterstützung zu teil, daß die belletristischen Blätter,
die Wochen- und Monatsschriften, einen außerordentlichen
Aufschwung nahmen. Diese gut redigierten, künstlerisch schön
ausgestatteten Blätter vermehrten zumeist in überraschender
Weise ihre Abonnentenzahl, damit aber zugleich ihren Leser-
kreis. Sie werden meist in Familien gelesen und auf jeden
Abonnenten kommen durchschnittlich gerechnet vier andere Per-
sonen, die das Blatt gleichzeitig iesen. In den öffentlichen
Lokalen sind die Monats- und Wochenschriften außerordent-
lich stark begehrt und hier kommen auf ein Exemplar hundert
und mehr Leser. Durch die Lesezirkel findet ebenfalls eine
außerordentliche Verbreitung dieser Schriften statt und ein
Exemplar wird hier von mindestens zwanzig Personen, wenn
nicht mehr, gelesen. Ja, man kann behaupten, dis Teilnehmer
der Lesezirkel und die Besucher der öffentlichen Lokale lesen
nicht nur diese Blätter, sondern sie studieren sie vollständig
durch. Es ist daher nicht zu viel behauptet, wenn man an-
nimmt, daß auf ein Exemplar dieser illustrierten Wochen-
und Monatsschriften dreißig bis vierzig Leser kommen.
Die Inserate in einer Wochen- oder Monatsschrift, welche
die gleiche Auflage hat, wie irgend eine beliebte Tageszeitung,
müssen also dreißig- bis vierzigmal so stark wirken, als die
Annoncen in den täglich erscheinenden Zeitungen.
Auch weitverbreitete, in regelmäßigen Zwischenräumen er-
scheinende gebundene Bücher werden neuerdings mit
Vorliebe von verständigen Inserenten benutzt, denn hier
wirken die Inserate naturgemäß besonders nachhaltig und
intensiv. Gebundene Bücher wirft inan nicht weg, nach-
dem man sie gelesen hat, man bewahrt sie auf, legt sich da-
mit eine Bibliothek an, zu der man immer wieder greift, aus
der man gern an Freunde und Bekannte Bände ausleiht.
Text und Illustrationen bieten immer wieder willkommene
Unterhaltung. Daß natürlich dann auch die Inserate durch-
blättert und gelesen werden, welche durch die künstlerische
Ausstattung und die hübschen Illustrationen an und für sich
eine Sehenswürdigkeit sind, ist selbstverständlich, und so wirkt
ein Inserat in einem oftgelesenen Bande nicht nur wochen-
und monatelang, nein sogar nach Jahren noch ist seine
Wirkung nicht erloschen. A. O. Klaußiuann.
Gin Nciimenfreund. — Der Großherzog Karl August
von Weimar hatte eine ausgeprägte Vorliebe für die Blumen.
Wie diese Neigung entstand, erzählt folgendes schöne Ge-
schichtchen.
Der Oberhofprediger Röhr pflegte zur Sommerzeit, wenn
er am Sonntag zu predigen hatte, den Sonnabend in der
Frühe nach Belvedere hinaus zu gehen, um im dortigen
Parke, von morgenlicher Stille begünstigt und erhoben,
seine Predigt zu überdenken. So hatte er sich auch einmal
ergangen und schickte sich eben wieder zum Heimwege an,
als er in der Nähe der Gewächshäuser dem Großherzoge be-
gegnete, der ihn freundlich ansprach und sofort einlud,
falls er Zeit habe, mit ihm zu frühstücken. Röhr nimmt die
Einladung an und der Großherzog befiehlt, in einem der
Gewächshäuser zu servieren. ' Unterdessen führt er seinen
Gast im Blumengarten umher und durch die Glashäuser,
macht ihn auf die interessantesten Pflanzen aufmerksam, nennt
jede bei ihrem wissenschaftlichen Namen und giebt eine Be-
schreibung davon, wie sie einem Professor der Botanik Ehre
gemacht hätte.
Röhr hört erstaunt zu, und als man sich endlich zum
Frühstück setzt, sagt er: „Daß königliche Hoheit ein Freund
und Liebhaber der Botanik sind, ist allgemein bekannt; daß
Sie aber eine so ausgebreitete und eingehende Kenntnis
dieser Wissenschaft besitzen, das hätte ich mir nicht träumen
lassen. Was hat Sie nur zu so strengem Studium derselben
geführt?"
„Mein lieber Röhr," antwortete der Großherzog, „das
will ich Ihnen sagen. Als im Jahre tdOl> das große Un-
glück über unser Vaterland kam und ich ringsum so viele
Untreue, Verrat und Betrug sah, da bin ich an der Mensch
heit verzweifelt. Und da hat mich allein die alte Liebe zur
Natur aufrecht erhalten, und ich habe mich in sie versenkt.
Und da mich die Menschen anekelten, bin ich zu den Pflan-
zen gegangen, habe sie studiert und habe mit den Blumen
verkehrt, und — die Blumen haben mich nicht betrogen." 6-
Aämifche Aieustmädcheu. — In Nom erstreckt-sich die
DienstbotennotNnehr auf eü>. Qualität, als auf die Quanti-
tät, das heißt: es sind Mädchen genug zu haben, aber . . .
sie sind auch danach. .
Die Mädchen kommen meist aus Kalabrien, Apulien uns
aus der Campagna. VermietungsänUcr «ffebt cs nicht.
Alan erkundigt sich bei seinem Bäcker oder Schlächter nach
einem Mädchen und hier erfährt mau gewöhnlich ststa-u
Adresse eines solchen, das d'rekt van außerhalb komnu mm
Das Buch fü r A l l e.
Heft 2.
Alice lachte und eilte voraus, um den Anfang der
Probe nicht zu verpassen. Felicia, nicht im stände, sich
von dein für sie so begeisternde!: Anblick zu trennen,
blieb noch einige Minuten vor dem Schaufenster stehen.
„Die Brosche ist auch wirklich schön," sagte plötzlich
eine Stimme hinter ihr.
Verlegen schaute sie sich nach dein Sprecher um.
Dieser, ein elegant gekleideter Herr, lächelte freundlich
und fuhr, sich höflich verneigend, fort: „Ich habe,
wenn ich nicht irre, die Ehre, mit einer Künstlerin zu
sprechen?"
„Felicia Beckers ist mein Name. Woher aber missen
Sie —?"
„Ich war unfreiwilliger Zeuge Ihrer Unterhaltung;
die Damen haben mich in ihrem Eifer nicht bemerkt.
Ich stand hinter Ihnen. Ich bin sozusagen Kollege,
mein Fräulein — John Speekes, Spiritist und Ge-
dankenleser."
Felicia neigte leicht das schöne Haupt. Ein Ge-
dankenleser — ein Spiritist — pah! Mit kurzem
Gruße wollte sie sich entfernen. Aber der Fremde hielt
sie zurück.
„Verzeihen Sie eine Frage. Wenn ich recht ge-
hört habe, erscheint Ihnen der Besitz dieses Schmuck-
stückes im höchsten Grade erstrebenswert?"
In den Augen der Schauspielerin blitzte es auf.
„Warum foll ich es leugnen? Sie haben es ja gehört."
„Darf ich mir erlauben, Ihnen dasselbe anzubieten?"
Sie sah ihn erstaunt, fast 'starr an. „Sie wollen
mir die Brosche schenken?"
Der Fremde schüttelte lächelnd den Kopf. „Nicht
schenken, sondern verkaufen. Mir ist nämlich soeben
eine Idee gekommen, die mir der Ausführung wert
erscheint, und Künstler können doch einander unter-
stützen. — Erlauben Sie mir, Sie einige Schritte zu
begleiten?"
„Bitte."
Was die beiden auf dem gemeinsamen Wege mit-
einander verhandelten, hat niemand erfahren.
Und nun das Nachspiel.
Eine halbe Stunde nach der Entdeckung des Diebes
im Konzertsaal finden wir Speekes, Felicia Reckers,
den Polizisten und— den ertappten Dieb in vertraulicher
Unterredung in einem Separatzimmer eines Hotel-
restaurants.
Der Gedankenleser reicht der Schauspielerin soeben
mit vergnügter Miene die Hand, indem er verbindlich
bemerkt: „Meine Gnädige, Sie haben Ihre Sache vor-
trefflich gemacht und das Schmuckstück redlich verdient."
„O, Künstler müssen einander behilflich sein," ent-
gegnete diesmal die junge Dame.
„Und hier," wendet sich der Gedankenleser an den
Polizisten, „ist Ihr Honorar. Und hier das Ihre,
Alfred," sagt er zu dem angeblichen Diebe. „Ich habe
es reichlich bemessen, denn unsere wirkungsvolle Re-
klame wird mir meine Auslagen zehnfach ersetzen. Ihr
falscher Bart und Ihre Perücke, lieber Alfred, haben
Sie übrigens so gänzlich verändert, daß ich selbst kaum
meinen stotten Gehilfen wiedererkannt hätte."
„Nun, man lernt doch etwas bei Ihnen," ruft der
Pseudospitzbube lachend.
„Also, meine Herrschaften," schließt der Gedanken-
leser mit bedeutungsvollem Blicke gegen seine Ver-
bündeten, „jetzt habe ich Sie nur noch um strengste
Verschwiegenheit zu bitten. Und nun wollen wir ein
paar Flaschen Champagner zur Feier des prächtigen
Gelingens dieses Geniestreiches leeren."
(Nachdruck verboten.)
Der Friseur der Kaiserin Kugenie. — Jin Jahre
1856 wohnte am Madeleineplatz in Paris ein geschickter
Damenfriseur, Namens Leroi, der unablässig darüber nach-
sann, wie er sich in seinem Berufe besonders auszeichnen
könne, um seinen sämtlichen Kollegen den Rang abzulausen.
Lange wollte ihm nichts einfallen, aber endlich kam ihm ein
günstiger Zufall zu Hilfe.
Er hatte einige Kundinnen von hohem Adel, darunter
auch eine Gräfin M., die bei der Kaiserin Eugenie sehr in
Gunst stand. Als er nun eines Tages im Vorzimmer bei
dieser wartete, vernahm er ziemlich deutlich, ww sm Neben-
zimmer die Gräfin halblaut zu ihrer Kammerfrau sagte:
„Nun muß ich also noch eine Stunde unter den Händen
Ler-m c.ushalten. Es ist är^rlich, Louison, daß Sie nicht
ordentlich zll festeren Perstehen."
„O, ich kann es wohl," versetzte die Zofe.
„Aber lange nicht so gut," warf die Gebieterin ein.
„Das ist schon richtig, gnädige Frau. Es giebt über-
haupt in keinem vornehmen Hause irgend eine Kammerfrau,
die so vortrefflich zu frisieren versteht wie ein Damenfriseur.
Die Herren haben auch solches Geschäft eben ganz und gar
zu ihrem Lebensstudium gemacht und dadurch nach und nach
die erstaunlichste Geschicklichkeit erlangt."
„So ist es freilich," antwortete seufzend die Gräfin,
„und deshalb sehen wir uns also gezwungen, diese Leute
mit ihren Händen, mit denen sie vorher irgend eine andere
Person frisiert haben, in unseren Haaren umherwühlen und
arbeiten zu lassen."
Dies kurze Gespräch, welches zu belauschen ihm vom
gütigen Schicksal vergönnt war, erleuchtete wie ein zündender
Blitzstrahl plötzlich den erfinderischen Geist Lerois.
Er wurde dann ins Toilettezimmer gerufen und frisierte
mit seiner vollendeten Meisterschaft die Gräfin aufs Schönste
und Zierlichste. Sie erklärte ihm lächelnd, nachdem sie sich
im Spiegel besehen, daß sie mit seiner Leistung sehr zu-
frieden sei.
„Das nächste Mal wird sie sicherlich noch viel zufrie-
dener sein," dachte der Haarkünstler, als er sie verließ und
noch am selben Tage kaufte er einige Dutzend Paar der
feinsten und weichsten gelben Glacehandschuhe. Gelb war
damals nämlich gerade für Handschuhe die Modefarbe.
Schon nach einer Woche mußte er abermals die Gräfin
frisieren für irgend eine Festlichkeit. Da zog er, als er die
Arbeit beginnen wollte, dazu ein Paar ganz neue gelbe Glace-
handschuhe an und frisierte mit diesen an den Händen die
Gräfin ebenso geschickt wie sonst.
„Ei, das ist ja ganz etwas Neues!" rief diese überrascht.
„Gnädige Fran," versetzte er, „ich habe das ausgedacht,
weil ich anzunehmen Grund habe, daß es für die Damen
so passender und angenehmer ist."
„Sie sind ein Genie, Herr Leroi! Mit solchen ausgezeich-
neten Ideen müssen Sie unfehlbar Ihr Glück machen."
Bei seinen anderen vornehmen Kundinnen machte er es
ebenso. Jedesmal benutzte er ein Paar ganz neue Hand-
schuhe dazu, welche die Damen ihm natürlich mitbezahlen
mußten, was sie auch ganz gerne thaten. Auch die Kaiserin
Eugenie erfuhr von der Neuerung. Sie ließ ihn kommen,
sich von seinen behandschuhten Händen frisieren, und er-
nannte ihn dann zu ihrem Hoffriseur, so außerordentlich zu-
frieden war sie mit ihm. Fortan hatte er ihre schönen Haare
Arljr. Wumm u. Schwarzenstein,
du iieucuinnnte tuploumtstche ^erUen^du ^eutschcu Nuchu m China.
beständig unter seiner künstlerischen Obhut. Reiste sie nach
Compiögne, nach Biarritz oder sonst wohin, so mußte er sie
begleiten. Er bezog ein hohes Gehalt, verdiente überhaupt
sehr viel Geld. Interessant wäre es zu erfahren, ob dis Ex-
kaiserin noch jetzt ihre Haare nur mit Handschuhen be-
rühren läßt. F. L.
Modernes Inserieren. — Der vor kurzem gestorbene
Oberstlidienrat v. Dillmann hat sich in einer beachtenswerten
Schrift über die Bedeutung der Presse für die Geschäftswelt
in folgender Weise verbreitet:
„Das gesprochene Wort hat ganz besondere Vorzüge: der
Klang, der Ton, die Gebärden können durch nichts ersetzt
werden; aber es hat auch eine sehr beschränkte Tragweite. Das
Mittel, um die Tragweite des Wortes zu vergrößern, bietet
die Presse. Durch sie erweitert sich der Kreis der Hörer zum
Kreise der Leser. Das vornehmste Mittel, das Angebot in
weitere Kreise zu tragen, ist daher die gedruckte Anzeige,
das Inserat.
Einem Volke wie dem deutschen, in dem die Sch eil,
sein Innerstes zu enthüllen, so tief sitzt, das
aus angeborener Schüchternheit oft genug als unbeholfen
verschrieen wnrde — einem solchen Volke darf das Wort, das
nirgends mehr gilt als im Handel: „Nur das ist der Mann,
was er aus sich selbst macht," zugerufen werden. Fern sei es,
die plumpe Zudringlichkeit, die lügnerische und verleumderische
Aüpt'cisungsweise, die Geschrei: und Tamtamreklame zu em-
pfehlen. Aber etwM? weniger Schüchternheit, etwas mehr
Mut, aus sich herauszuge^.' und seine Ware von der gnten
und soliden Seite der Welt vor Aua-m zu stellen, daS dürfte
doch manchem deutschen Geschäftsmanns zn raten sein."^
Nun, die deutsche Geschäftswelt hat neuerdings einsehen
gelernt, daß mit den alten Grundsätzen und Prinzipien des
früheren, kleinen Geschäftswesens gebrochen werden mnß; das
Inserat lernt anch bei uns allmählich seine Wichtigkeit er-
kennen.
Sich fern haltend von der Marktschreierei und Schwindel-
hastigkeit, zeichnet sich das deutsche Jnseratenwesen aus durch
Kunstsinn und Zielbewußtsein. Es steckt dem Deutschen nun
einmal im Blute, alles gründlich zu machen und auch an
die Dinge des praktischen Lebens mit wissenschaftlichem Ernst
heranzugehcn. In der That hat man das Inserieren in
Deutschland zu einer Wissenschaft und zu einer Kunst ge-
macht, und in Bezug auf Vornehmheit, künstlerische Aus-
stattung und Solidität bei aller Großartigkeit kommt kaum
die Geschäftswelt eines anderen Staates der deutschen gleich.
Längst verschwunden ist das Vorurteil, daß ein großer Kauf-
mann mit weitverbreiteter, sicherer Kundschaft überhaupt nicht
zu inserieren braucht. Man wird heute den Kaufmann
verlachen, der noch vor dreißig Jahren sagen durfte: „Mein
Geschäft ist zu groß und zu vornehm, ais daß ich inserieren
müßte." Die Geschäftsleute, die dieser Ansicht huldigten, sind
überflügelt, von der Konkurrenz zu Boden getreten worden,
und das Eingehen vieler alter, eingesessener Firmen, das
man in den letzten Jahren in den verschiedensten Orten
Deutschlands beobachten konnte, ist zum größten Teil darauf
zurückzuführen, daß diese Leute nicht mit der Zeit gingen,
daß sie sich nicht entschließen konnten, eine zweckentsprechende
und geschickte Reklame zu machen, mit welcher die Konkurrenz
vorging. Heutzutage inseriert jedes Geschäft, und zwar um
so mehr, je größer es ist, und die Praxis hat es gelehrt,
daß Inserate nur Wert haben, wenn sie beständig erscheinen
und wenn sie recht auffällig sind.
Die Illustrationen, mit denen gewisse Firmen heutzutage
in Deutschland ihre Inserate, sogenannte „dekorierte Inserate",
ausstatten, sind vornehmer, besser und künstlerischer als die
textlichen Illustrationen in vielen Ilnterhaltungsblättern des
Auslandes.
Allerdings wurde dieser Art von Inserenten dadurch eine
große Unterstützung zu teil, daß die belletristischen Blätter,
die Wochen- und Monatsschriften, einen außerordentlichen
Aufschwung nahmen. Diese gut redigierten, künstlerisch schön
ausgestatteten Blätter vermehrten zumeist in überraschender
Weise ihre Abonnentenzahl, damit aber zugleich ihren Leser-
kreis. Sie werden meist in Familien gelesen und auf jeden
Abonnenten kommen durchschnittlich gerechnet vier andere Per-
sonen, die das Blatt gleichzeitig iesen. In den öffentlichen
Lokalen sind die Monats- und Wochenschriften außerordent-
lich stark begehrt und hier kommen auf ein Exemplar hundert
und mehr Leser. Durch die Lesezirkel findet ebenfalls eine
außerordentliche Verbreitung dieser Schriften statt und ein
Exemplar wird hier von mindestens zwanzig Personen, wenn
nicht mehr, gelesen. Ja, man kann behaupten, dis Teilnehmer
der Lesezirkel und die Besucher der öffentlichen Lokale lesen
nicht nur diese Blätter, sondern sie studieren sie vollständig
durch. Es ist daher nicht zu viel behauptet, wenn man an-
nimmt, daß auf ein Exemplar dieser illustrierten Wochen-
und Monatsschriften dreißig bis vierzig Leser kommen.
Die Inserate in einer Wochen- oder Monatsschrift, welche
die gleiche Auflage hat, wie irgend eine beliebte Tageszeitung,
müssen also dreißig- bis vierzigmal so stark wirken, als die
Annoncen in den täglich erscheinenden Zeitungen.
Auch weitverbreitete, in regelmäßigen Zwischenräumen er-
scheinende gebundene Bücher werden neuerdings mit
Vorliebe von verständigen Inserenten benutzt, denn hier
wirken die Inserate naturgemäß besonders nachhaltig und
intensiv. Gebundene Bücher wirft inan nicht weg, nach-
dem man sie gelesen hat, man bewahrt sie auf, legt sich da-
mit eine Bibliothek an, zu der man immer wieder greift, aus
der man gern an Freunde und Bekannte Bände ausleiht.
Text und Illustrationen bieten immer wieder willkommene
Unterhaltung. Daß natürlich dann auch die Inserate durch-
blättert und gelesen werden, welche durch die künstlerische
Ausstattung und die hübschen Illustrationen an und für sich
eine Sehenswürdigkeit sind, ist selbstverständlich, und so wirkt
ein Inserat in einem oftgelesenen Bande nicht nur wochen-
und monatelang, nein sogar nach Jahren noch ist seine
Wirkung nicht erloschen. A. O. Klaußiuann.
Gin Nciimenfreund. — Der Großherzog Karl August
von Weimar hatte eine ausgeprägte Vorliebe für die Blumen.
Wie diese Neigung entstand, erzählt folgendes schöne Ge-
schichtchen.
Der Oberhofprediger Röhr pflegte zur Sommerzeit, wenn
er am Sonntag zu predigen hatte, den Sonnabend in der
Frühe nach Belvedere hinaus zu gehen, um im dortigen
Parke, von morgenlicher Stille begünstigt und erhoben,
seine Predigt zu überdenken. So hatte er sich auch einmal
ergangen und schickte sich eben wieder zum Heimwege an,
als er in der Nähe der Gewächshäuser dem Großherzoge be-
gegnete, der ihn freundlich ansprach und sofort einlud,
falls er Zeit habe, mit ihm zu frühstücken. Röhr nimmt die
Einladung an und der Großherzog befiehlt, in einem der
Gewächshäuser zu servieren. ' Unterdessen führt er seinen
Gast im Blumengarten umher und durch die Glashäuser,
macht ihn auf die interessantesten Pflanzen aufmerksam, nennt
jede bei ihrem wissenschaftlichen Namen und giebt eine Be-
schreibung davon, wie sie einem Professor der Botanik Ehre
gemacht hätte.
Röhr hört erstaunt zu, und als man sich endlich zum
Frühstück setzt, sagt er: „Daß königliche Hoheit ein Freund
und Liebhaber der Botanik sind, ist allgemein bekannt; daß
Sie aber eine so ausgebreitete und eingehende Kenntnis
dieser Wissenschaft besitzen, das hätte ich mir nicht träumen
lassen. Was hat Sie nur zu so strengem Studium derselben
geführt?"
„Mein lieber Röhr," antwortete der Großherzog, „das
will ich Ihnen sagen. Als im Jahre tdOl> das große Un-
glück über unser Vaterland kam und ich ringsum so viele
Untreue, Verrat und Betrug sah, da bin ich an der Mensch
heit verzweifelt. Und da hat mich allein die alte Liebe zur
Natur aufrecht erhalten, und ich habe mich in sie versenkt.
Und da mich die Menschen anekelten, bin ich zu den Pflan-
zen gegangen, habe sie studiert und habe mit den Blumen
verkehrt, und — die Blumen haben mich nicht betrogen." 6-
Aämifche Aieustmädcheu. — In Nom erstreckt-sich die
DienstbotennotNnehr auf eü>. Qualität, als auf die Quanti-
tät, das heißt: es sind Mädchen genug zu haben, aber . . .
sie sind auch danach. .
Die Mädchen kommen meist aus Kalabrien, Apulien uns
aus der Campagna. VermietungsänUcr «ffebt cs nicht.
Alan erkundigt sich bei seinem Bäcker oder Schlächter nach
einem Mädchen und hier erfährt mau gewöhnlich ststa-u
Adresse eines solchen, das d'rekt van außerhalb komnu mm