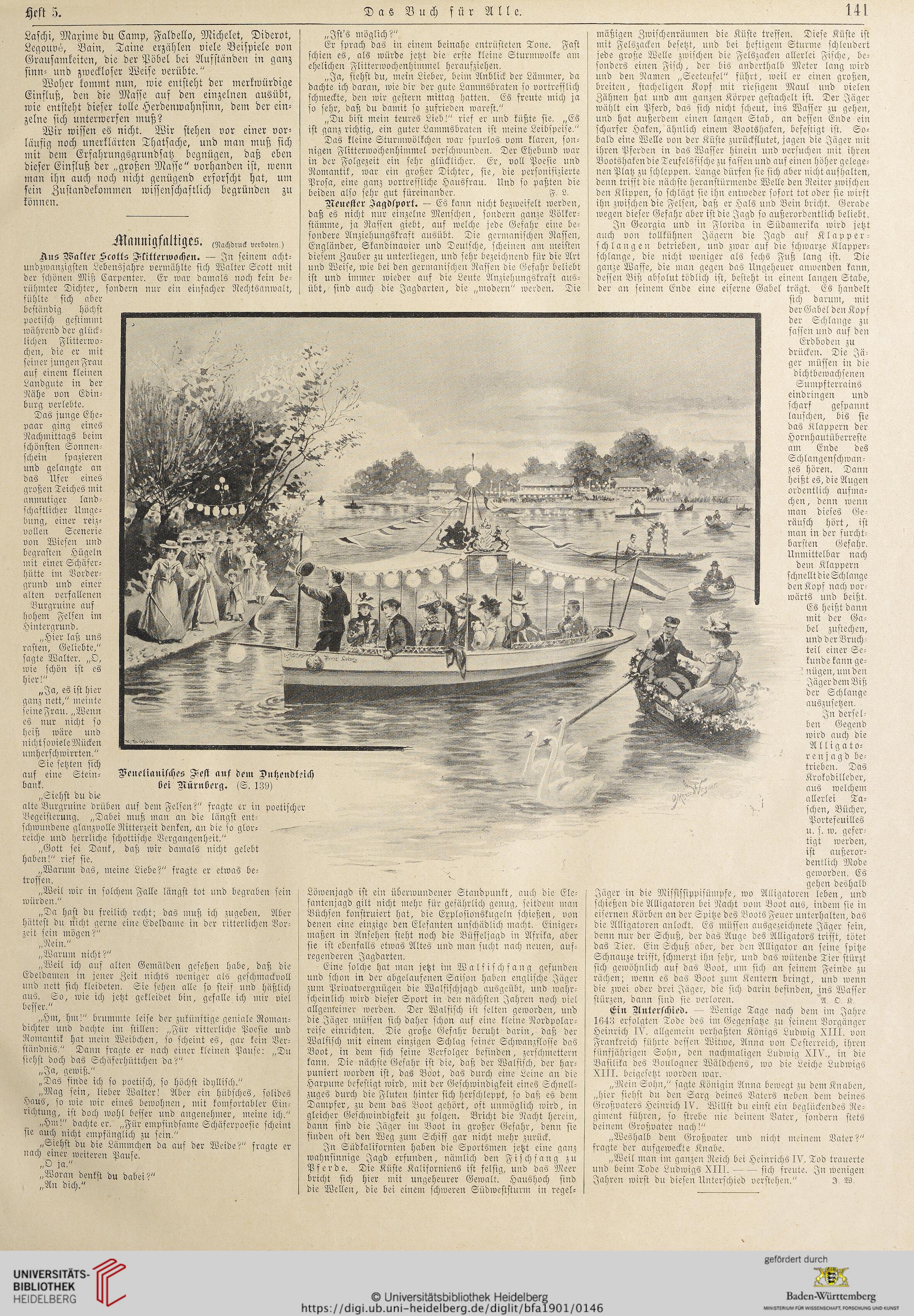Heft 5.
Das Buch für Alle.
14l
Laschi, Maxime du Camp, Faldello, Michelet, Diderot,
Legouvä, Bain, Taine erzählen viele Beispiele von
Grausamkeiten, die der Pöbel bei Ausständen in ganz
sinn- und zweckloser Weise verübte."
Woher kommt nun, wie entsteht der merkwürdige
Einfluß, den die Masse auf den einzelnen ausübt,
wie entsteht dieser tolle Herdenwahnfinn, dem der ein-
zelne sich unterwerfen muß?
Wir wissen es nicht. Wir stehen vor einer vor-
läufig noch unerklärten Thatsache, und man muß sich
mit dem Erfahrungsgrundsatz begnügen, daß eben
dieser Einfluß der „großen Masse" vorhanden ist, wenn
man ihn auch noch nicht genügend erforscht hat, um
sein Zustandekommen wissenschaftlich begründen zu
können.
l^fü!tlls^§. (Nachdruck verboten )
Ans Walter Scotts Illilterivochen. — In seinen: acht-
undzwanzigsten Lebensjahre vermählte sich Walter Scott mit
der schönen Miß Carpenter. Er war damals noch kein be-
rühmter Dichter, sondern nur ein einfacher Rechtsanwalt,
fühlte sich aber
beständig höchst
poetisch gestimmt
während der glück-
lichen Flitterwo-
chen, die er mit
seiner jungen Frau
auf einem kleinen
Landgute in der
Nähe von Edin-
burg verlebte.
Das junge Ehe-
paar ging eines
Nachmittags beim
schönsten Sonnen-
schein spazieren
und gelangte an
das Ufer eines
großen Teiches mit
anmutiger land-
schaftlicher Hinge-
bung, einer reiz-
vollen Scenerie
von Wiesen und
begrasten Hügeln
mit einer Schäfer-
hütte im Vorder-
grund und einer-
alten verfallenen
Burgruine auf
hohem Felsen im
Hintergrund.
„Hier laß uns
rasten, Geliebte,"
sagte Walter. „O,
wie schön ist es
hier!"
„Ja, es ist hier-
ganz nett," meinte
seineFrnu. „Wenn
es nur nicht so
heiß wäre und
nichtsovieleMücken
umherschwirrten."
Sie setzten sich
auf eine Stein-
bank.
„Siehst du die
alte Burgruine drüben auf dem Felsen?" fragte er in poetischer
Begeisterung. „Dabei muß man an die längst ent-
schwundene glanzvolle Nitterzeit denken, an die so glor- . -
reiche und herrliche schottische Vergangenheit."
„Gott sei Dank, daß wir damals nicht gelebt
haben!" rief sie.
„Warum das, meine Liebe?" fragte er etwas be-
troffen.
„Weit wir in solchem Falle längst tot und begraben sein
würden."
„Da hast du freilich recht; das muß ich zugeben. Aber
hättest du nicht gerne eine Edeldame in der ritterlichen Vor-
zeit sein mögen?"
„Nein."
„Warum nicht?"
„Weil ich auf alten Gemälden gesehen habe, daß die
Edeldamen in jener Zeit nichts weniger als geschmackvoll
und nett sich kleideten. Sie sehen alle so steif und häßlich
aus. So, wie ich jetzt gekleidet bin, gefalle ich mir viel
besser."
„Hm, hm!" brummte leise der zukünftige geniale Roman-
dichter und dachte im stillen- „Für ritterliche Poesie und
Romantik hat mein Weibchen, so scheint es, gar kein Ver-
ständnis." Dann fragte er nach einer kleinen Pause: „Du
siehst doch das Schäferhüttchen da?"
„Ja, gewiß."
„Das finde ich so poetisch, so höchst idyllisch."
„Mag sein, lieber Walter! Aber ein hübsches, solides
Haus, so wie wir eines bewohnen, mit komfortabler Ein-
richtung, ist doch wohl besser und angenehmer, meine ich."
„Hm!" dachte er. „Für empfindsame Schäferpoesie scheint
sie auch nicht empfänglich zu sein."
„Siehst du die Lämmchen da auf der Weide?" fragte er
uach Uner weiteren Pause.
„Woran denkst du dabei?"
„An dich."
„Jst's möglich?"
Er sprach das in einein beinahe entrüsteten Tone. Fast
schien es, als würde jetzt die erste kleine Sturmwolke an:
ehelichen Flitterwochenhimmel Heraufziehen.
„Ja, siehst du, mein Lieber, beim Anblick der Lämmer, da
dachte ich daran, wie dir der gute Lammsbraten so vortrefflich
schmeckte, dei: wir gestern mittag hatten. Es freute mich ja
so sehr, daß du damit so zufrieden wärest."
„Du bist mein teures Lieb!" rief er und küßte sie. „Es
ist ganz richtig, ein guter Lammsbraten ist meine Leibspeise."
Das kleine Sturmwölkchen war spurlos vom klaren, son-
nigen Flitterwochenhimmel verschwunden. Der Ehebund war
in der Folgezeit ein sehr glücklicher. Er, voll Poesie und
Romantik, war ein großer Dichter, sie, die personifizierte
Prosa, eine ganz vortreffliche Hausfrau. Und so paßten dis
beiden also sehr gut füreinander. F. L.
Neuester Jagdsport. — Es kann nicht bezweifelt werden,
daß es nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker-
stämme, ja Rassen giebt, auf welche jede Gefahr eine be-
sondere Anziehungskraft ausübt. Die germanischen Rassen,
Engländer, Skandinavier und Deutsche, scheinen am meisten
diesem Zauber zu unterliegen, und sehr bezeichnend für die Art
und Weise, wie bei den germanischen Nassen die Gefahr beliebt
ist und immer wieder auf die Leute Anziehungskraft aus-
übt, sind auch die Jagdarten, die „modern" werden. Die
Löwenjagd ist ein überwundener Standpunkt, auch die Ele-
fantenjagd gilt nicht mehr für gefährlich genng, seitdem man
Büchsen konstruiert hat, die Explosionskugeln schießen, von
denen eine einzige den Elefanten unschädlich macht. Einiger-
maßen in Ansehen steht noch die Büffeljagd in Afrika, aber
sie ist ebenfalls etwas Altes und man sucht nach neuen, auf-
regenderen Jagdarten.
Eine solche hat inan jetzt in: Walfischfang gefunden
und schon in der abgelaufenen Saison Habei: englische Jäger
zum Privatvergnügen die Walfischjagd ausgeübt, und wahr-
scheinlich wird dieser Sport in den nächsten Jahren noch viel
allgemeiner werden. Der Walsisch ist selten geworden, und
die Jäger müssen sich daher schon auf eine kleine Nordpolar-
reise einrichten. Die große Gefahr beruht darin, daß der
Walfisch mit einem einzigen Schlag seiner Schwanzflosse das
Boot, in den: sich seine Verfolger befinden, zerschmettern
kann. Die nächste Gefahr ist die, daß der Walfisch, der har-
puniert morden ist, das Boot, das durch eine Leine an die
Harpune befestigt wird, mit der Geschwindigkeit eines Schnell-
zuges durch die Fluten hinter sich herschleppt, so daß es dem
Dampfer, zu den: das Boot gehört, oft unmöglich wird, in
gleicher Geschwindigkeit zu folgen. Bricht die Nacht herein,
dann sind die Jäger im Boot in großer Gefahr, denn sie
finden oft den Weg zum Schiff gar nicht mehr zurück.
In Südkalifornien haben die Sportsmen jetzt eine ganz
wahnsinnige Jagd erfunden, nämlich den Fischfang zu
Pferde. Die Küste Kaliforniens ist felsig, und das Meer
bricht sich hier mit ungeheurer Gewalt. Haushoch find
die Wellen, die bei einem schweren Südweststurm in regel-
mäßigen Zwischenräumen die Küste treffen. Diese Küste ist
mit Felszacken besetzt, und bei heftigem Sturme schleudert
jede große Welle zwischen die Felszacken allerlei Fische, be-
sonders einen Fisch, der bis anderthalb Meter lang wird
und den Namen „Seeteufel" führt, weil er einen großen,
breiten, stacheligen Kopf mit riesigem Maul und vielen
Zähnen hat und am ganzen Körper gestachelt ist. Der Jäger
wählt ein Pferd, das sich nicht scheut, ins Wasser zu gehen,
und hat außerdem einen langen Stab, an dessen Ende ein
scharfer Haken, ähnlich einem Bootshaken, befestigt ist. So-
bald eine Welle von der Küste zurückflutet, jagen die Jäger mit
ihren Pferden in das Wasser hinein und versuche,: mit ihren
Bootshaken die Teufelsfische zu fassen und auf einen höher gelege-
nen Platz zu schleppen. Lange dürfen sie sich aber nicht aufhalten,
denn trifft die nächste heranstürmende Welle den Reiter zwischen
den Klippen, so schlägt sie ihn entweder sofort tot oder sie wirst
ihn zwischen die Felsen, daß er Hals und Bein bricht. Gerade
wegen dieser Gefahr aber ist die Jagd so außerordentlich beliebt.
In Georgia und in Florida in Südamerika wird jetzt
auch von tollkühnen Jägern die Jagd auf Klapper-
schlangen betrieben, und zwar auf die schwarze Klapper-
schlange, die nicht weniger als sechs Fuß lang ist. Die
ganze Waffe, die man gegen das Ungeheuer anwenden kann,
dessen Biß absolut tödlich ist, besteht in einen: langen Stabe,
der an seinem Ende eine eiserne Gabel trägt. Es handelt
sich darum, mit
der Gabel den Kopf
der Schlange zu
fassen und auf den
Erdboden zu
drücken. Die Jä-
ger müssen in die
dichtbewachfenen
Sumpfterrains
eindringen und
scharf gespannt
lauschen, bis sie
das Klappern der
Hornhautüberreste
am Ende des
Schlangenschwan-
zes hören. Dann
heißt es, die Augen
ordentlich aufma-
chen, denn wenn
man dieses Ge-
räusch hört, ist
man in der furcht-
barsten Gefahr.
Unmittelbar nach
den: Klappern
schnelltdieSchlange
den Kopf nach vor-
wärts und beißt.
Es heißt dann
mit der Ga-
bel zustechen,
und der Bruch-
teil einer Se-
kunde kann ge-
! nügen, um den
JägerdemBiß
der Schlange
auszusetzen.
In dersel-
ben Gegend
wird auch die
Alligato-
renjagd be-
trieben. Das
Krokodilleder,
aus welchem
allerlei Ta-
schen, Bücher,
Portefeuilles
u. s. w. gefer-
tigt werden,
ist außeror-
dentlich Mode
geworden. Es
gehen deshalb
Jäger in die Mississippisümpfe, wo Alligatoren leben, und
schießen die Alligatoren bei Nacht vom Boot aus, indem sie in
eisernen Körben an der Spitze des Boots Feuer unterhalten, das
die Alligatoren anlockt. Es müssen ausgezeichnete Jäger sein,
denn nur der Schuß, der das Auge des Alligators trifft, tötet
das Tier. Ein Schuß aber, der den Alligator an seine spitze
Schnauze trifft, schmerzt ihn sehr, und das wütende Tier stürzt
sich gewöhnlich auf das Boot, um sich an seinem Feinde zu
rächen; wenn es das Boot zum Kentern bringt, und wenn
die zwei oder drei Jäger, die sich darin befinden, ins Wasser-
stürzen, dann sind sie verloren. A. O. K.
Gin Unterschied. — Wenige Tage nach dem in: Jahre
1643 erfolgten Tode des in: Gegensätze zu seinen: Vorgänger-
Heinrich IV. allgemein verhaßten Königs Ludwig XIII. von
Frankreich führte dessen Witwe, Anna von Oesterreich, ihren
fünfjährigen Sohn, den nachmaligen Ludwig XIV., in die
Basilika des Boulogner Wäldchens, wo die Leiche Ludwigs
XIII. beigesetzt worden war.
„Mein Sohn," sagte Königin Anna bewegt zu dem Knaben,
„hier siehst du den Sarg deines Vaters neben dein deines
Großvaters Heinrich IV. Willst du einst ein beglückendes Re-
giment führen, so strebe nie deinen: Vater, sondern stets
deinem Großvater nach!"
„Weshalb dem Großvater und nicht meinem Vater?"
fragte der aufgeweckte Knabe.
„Weil man im ganzen Reich bei Heinrichs IV. Tod trauerte
und beim Tode Ludwigs XIII.-sich freute. In wenigen
Jahren wirst du diesen Unterschied verstehen." I. W.
Nenclianisches Kest aus dem Duhendteich
bei Nürnberg. (S. 139)
Das Buch für Alle.
14l
Laschi, Maxime du Camp, Faldello, Michelet, Diderot,
Legouvä, Bain, Taine erzählen viele Beispiele von
Grausamkeiten, die der Pöbel bei Ausständen in ganz
sinn- und zweckloser Weise verübte."
Woher kommt nun, wie entsteht der merkwürdige
Einfluß, den die Masse auf den einzelnen ausübt,
wie entsteht dieser tolle Herdenwahnfinn, dem der ein-
zelne sich unterwerfen muß?
Wir wissen es nicht. Wir stehen vor einer vor-
läufig noch unerklärten Thatsache, und man muß sich
mit dem Erfahrungsgrundsatz begnügen, daß eben
dieser Einfluß der „großen Masse" vorhanden ist, wenn
man ihn auch noch nicht genügend erforscht hat, um
sein Zustandekommen wissenschaftlich begründen zu
können.
l^fü!tlls^§. (Nachdruck verboten )
Ans Walter Scotts Illilterivochen. — In seinen: acht-
undzwanzigsten Lebensjahre vermählte sich Walter Scott mit
der schönen Miß Carpenter. Er war damals noch kein be-
rühmter Dichter, sondern nur ein einfacher Rechtsanwalt,
fühlte sich aber
beständig höchst
poetisch gestimmt
während der glück-
lichen Flitterwo-
chen, die er mit
seiner jungen Frau
auf einem kleinen
Landgute in der
Nähe von Edin-
burg verlebte.
Das junge Ehe-
paar ging eines
Nachmittags beim
schönsten Sonnen-
schein spazieren
und gelangte an
das Ufer eines
großen Teiches mit
anmutiger land-
schaftlicher Hinge-
bung, einer reiz-
vollen Scenerie
von Wiesen und
begrasten Hügeln
mit einer Schäfer-
hütte im Vorder-
grund und einer-
alten verfallenen
Burgruine auf
hohem Felsen im
Hintergrund.
„Hier laß uns
rasten, Geliebte,"
sagte Walter. „O,
wie schön ist es
hier!"
„Ja, es ist hier-
ganz nett," meinte
seineFrnu. „Wenn
es nur nicht so
heiß wäre und
nichtsovieleMücken
umherschwirrten."
Sie setzten sich
auf eine Stein-
bank.
„Siehst du die
alte Burgruine drüben auf dem Felsen?" fragte er in poetischer
Begeisterung. „Dabei muß man an die längst ent-
schwundene glanzvolle Nitterzeit denken, an die so glor- . -
reiche und herrliche schottische Vergangenheit."
„Gott sei Dank, daß wir damals nicht gelebt
haben!" rief sie.
„Warum das, meine Liebe?" fragte er etwas be-
troffen.
„Weit wir in solchem Falle längst tot und begraben sein
würden."
„Da hast du freilich recht; das muß ich zugeben. Aber
hättest du nicht gerne eine Edeldame in der ritterlichen Vor-
zeit sein mögen?"
„Nein."
„Warum nicht?"
„Weil ich auf alten Gemälden gesehen habe, daß die
Edeldamen in jener Zeit nichts weniger als geschmackvoll
und nett sich kleideten. Sie sehen alle so steif und häßlich
aus. So, wie ich jetzt gekleidet bin, gefalle ich mir viel
besser."
„Hm, hm!" brummte leise der zukünftige geniale Roman-
dichter und dachte im stillen- „Für ritterliche Poesie und
Romantik hat mein Weibchen, so scheint es, gar kein Ver-
ständnis." Dann fragte er nach einer kleinen Pause: „Du
siehst doch das Schäferhüttchen da?"
„Ja, gewiß."
„Das finde ich so poetisch, so höchst idyllisch."
„Mag sein, lieber Walter! Aber ein hübsches, solides
Haus, so wie wir eines bewohnen, mit komfortabler Ein-
richtung, ist doch wohl besser und angenehmer, meine ich."
„Hm!" dachte er. „Für empfindsame Schäferpoesie scheint
sie auch nicht empfänglich zu sein."
„Siehst du die Lämmchen da auf der Weide?" fragte er
uach Uner weiteren Pause.
„Woran denkst du dabei?"
„An dich."
„Jst's möglich?"
Er sprach das in einein beinahe entrüsteten Tone. Fast
schien es, als würde jetzt die erste kleine Sturmwolke an:
ehelichen Flitterwochenhimmel Heraufziehen.
„Ja, siehst du, mein Lieber, beim Anblick der Lämmer, da
dachte ich daran, wie dir der gute Lammsbraten so vortrefflich
schmeckte, dei: wir gestern mittag hatten. Es freute mich ja
so sehr, daß du damit so zufrieden wärest."
„Du bist mein teures Lieb!" rief er und küßte sie. „Es
ist ganz richtig, ein guter Lammsbraten ist meine Leibspeise."
Das kleine Sturmwölkchen war spurlos vom klaren, son-
nigen Flitterwochenhimmel verschwunden. Der Ehebund war
in der Folgezeit ein sehr glücklicher. Er, voll Poesie und
Romantik, war ein großer Dichter, sie, die personifizierte
Prosa, eine ganz vortreffliche Hausfrau. Und so paßten dis
beiden also sehr gut füreinander. F. L.
Neuester Jagdsport. — Es kann nicht bezweifelt werden,
daß es nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Völker-
stämme, ja Rassen giebt, auf welche jede Gefahr eine be-
sondere Anziehungskraft ausübt. Die germanischen Rassen,
Engländer, Skandinavier und Deutsche, scheinen am meisten
diesem Zauber zu unterliegen, und sehr bezeichnend für die Art
und Weise, wie bei den germanischen Nassen die Gefahr beliebt
ist und immer wieder auf die Leute Anziehungskraft aus-
übt, sind auch die Jagdarten, die „modern" werden. Die
Löwenjagd ist ein überwundener Standpunkt, auch die Ele-
fantenjagd gilt nicht mehr für gefährlich genng, seitdem man
Büchsen konstruiert hat, die Explosionskugeln schießen, von
denen eine einzige den Elefanten unschädlich macht. Einiger-
maßen in Ansehen steht noch die Büffeljagd in Afrika, aber
sie ist ebenfalls etwas Altes und man sucht nach neuen, auf-
regenderen Jagdarten.
Eine solche hat inan jetzt in: Walfischfang gefunden
und schon in der abgelaufenen Saison Habei: englische Jäger
zum Privatvergnügen die Walfischjagd ausgeübt, und wahr-
scheinlich wird dieser Sport in den nächsten Jahren noch viel
allgemeiner werden. Der Walsisch ist selten geworden, und
die Jäger müssen sich daher schon auf eine kleine Nordpolar-
reise einrichten. Die große Gefahr beruht darin, daß der
Walfisch mit einem einzigen Schlag seiner Schwanzflosse das
Boot, in den: sich seine Verfolger befinden, zerschmettern
kann. Die nächste Gefahr ist die, daß der Walfisch, der har-
puniert morden ist, das Boot, das durch eine Leine an die
Harpune befestigt wird, mit der Geschwindigkeit eines Schnell-
zuges durch die Fluten hinter sich herschleppt, so daß es dem
Dampfer, zu den: das Boot gehört, oft unmöglich wird, in
gleicher Geschwindigkeit zu folgen. Bricht die Nacht herein,
dann sind die Jäger im Boot in großer Gefahr, denn sie
finden oft den Weg zum Schiff gar nicht mehr zurück.
In Südkalifornien haben die Sportsmen jetzt eine ganz
wahnsinnige Jagd erfunden, nämlich den Fischfang zu
Pferde. Die Küste Kaliforniens ist felsig, und das Meer
bricht sich hier mit ungeheurer Gewalt. Haushoch find
die Wellen, die bei einem schweren Südweststurm in regel-
mäßigen Zwischenräumen die Küste treffen. Diese Küste ist
mit Felszacken besetzt, und bei heftigem Sturme schleudert
jede große Welle zwischen die Felszacken allerlei Fische, be-
sonders einen Fisch, der bis anderthalb Meter lang wird
und den Namen „Seeteufel" führt, weil er einen großen,
breiten, stacheligen Kopf mit riesigem Maul und vielen
Zähnen hat und am ganzen Körper gestachelt ist. Der Jäger
wählt ein Pferd, das sich nicht scheut, ins Wasser zu gehen,
und hat außerdem einen langen Stab, an dessen Ende ein
scharfer Haken, ähnlich einem Bootshaken, befestigt ist. So-
bald eine Welle von der Küste zurückflutet, jagen die Jäger mit
ihren Pferden in das Wasser hinein und versuche,: mit ihren
Bootshaken die Teufelsfische zu fassen und auf einen höher gelege-
nen Platz zu schleppen. Lange dürfen sie sich aber nicht aufhalten,
denn trifft die nächste heranstürmende Welle den Reiter zwischen
den Klippen, so schlägt sie ihn entweder sofort tot oder sie wirst
ihn zwischen die Felsen, daß er Hals und Bein bricht. Gerade
wegen dieser Gefahr aber ist die Jagd so außerordentlich beliebt.
In Georgia und in Florida in Südamerika wird jetzt
auch von tollkühnen Jägern die Jagd auf Klapper-
schlangen betrieben, und zwar auf die schwarze Klapper-
schlange, die nicht weniger als sechs Fuß lang ist. Die
ganze Waffe, die man gegen das Ungeheuer anwenden kann,
dessen Biß absolut tödlich ist, besteht in einen: langen Stabe,
der an seinem Ende eine eiserne Gabel trägt. Es handelt
sich darum, mit
der Gabel den Kopf
der Schlange zu
fassen und auf den
Erdboden zu
drücken. Die Jä-
ger müssen in die
dichtbewachfenen
Sumpfterrains
eindringen und
scharf gespannt
lauschen, bis sie
das Klappern der
Hornhautüberreste
am Ende des
Schlangenschwan-
zes hören. Dann
heißt es, die Augen
ordentlich aufma-
chen, denn wenn
man dieses Ge-
räusch hört, ist
man in der furcht-
barsten Gefahr.
Unmittelbar nach
den: Klappern
schnelltdieSchlange
den Kopf nach vor-
wärts und beißt.
Es heißt dann
mit der Ga-
bel zustechen,
und der Bruch-
teil einer Se-
kunde kann ge-
! nügen, um den
JägerdemBiß
der Schlange
auszusetzen.
In dersel-
ben Gegend
wird auch die
Alligato-
renjagd be-
trieben. Das
Krokodilleder,
aus welchem
allerlei Ta-
schen, Bücher,
Portefeuilles
u. s. w. gefer-
tigt werden,
ist außeror-
dentlich Mode
geworden. Es
gehen deshalb
Jäger in die Mississippisümpfe, wo Alligatoren leben, und
schießen die Alligatoren bei Nacht vom Boot aus, indem sie in
eisernen Körben an der Spitze des Boots Feuer unterhalten, das
die Alligatoren anlockt. Es müssen ausgezeichnete Jäger sein,
denn nur der Schuß, der das Auge des Alligators trifft, tötet
das Tier. Ein Schuß aber, der den Alligator an seine spitze
Schnauze trifft, schmerzt ihn sehr, und das wütende Tier stürzt
sich gewöhnlich auf das Boot, um sich an seinem Feinde zu
rächen; wenn es das Boot zum Kentern bringt, und wenn
die zwei oder drei Jäger, die sich darin befinden, ins Wasser-
stürzen, dann sind sie verloren. A. O. K.
Gin Unterschied. — Wenige Tage nach dem in: Jahre
1643 erfolgten Tode des in: Gegensätze zu seinen: Vorgänger-
Heinrich IV. allgemein verhaßten Königs Ludwig XIII. von
Frankreich führte dessen Witwe, Anna von Oesterreich, ihren
fünfjährigen Sohn, den nachmaligen Ludwig XIV., in die
Basilika des Boulogner Wäldchens, wo die Leiche Ludwigs
XIII. beigesetzt worden war.
„Mein Sohn," sagte Königin Anna bewegt zu dem Knaben,
„hier siehst du den Sarg deines Vaters neben dein deines
Großvaters Heinrich IV. Willst du einst ein beglückendes Re-
giment führen, so strebe nie deinen: Vater, sondern stets
deinem Großvater nach!"
„Weshalb dem Großvater und nicht meinem Vater?"
fragte der aufgeweckte Knabe.
„Weil man im ganzen Reich bei Heinrichs IV. Tod trauerte
und beim Tode Ludwigs XIII.-sich freute. In wenigen
Jahren wirst du diesen Unterschied verstehen." I. W.
Nenclianisches Kest aus dem Duhendteich
bei Nürnberg. (S. 139)