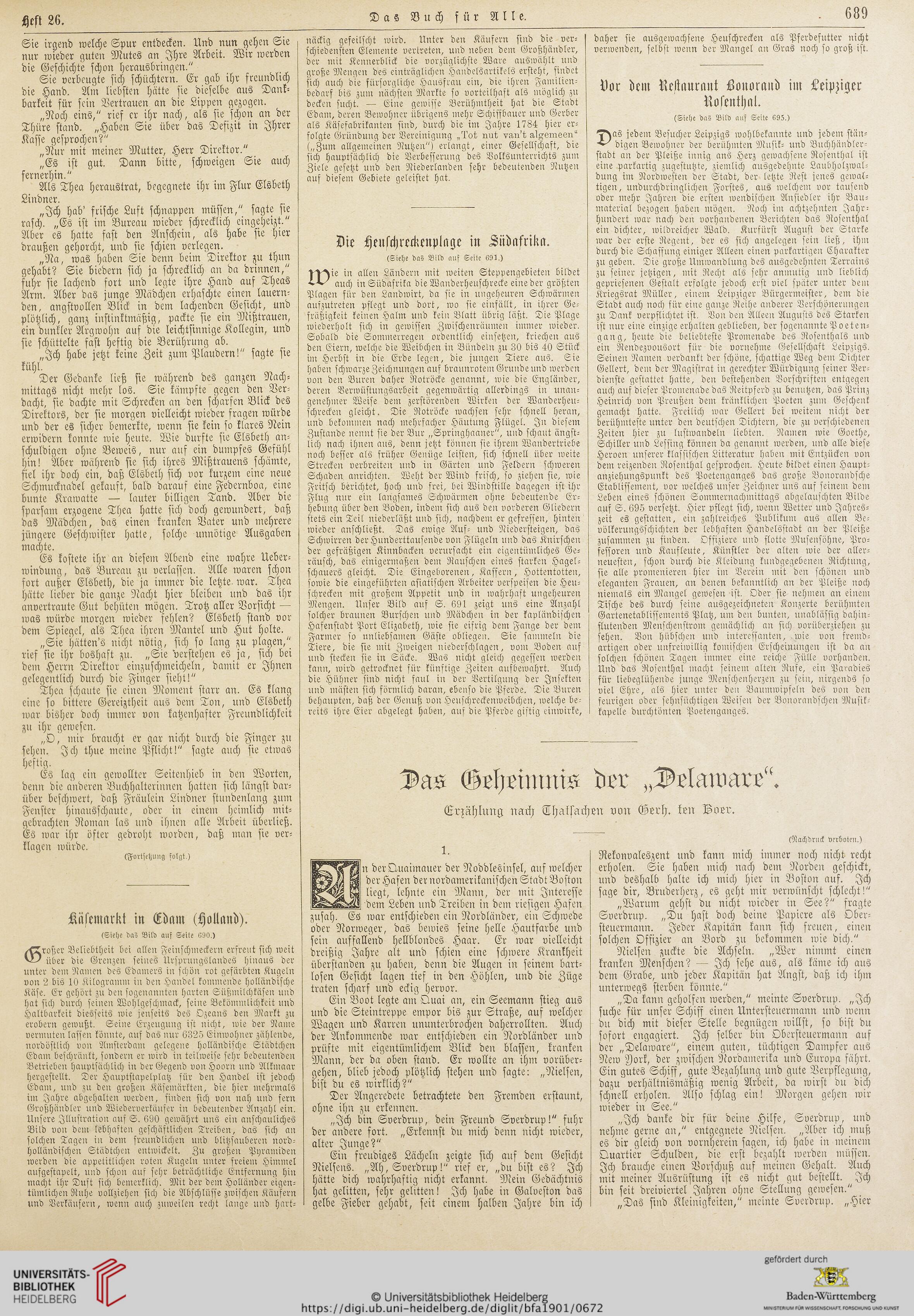Heft 26.
Sie irgend welche Spur entdecken. Und nun gehen Sie
nur wieder guten Mutes an Ihre Arbeit. Wir werden
die Geschichte schon herausbringen."
Sie verbeugte sich schüchtern. Er gab ihr freundlich
die Hand. Am liebsten hätte sie dieselbe aus Dank-
barkeit für sein Vertrauen an die Lippen gezogen.
„Noch eins," rief er ihr nach, als sie schon an der
Thüre stand. „Haben Sie über das Defizit in Ihrer
Kasse gesprochen?"
„Nur mit meiner Mutter, Herr Direktor."
„Es ist gut. Dann bitte, schweigen Sie auch
fernerhin."
Als Thea heraustrat, begegnete ihr im Flur Elsbeth
Lindner.
„Ich hab' frische Luft schnappen müssen," sagte sie
rasch. „Es ist im Bureau wieder schrecklich eingeheizt."
Aber es hatte fast den Anschein, als habe sie hier
draußen gehorcht, und sie schien verlegen.
„Na, was haben Sie denn beim Direktor zu thun
gehabt? Sie biedern sich ja schrecklich an da drinnen,"
fuh-r sie lachend fort und legte ihre Hand auf Theas
Arm. Aber das junge Mädchen erhaschte einen lauern-
den, angstvollen Blick in dem lachenden Gesicht, und
plötzlich, ganz instinktmäßig, packte sie ein Mißtrauen,
ein dunkler Argwohn auf die leichtsinnige Kollegin, und
sie schüttelte fast heftig die Berührung ab.
„Ich habe jetzt keine Zeit zum Plaudern!" sagte sie
kühl.
Der Gedanke ließ sie während des ganzen Nach-
mittags nicht mehr los. Sie kämpfte gegen den Ver-
dacht, sie dachte mit Schrecken an den scharfen Blick des
Direktors, der sie morgen vielleicht wieder fragen würde
und der es sicher bemerkte, wenn sie kein so klares Nein
erwidern konnte wie heute. Wie durfte sie Elsbeth an-
schuldigen ohne Beweis, nur auf ein dumpfes Gefühl
hin! Aber während sie sich ihres Mißtrauens schämte,
fiel ihr doch ein, daß Elsbeth sich vor kurzem eine neue
Schmucknadel gekauft, bald daraus eine Federnboa, eine
bunte Krawatte — lauter billigen Tand. Aber die
sparsam erzogene Thea hatte sich doch gewundert, daß
das Mädchen, das einen kranken Vater und mehrere
jüngere Geschwister hatte, solche unnötige Ausgaben
machte.
Es kostete ihr an diesem Abend eine wahre Ueber-
windung, das Bureau zu verlassen. Alle waren schon
fort außer Elsbeth, die ja immer die letzte, war. Thea
hätte lieber die ganze Nacht hier bleiben und das ihr
anvertraute Gut behüten mögen. Trotz aller Vorsicht —
was würde morgen wieder fehlen? Elsbeth stand vor
dem Spiegel, als Thea ihren Mantel und Hut holte.
„Sie hätten's nicht nötig, sich so lang zu plagen,"
rief sie ihr boshaft zu. „Sie verstehen es ja, sich bei
dem Herrn Direktor einzuschmeicheln, damit er Ihnen
gelegentlich durch die Finger sieht!"
Thea schaute sie einen Moment starr an. Es klang
eine so bittere Gereiztheit aus dem Ton, und Elsbeth
war bisher doch immer von katzenhaster Freundlichkeit
zu ihr gewesen.
„O, nur braucht er gar nicht durch die Finger zu
sehen. Ich thue meine Pflicht!" sagte auch sie etwas
heftig.
Es lag ein gewollter Seitenhieb in den Worten,
denn die anderen Buchhalterinnen hatten sich längst dar-
über beschwert, daß Fräulein Lindner stundenlang zum
Fenster hinausschaute, oder in einein heimlich mit-
gebrachten Roman las und ihnen alle Arbeit überließ.
Es ivar ihr öfter gedroht worden, daß man sie ver-
klagen würde.
(Fortsetzung folgt.)
Käsemarkt in Cdam (Holland).
(Stehe das Bild auf Seite 690.)
/großer Beliebtheit bei allen Feinschmeckern erfreut sich weit
über die Grenzen seines Ursprungslandes hinaus der
unter dem Namen des Edamers in schön rot gefärbten Kugeln
von 2 bis 10 Kilogramm in den Handel kommende holländische
Käse. Er gehört zu den sogenannten harten Süßmilchkäsen und
hat sich durch seinen Wohlgeschmack, seine Bekömmlichkeit und
Haltbarkeit diesseits wie jenseits des Ozeans den Markt zu
erobern gewußt. Seine Erzeugung ist nicht, wie der Name
vermuten lassen könnte, auf das nur 6325 Einwohner zählende,
nordöstlich von Amsterdam gelegene holländische Städtchen
Edam beschränkt, sondern er wird in teilweise sehr bedeutenden
Betrieben hauptsächlich in der Gegend von Hoorn und Alkmaar
hergestellt. Der Hauptstapelplatz für den Handel ist jedoch
Edam, und zu den großen Käsemärkten, die hier mehrmals
im Jahre abgehalten werden, finden sich von nah und fern
Großhändler und Wiederverkäufer in bedeutender Anzahl ein.
Unsere Illustration auf S. 690 gewährt uns ein anschauliches
Bild von dem lebhaften geschäftlichen Treiben, das sich an
solchen Tagen in dem freundlichen und blitzsauberen nord-
holländischen Städtchen entwickelt. Zu großen Pyramiden
werden die appetitlichen roten Kugeln unter freiem Himmel
aufgestapelt, und schon auf sehr beträchtliche Entfernung hin
macht ihr Duft sich bemerklich. Mit der dem Holländer eigen-
tümlichen Rnhe vollziehen sich die Abschlüsse zwischen Käufern
und Verkäufern, wenn auch zuweilen recht lange und hart-
Das Buch für Alle.
689
näckig gefeilscht wird. Unter den Käufern sind die ver-
schiedensten Elemente vertreten, und neben dem Großhändler,
der mit Kennerblick die vorzüglichste Ware auswählt und
große Mengen des einträglichen Handelsartikels ersteht, findet
sich auch die fürsorgliche Hausfrau ein, die ihren Familien-
bedarf bis zum nächsten Markte so vorteilhaft als möglich zu
decken sucht. — Eine gewisse Berühmtheit hat die Stadt
Edam, deren Bewohner übrigens mehr Schiffbauer und Gerber
als Käsefabrikanten sind, durch die im Jahre 1784 hier er-
folgte Gründung der Vereinigung „Not nut van't alAönwen"
(„Zum allgemeinen Nutzen") erlangt, einer Gesellschaft, die
sich hauptsächlich die Verbesserung des Volksunterrichts zum
Ziele gesetzt und den Niederlanden sehr bedeutenden Nutzen
auf diesem Gebiete geleistet hat.
Die Heuschreckenplage in Südafrika.
(Siehe das Bild auf Seite 69).)
s^>ie in allen Ländern mit weiten Steppengebieten bildet
auch in Südafrika die Wanderheuschrecke eine der größten
Plagen für den Landwirt, da sie in ungeheuren Schwärmen
aufzutreten pflegt und dort, wo sie einfällt, in ihrer Ge-
fräßigkeit keinen Halm und kein Blatt übrig läßt. Die Plage
wiederholt sich in gewissen Zwischenräumen immer wieder.
Sobald die Sommerregen ordentlich einsetzen, kriechen aus
den Eiern, welche die Weibchen in Bündeln zu 30 bis 40 Stück
im Herbst in die Erde legen, die jungen Tiere aus. Sie
haben schwarzeZeichnungen auf braunrotem Grunde und werden
von den Buren daher Rotröcke genannt, wie die Engländer,
deren Verwüstungsarbeit gegenwärtig allerdings in unan-
genehmer Weise dem zerstörenden Wirken der Wanderheu-
schrecken gleicht. Die Rotröcke wachsen sehr schnell heran,
und bekommen nach mehrfacher Häutung Flügel. In diesem
Zustande nennt sie der Bur „Springhaaner", und schaut ängst-
lich nach ihnen aus, denn jetzt können sie ihrem Wandertriebe
noch besser als früher Genüge leisten, sich schnell über weite
Strecken verbreiten und in Gärten und Feldern schweren
Schaden anrichten. Weht der Wind frisch, so ziehen sie, wie
Fritsch berichtet, hoch und frei, bei Windstille dagegen ist ihr
Flug nur ein langsames Schwärmen ohne bedeutende Er-
hebung über den Boden, indem sich aus den vorderen Gliedern
stets ein Teil niederläßt und sich, nachdem er gefressen, hinten
wieder anschließt. Das ewige Auf- und Niedersteigen, das
Schwirren der Hunderttausende von Flügeln und das Knirschen
der gefräßigen Kinnbacken verursacht ein eigentümliches Ge-
räusch, das einigermaßen dein Rauschen eines starken Hagel-
schauers gleicht. Dis Eingeborenen, Kasfern, Hottentotten,
sowie die eingeführten asiatischen Arbeiter verspeisen die Heu-
schrecken mit großem Appetit und in wahrhaft ungeheuren
Mengen. Unser Bild auf S. 691 zeigt uns eine Anzahl
solcher braunen Burschen und Mädchen in der kapländischen
Hafenstadt Port Elizabeth, wie sie eifrig dem Fange der dem
Farmer so unliebsamen Gäste obliegen. Sie sammeln die
Tiere, die sie mit Zweigen niederschlagen, vom Boden auf
und stecken sie in Säcke. Was nicht gleich gegessen werden
kann, wird getrocknet für künftige Zeiten aufbewahrt. Auch
die Hühner sind nicht faul in der Vertilgung der Insekten
und mästen sich förmlich daran, ebenso die Pferde. Die Buren
behaupten, daß der Genuß von Heuschreckenweibchen, welche be-
reits ihre Eier abgelegt haben, auf die Pferde giftig einwirke,
daher sie ausgewachsene Heuschrecken als Pferdefutter nicht
verwenden, selbst wenn der Mangel an Gras noch so groß ist.
Dor dem Rellauront Douoraild im Leipziger
Rosenthal.
(Siehe das Bild auf Seite 695.)
7>as jeden: Besucher Leipzigs wohlbekannte und jedem stän-
digen Bewohner der berühmten Musik- und Buchhändler-
stadt an der Pleiße innig ans Herz gewachsene Rosenthal ist
eine parkartig zugestutzte, ziemlich ausgedehnte Laubholzwal-
dung im Nordwesten der Stadt, der letzte Rest jenes gewal-
tigen, undurchdringlichen Forstes, aus welchem vor tausend
oder mehr Jahren die ersten wendischen Ansiedler ihr Bau-
material bezogen haben mögen. Noch im achtzehnten Jahr-
hundert war nach den vorhandenen Berichten das Rosenthal
ein dichter, wildreicher Wald. Kurfürst August der Starke
war der erste Regent, der es sich angelegen sein ließ, ihm
durch die Schaffung einiger Alleen einen parkartigen Charakter
zu geben. Die große Umwandlung des ausgedehnten Terrains
zu seiner jetzigen, mit Recht als sehr anmutig und lieblich
gepriesenen Gestalt erfolgte jedoch erst viel später unter dein
Kriegsrat Müller, einem Leipziger Bürgermeister, dem die
Stadt auch noch für eine ganze Reihe anderer Verschönerungen
zu Dank verpflichtet ist. Von den Alleen Augusts des Starkei:
ist nur eine einzige erhalten geblieben, der sogenannte Poeten-
gang, heute die beliebteste Promenade des Rosenthals und
ein Rendezvousort für die vornehme Gesellschaft Leipzigs.
Seinen Namen verdankt der schöne, schattige Weg den: Dichter
Gellert, den: der Magistrat in gerechter Würdigung seiner Ver-
dienste gestattet hatte, den bestehenden Vorschriften entgegen
auch auf dieser Promenade das Reitpferd zu benutzen, das Prinz
Heinrich von Preußen den: kränkliche!: Poeten zum Geschenk
gemacht hatte. Freilich war Gellert bei weiten: nicht der
berühmteste unter den deutschen Dichtern, die zu verschiedenen
Zeiten hier zu lustwandeln liebten. Namen wie Goethe,
Schiller und Lessing können da genannt werden, und alle diese
Heroen unserer klassischen Litteratur haben mit Entzücken von
dem reizenden Rosenthal gesprochen. Heute bildet einen Haupt-
anziehungspunkt des Poetenganges das große Bonorandsche
Etablissement, vor welches unser Zeichner uns auf seinem den:
Leber: eines schönen Sommernachmittags abgelauschten Bilde
auf S. 695 versetzt. Hier pflegt sich, wenn Wetter und Jahres-
zeit es gestatten, ein zahlreiches Publikum aus allen Be-
völkerungsschichten der lebhaften Handelsstadt an der Pleiße
zusammen zu finden. Offiziere und flotte Musensöhne, Pro-
fessoren und Kaufleute, Künstler der alten wie der aller-
neuesten, schon durch die Kleidung kundgegebenen Richtung,
sie alle promenieren hier im Verein nut den schöner: und
eleganten Frauen, an denen bekanntlich an der Pleiße noch
niemals ein Mangel gewesen ist. Oder sie nehmen an einen:
Tische des durch seine ausgezeichneten Konzerte berühmten
Gartenetablissements Platz, um den bunten, unablässig dahin-
flutenden Menschenstrom gemächlich ai: sich vorüberziehen zu
sehen. Von hübschen und interessanten, wie von fremd-
artigen oder unfreiwillig komischen Erscheinungen ist da ai:
solchen schöner: Tagen immer eine reiche Fülle vorhanden.
Und das Rosenthal macht seinen: alten Rufe, ein Paradies
für liebeglühende junge Menschenherzen zu sein, nirgends so
viel Ehre, als hier unter den Baumwipfeln des von den
feurige«: oder sehnsüchtigen Weisen der Bonorandschen Musik-
kapelle durchtönten Poetenganges.
Das Geheimnis der „Delaware".
Erzählung nach Thatsachen voll Gerh. Len Boer.
n der Quaimauer der Noddlesinsel, auf welcher
der Hafen der uordamerikanischen Stadt Boston
liegt, lehnte ein Mann, der mit Interesse
dem Leben und Treiben in dem riesigen Hafen
zusah. Es war entschieden ein Nordländer, ein Schwede
oder Norweger, das bewies seine Helle Hautfarbe und
sein auffallend hellblondes Haar. Er war vielleicht
dreißig Jahre alt und schien eine schwere Krankheit
überstanden zu haben, denn die Augen in seinem bart-
losen Gesicht lagen tief in den Höhlen, und die Züge
traten scharf und eckig hervor.
Ein Boot legte am Quai an, ein Seemann stieg aus
und die Steintreppe empor bis zur Straße, auf welcher
Wagen und Karren ununterbrochen daherrollten. Auch
der Ankommende war entschieden ein Nordländer und
prüfte mit eigentümlichem Blick den blassen, kranken
Mann, der da oben stand. Er wollte an ihn: vorüber-
gehen, blieb jedoch plötzlich stehen und sagte: „Nielsen,
bist du es wirklich?"
Der Angeredete betrachtete den Fremden erstaunt,
ohne ihn zu erkennen.
„Ich bin Sverdrup, dein Freund Sverdrup!" fuhr
der andere fort. „Erkennst du mich denn nicht wieder,
alter Junge?"
Ein freudiges Lächeln zeigte sich auf dem Gesicht
Nielsens. „Ah, Sverdrup!" rief er, „du bist es? Ich
hätte dich wahrhaftig nicht erkannt. Mein Gedächtnis
hat gelitten, sehr gelitten! Ich habe in Galveston das
gelbe Fieber gehabt, seit einem halben Jahre bin ich
Rekonvaleszent und kann mich immer noch nicht recht
erholen. Sie haben mich nach dem Norden geschickt,
und deshalb halte ich mich hier in Boston auf. Ich
sage dir, Bruderherz, es geht mir verwünscht schlecht!"
„Warum gehst du nicht wieder in See?" fragte
Sverdrup. „Du hast doch deine Papiere als Ober-
steuermann. Jeder Kapitän kann sich freuen, einen
solchen Offizier an Bord zu bekommen wie dich."
Nielsen zuckte die Achseln. „Wer nimmt einen
kranken Menschen? — Ich sehe aus, als käme ich aus
dem Grabe, und jeder Kapitän hat Angst, daß ich ihm
unterwegs sterben könnte."
„Da kann geholfen werden," meinte Sverdrup. „Ich
suche für unser Schiff einen Untersteuermann und wenn
du dich mit dieser Stelle begnügen willst, so bist du
sofort engagiert. Ich selber bin Obersteuermann aus
der „Delaware", einem guten, tüchtigen Dampfer aus
New Pork, der zwischen Nordamerika und Europa fährt.
Ein gutes Schiff, gute Bezahlung und gute Verpflegung,
dazu verhältnismäßig wenig Arbeit, da wirft du dich
schnell erholen. Also schlag ein! Morgen gehen wir
wieder in See."
„Ich danke dir für deine Hilfe, Sverdrup, und
nehme gerne an," entgegnete Nielsen. „Aber ich muß
es dir gleich von vornherein sagen, ich habe in meinem
Quartier Schulden, die erst bezahlt werden müssen.
Ich brauche einen Vorschuß auf meinen Gehalt. Auch
mit meiner Ausrüstung ist es nicht gut bestellt. Ich
bin seit dreiviertel Jahren ohne Stellung gewesen."
„Das sind Kleinigkeiten," meinte Sverdrup. „Hier
Sie irgend welche Spur entdecken. Und nun gehen Sie
nur wieder guten Mutes an Ihre Arbeit. Wir werden
die Geschichte schon herausbringen."
Sie verbeugte sich schüchtern. Er gab ihr freundlich
die Hand. Am liebsten hätte sie dieselbe aus Dank-
barkeit für sein Vertrauen an die Lippen gezogen.
„Noch eins," rief er ihr nach, als sie schon an der
Thüre stand. „Haben Sie über das Defizit in Ihrer
Kasse gesprochen?"
„Nur mit meiner Mutter, Herr Direktor."
„Es ist gut. Dann bitte, schweigen Sie auch
fernerhin."
Als Thea heraustrat, begegnete ihr im Flur Elsbeth
Lindner.
„Ich hab' frische Luft schnappen müssen," sagte sie
rasch. „Es ist im Bureau wieder schrecklich eingeheizt."
Aber es hatte fast den Anschein, als habe sie hier
draußen gehorcht, und sie schien verlegen.
„Na, was haben Sie denn beim Direktor zu thun
gehabt? Sie biedern sich ja schrecklich an da drinnen,"
fuh-r sie lachend fort und legte ihre Hand auf Theas
Arm. Aber das junge Mädchen erhaschte einen lauern-
den, angstvollen Blick in dem lachenden Gesicht, und
plötzlich, ganz instinktmäßig, packte sie ein Mißtrauen,
ein dunkler Argwohn auf die leichtsinnige Kollegin, und
sie schüttelte fast heftig die Berührung ab.
„Ich habe jetzt keine Zeit zum Plaudern!" sagte sie
kühl.
Der Gedanke ließ sie während des ganzen Nach-
mittags nicht mehr los. Sie kämpfte gegen den Ver-
dacht, sie dachte mit Schrecken an den scharfen Blick des
Direktors, der sie morgen vielleicht wieder fragen würde
und der es sicher bemerkte, wenn sie kein so klares Nein
erwidern konnte wie heute. Wie durfte sie Elsbeth an-
schuldigen ohne Beweis, nur auf ein dumpfes Gefühl
hin! Aber während sie sich ihres Mißtrauens schämte,
fiel ihr doch ein, daß Elsbeth sich vor kurzem eine neue
Schmucknadel gekauft, bald daraus eine Federnboa, eine
bunte Krawatte — lauter billigen Tand. Aber die
sparsam erzogene Thea hatte sich doch gewundert, daß
das Mädchen, das einen kranken Vater und mehrere
jüngere Geschwister hatte, solche unnötige Ausgaben
machte.
Es kostete ihr an diesem Abend eine wahre Ueber-
windung, das Bureau zu verlassen. Alle waren schon
fort außer Elsbeth, die ja immer die letzte, war. Thea
hätte lieber die ganze Nacht hier bleiben und das ihr
anvertraute Gut behüten mögen. Trotz aller Vorsicht —
was würde morgen wieder fehlen? Elsbeth stand vor
dem Spiegel, als Thea ihren Mantel und Hut holte.
„Sie hätten's nicht nötig, sich so lang zu plagen,"
rief sie ihr boshaft zu. „Sie verstehen es ja, sich bei
dem Herrn Direktor einzuschmeicheln, damit er Ihnen
gelegentlich durch die Finger sieht!"
Thea schaute sie einen Moment starr an. Es klang
eine so bittere Gereiztheit aus dem Ton, und Elsbeth
war bisher doch immer von katzenhaster Freundlichkeit
zu ihr gewesen.
„O, nur braucht er gar nicht durch die Finger zu
sehen. Ich thue meine Pflicht!" sagte auch sie etwas
heftig.
Es lag ein gewollter Seitenhieb in den Worten,
denn die anderen Buchhalterinnen hatten sich längst dar-
über beschwert, daß Fräulein Lindner stundenlang zum
Fenster hinausschaute, oder in einein heimlich mit-
gebrachten Roman las und ihnen alle Arbeit überließ.
Es ivar ihr öfter gedroht worden, daß man sie ver-
klagen würde.
(Fortsetzung folgt.)
Käsemarkt in Cdam (Holland).
(Stehe das Bild auf Seite 690.)
/großer Beliebtheit bei allen Feinschmeckern erfreut sich weit
über die Grenzen seines Ursprungslandes hinaus der
unter dem Namen des Edamers in schön rot gefärbten Kugeln
von 2 bis 10 Kilogramm in den Handel kommende holländische
Käse. Er gehört zu den sogenannten harten Süßmilchkäsen und
hat sich durch seinen Wohlgeschmack, seine Bekömmlichkeit und
Haltbarkeit diesseits wie jenseits des Ozeans den Markt zu
erobern gewußt. Seine Erzeugung ist nicht, wie der Name
vermuten lassen könnte, auf das nur 6325 Einwohner zählende,
nordöstlich von Amsterdam gelegene holländische Städtchen
Edam beschränkt, sondern er wird in teilweise sehr bedeutenden
Betrieben hauptsächlich in der Gegend von Hoorn und Alkmaar
hergestellt. Der Hauptstapelplatz für den Handel ist jedoch
Edam, und zu den großen Käsemärkten, die hier mehrmals
im Jahre abgehalten werden, finden sich von nah und fern
Großhändler und Wiederverkäufer in bedeutender Anzahl ein.
Unsere Illustration auf S. 690 gewährt uns ein anschauliches
Bild von dem lebhaften geschäftlichen Treiben, das sich an
solchen Tagen in dem freundlichen und blitzsauberen nord-
holländischen Städtchen entwickelt. Zu großen Pyramiden
werden die appetitlichen roten Kugeln unter freiem Himmel
aufgestapelt, und schon auf sehr beträchtliche Entfernung hin
macht ihr Duft sich bemerklich. Mit der dem Holländer eigen-
tümlichen Rnhe vollziehen sich die Abschlüsse zwischen Käufern
und Verkäufern, wenn auch zuweilen recht lange und hart-
Das Buch für Alle.
689
näckig gefeilscht wird. Unter den Käufern sind die ver-
schiedensten Elemente vertreten, und neben dem Großhändler,
der mit Kennerblick die vorzüglichste Ware auswählt und
große Mengen des einträglichen Handelsartikels ersteht, findet
sich auch die fürsorgliche Hausfrau ein, die ihren Familien-
bedarf bis zum nächsten Markte so vorteilhaft als möglich zu
decken sucht. — Eine gewisse Berühmtheit hat die Stadt
Edam, deren Bewohner übrigens mehr Schiffbauer und Gerber
als Käsefabrikanten sind, durch die im Jahre 1784 hier er-
folgte Gründung der Vereinigung „Not nut van't alAönwen"
(„Zum allgemeinen Nutzen") erlangt, einer Gesellschaft, die
sich hauptsächlich die Verbesserung des Volksunterrichts zum
Ziele gesetzt und den Niederlanden sehr bedeutenden Nutzen
auf diesem Gebiete geleistet hat.
Die Heuschreckenplage in Südafrika.
(Siehe das Bild auf Seite 69).)
s^>ie in allen Ländern mit weiten Steppengebieten bildet
auch in Südafrika die Wanderheuschrecke eine der größten
Plagen für den Landwirt, da sie in ungeheuren Schwärmen
aufzutreten pflegt und dort, wo sie einfällt, in ihrer Ge-
fräßigkeit keinen Halm und kein Blatt übrig läßt. Die Plage
wiederholt sich in gewissen Zwischenräumen immer wieder.
Sobald die Sommerregen ordentlich einsetzen, kriechen aus
den Eiern, welche die Weibchen in Bündeln zu 30 bis 40 Stück
im Herbst in die Erde legen, die jungen Tiere aus. Sie
haben schwarzeZeichnungen auf braunrotem Grunde und werden
von den Buren daher Rotröcke genannt, wie die Engländer,
deren Verwüstungsarbeit gegenwärtig allerdings in unan-
genehmer Weise dem zerstörenden Wirken der Wanderheu-
schrecken gleicht. Die Rotröcke wachsen sehr schnell heran,
und bekommen nach mehrfacher Häutung Flügel. In diesem
Zustande nennt sie der Bur „Springhaaner", und schaut ängst-
lich nach ihnen aus, denn jetzt können sie ihrem Wandertriebe
noch besser als früher Genüge leisten, sich schnell über weite
Strecken verbreiten und in Gärten und Feldern schweren
Schaden anrichten. Weht der Wind frisch, so ziehen sie, wie
Fritsch berichtet, hoch und frei, bei Windstille dagegen ist ihr
Flug nur ein langsames Schwärmen ohne bedeutende Er-
hebung über den Boden, indem sich aus den vorderen Gliedern
stets ein Teil niederläßt und sich, nachdem er gefressen, hinten
wieder anschließt. Das ewige Auf- und Niedersteigen, das
Schwirren der Hunderttausende von Flügeln und das Knirschen
der gefräßigen Kinnbacken verursacht ein eigentümliches Ge-
räusch, das einigermaßen dein Rauschen eines starken Hagel-
schauers gleicht. Dis Eingeborenen, Kasfern, Hottentotten,
sowie die eingeführten asiatischen Arbeiter verspeisen die Heu-
schrecken mit großem Appetit und in wahrhaft ungeheuren
Mengen. Unser Bild auf S. 691 zeigt uns eine Anzahl
solcher braunen Burschen und Mädchen in der kapländischen
Hafenstadt Port Elizabeth, wie sie eifrig dem Fange der dem
Farmer so unliebsamen Gäste obliegen. Sie sammeln die
Tiere, die sie mit Zweigen niederschlagen, vom Boden auf
und stecken sie in Säcke. Was nicht gleich gegessen werden
kann, wird getrocknet für künftige Zeiten aufbewahrt. Auch
die Hühner sind nicht faul in der Vertilgung der Insekten
und mästen sich förmlich daran, ebenso die Pferde. Die Buren
behaupten, daß der Genuß von Heuschreckenweibchen, welche be-
reits ihre Eier abgelegt haben, auf die Pferde giftig einwirke,
daher sie ausgewachsene Heuschrecken als Pferdefutter nicht
verwenden, selbst wenn der Mangel an Gras noch so groß ist.
Dor dem Rellauront Douoraild im Leipziger
Rosenthal.
(Siehe das Bild auf Seite 695.)
7>as jeden: Besucher Leipzigs wohlbekannte und jedem stän-
digen Bewohner der berühmten Musik- und Buchhändler-
stadt an der Pleiße innig ans Herz gewachsene Rosenthal ist
eine parkartig zugestutzte, ziemlich ausgedehnte Laubholzwal-
dung im Nordwesten der Stadt, der letzte Rest jenes gewal-
tigen, undurchdringlichen Forstes, aus welchem vor tausend
oder mehr Jahren die ersten wendischen Ansiedler ihr Bau-
material bezogen haben mögen. Noch im achtzehnten Jahr-
hundert war nach den vorhandenen Berichten das Rosenthal
ein dichter, wildreicher Wald. Kurfürst August der Starke
war der erste Regent, der es sich angelegen sein ließ, ihm
durch die Schaffung einiger Alleen einen parkartigen Charakter
zu geben. Die große Umwandlung des ausgedehnten Terrains
zu seiner jetzigen, mit Recht als sehr anmutig und lieblich
gepriesenen Gestalt erfolgte jedoch erst viel später unter dein
Kriegsrat Müller, einem Leipziger Bürgermeister, dem die
Stadt auch noch für eine ganze Reihe anderer Verschönerungen
zu Dank verpflichtet ist. Von den Alleen Augusts des Starkei:
ist nur eine einzige erhalten geblieben, der sogenannte Poeten-
gang, heute die beliebteste Promenade des Rosenthals und
ein Rendezvousort für die vornehme Gesellschaft Leipzigs.
Seinen Namen verdankt der schöne, schattige Weg den: Dichter
Gellert, den: der Magistrat in gerechter Würdigung seiner Ver-
dienste gestattet hatte, den bestehenden Vorschriften entgegen
auch auf dieser Promenade das Reitpferd zu benutzen, das Prinz
Heinrich von Preußen den: kränkliche!: Poeten zum Geschenk
gemacht hatte. Freilich war Gellert bei weiten: nicht der
berühmteste unter den deutschen Dichtern, die zu verschiedenen
Zeiten hier zu lustwandeln liebten. Namen wie Goethe,
Schiller und Lessing können da genannt werden, und alle diese
Heroen unserer klassischen Litteratur haben mit Entzücken von
dem reizenden Rosenthal gesprochen. Heute bildet einen Haupt-
anziehungspunkt des Poetenganges das große Bonorandsche
Etablissement, vor welches unser Zeichner uns auf seinem den:
Leber: eines schönen Sommernachmittags abgelauschten Bilde
auf S. 695 versetzt. Hier pflegt sich, wenn Wetter und Jahres-
zeit es gestatten, ein zahlreiches Publikum aus allen Be-
völkerungsschichten der lebhaften Handelsstadt an der Pleiße
zusammen zu finden. Offiziere und flotte Musensöhne, Pro-
fessoren und Kaufleute, Künstler der alten wie der aller-
neuesten, schon durch die Kleidung kundgegebenen Richtung,
sie alle promenieren hier im Verein nut den schöner: und
eleganten Frauen, an denen bekanntlich an der Pleiße noch
niemals ein Mangel gewesen ist. Oder sie nehmen an einen:
Tische des durch seine ausgezeichneten Konzerte berühmten
Gartenetablissements Platz, um den bunten, unablässig dahin-
flutenden Menschenstrom gemächlich ai: sich vorüberziehen zu
sehen. Von hübschen und interessanten, wie von fremd-
artigen oder unfreiwillig komischen Erscheinungen ist da ai:
solchen schöner: Tagen immer eine reiche Fülle vorhanden.
Und das Rosenthal macht seinen: alten Rufe, ein Paradies
für liebeglühende junge Menschenherzen zu sein, nirgends so
viel Ehre, als hier unter den Baumwipfeln des von den
feurige«: oder sehnsüchtigen Weisen der Bonorandschen Musik-
kapelle durchtönten Poetenganges.
Das Geheimnis der „Delaware".
Erzählung nach Thatsachen voll Gerh. Len Boer.
n der Quaimauer der Noddlesinsel, auf welcher
der Hafen der uordamerikanischen Stadt Boston
liegt, lehnte ein Mann, der mit Interesse
dem Leben und Treiben in dem riesigen Hafen
zusah. Es war entschieden ein Nordländer, ein Schwede
oder Norweger, das bewies seine Helle Hautfarbe und
sein auffallend hellblondes Haar. Er war vielleicht
dreißig Jahre alt und schien eine schwere Krankheit
überstanden zu haben, denn die Augen in seinem bart-
losen Gesicht lagen tief in den Höhlen, und die Züge
traten scharf und eckig hervor.
Ein Boot legte am Quai an, ein Seemann stieg aus
und die Steintreppe empor bis zur Straße, auf welcher
Wagen und Karren ununterbrochen daherrollten. Auch
der Ankommende war entschieden ein Nordländer und
prüfte mit eigentümlichem Blick den blassen, kranken
Mann, der da oben stand. Er wollte an ihn: vorüber-
gehen, blieb jedoch plötzlich stehen und sagte: „Nielsen,
bist du es wirklich?"
Der Angeredete betrachtete den Fremden erstaunt,
ohne ihn zu erkennen.
„Ich bin Sverdrup, dein Freund Sverdrup!" fuhr
der andere fort. „Erkennst du mich denn nicht wieder,
alter Junge?"
Ein freudiges Lächeln zeigte sich auf dem Gesicht
Nielsens. „Ah, Sverdrup!" rief er, „du bist es? Ich
hätte dich wahrhaftig nicht erkannt. Mein Gedächtnis
hat gelitten, sehr gelitten! Ich habe in Galveston das
gelbe Fieber gehabt, seit einem halben Jahre bin ich
Rekonvaleszent und kann mich immer noch nicht recht
erholen. Sie haben mich nach dem Norden geschickt,
und deshalb halte ich mich hier in Boston auf. Ich
sage dir, Bruderherz, es geht mir verwünscht schlecht!"
„Warum gehst du nicht wieder in See?" fragte
Sverdrup. „Du hast doch deine Papiere als Ober-
steuermann. Jeder Kapitän kann sich freuen, einen
solchen Offizier an Bord zu bekommen wie dich."
Nielsen zuckte die Achseln. „Wer nimmt einen
kranken Menschen? — Ich sehe aus, als käme ich aus
dem Grabe, und jeder Kapitän hat Angst, daß ich ihm
unterwegs sterben könnte."
„Da kann geholfen werden," meinte Sverdrup. „Ich
suche für unser Schiff einen Untersteuermann und wenn
du dich mit dieser Stelle begnügen willst, so bist du
sofort engagiert. Ich selber bin Obersteuermann aus
der „Delaware", einem guten, tüchtigen Dampfer aus
New Pork, der zwischen Nordamerika und Europa fährt.
Ein gutes Schiff, gute Bezahlung und gute Verpflegung,
dazu verhältnismäßig wenig Arbeit, da wirft du dich
schnell erholen. Also schlag ein! Morgen gehen wir
wieder in See."
„Ich danke dir für deine Hilfe, Sverdrup, und
nehme gerne an," entgegnete Nielsen. „Aber ich muß
es dir gleich von vornherein sagen, ich habe in meinem
Quartier Schulden, die erst bezahlt werden müssen.
Ich brauche einen Vorschuß auf meinen Gehalt. Auch
mit meiner Ausrüstung ist es nicht gut bestellt. Ich
bin seit dreiviertel Jahren ohne Stellung gewesen."
„Das sind Kleinigkeiten," meinte Sverdrup. „Hier