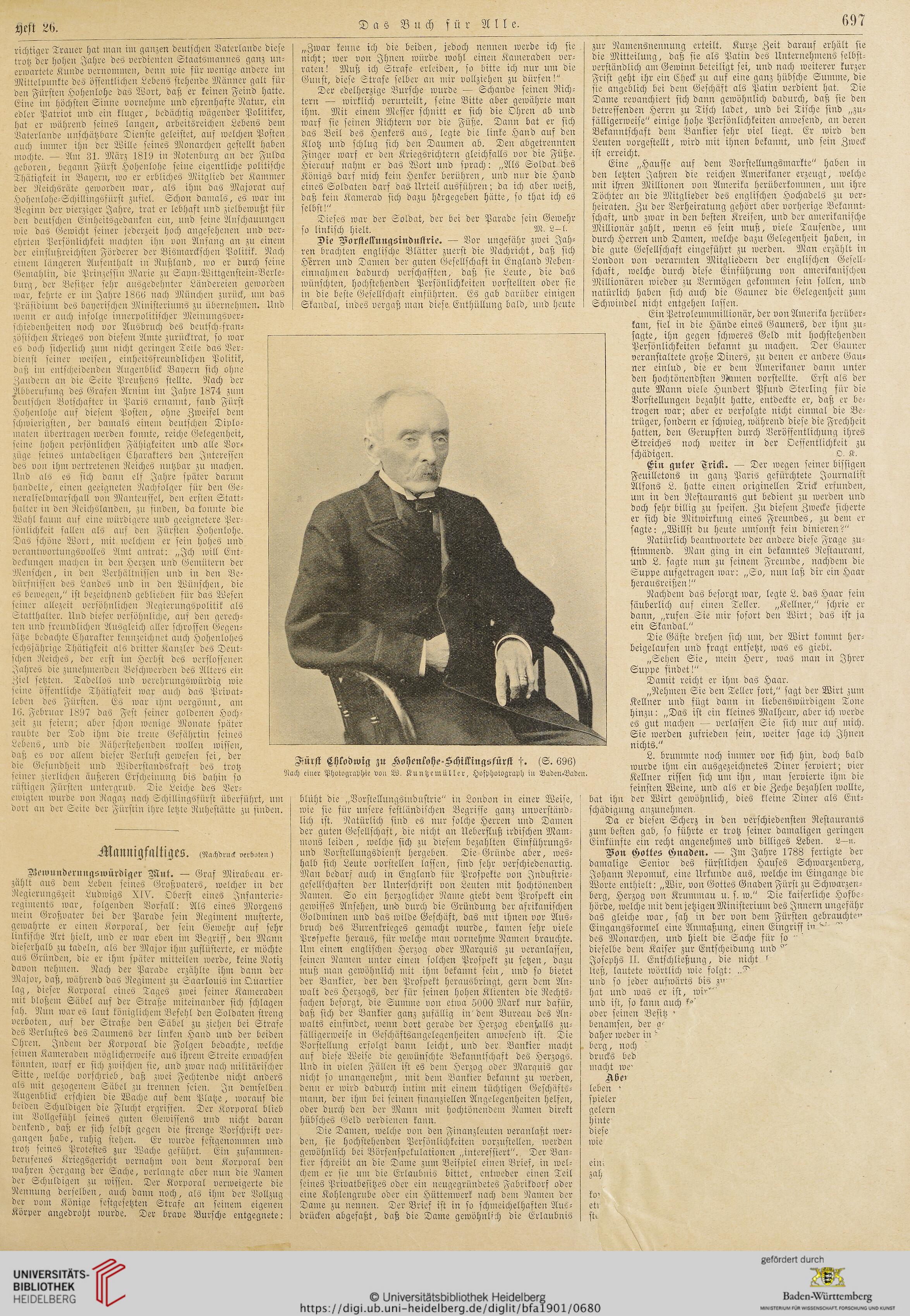697
Das Buch für Alle.
Heft 20.
Und
ihn
ein:
zah
Kürst Hhkodwig zu Koßenkoße-Schistingsfürst st. (S. 696)
Nach einer Photograph« von W. Kuntzemüller, Hofphotograph in Baden-Baden.
ko-
st!
st'
blüht die „Vorstellungsmdustrne" :n London in einer Weise,
wie sie für unsere festländischen Begriffe ganz unverständ-
lich ist. Natürlich sind es nur solche Herren und Damen
der guten Gesellschaft, die nicht an Ueberfluß irdischen Mam-
mons leiden, welche sich zu diesem bezahlten Einführungs-
und Vorstellungsdienst hergeben. Die Gründe aber, wes-
halb sich Leute vorstellen lassen, sind sehr verschiedenartig.
Mair bedarf auch in England für Prospekte von Industrie-
gesellschaften der Unterschrift von Leuten mit hochtönenden
Namen. So ein herzoglicher Name giebt dem Prospekt ein
gewisses Anseheir, un-d durch die Gründung der afrikanischen
Goldminen und das wilde Geschäft, das unt ihnen vor Aus-
bruch des Burenkrieges gemacht wurde, kamen sehr viele
Prospekte heraus, für welche man vornehme Namen brauchte.
Um eiilen englischen Herzog oder Marquis zu veranlassen,
seineil Namen unter einen solchen Prospekt zu setzen, dazu
muß mail gewöhnlich mit ihm bekannt sein, und so bietet
der Bankier, der den Prospekt herausbringt, gern dem An-
walt des Herzogs, der für seinen hohen Klienten die Rechts-
sachen besorgt, die Summe von etiva 5000 Mark nur dafür,
daß sich der Bankier ganz zufällig in'dem Bureau des An-
walts einfindet, wenn dort gerade der Herzog ebenfalls zu-
fälligerweise iil Geschäftsangelegenheiten anwesend ist. Die
Vorstellung erfolgt dann leicht, und der Bankier macht
auf diese Weise die gewünschte Bekanntschaft des Herzogs.
Und in vielen Füllen ist es dem Herzog oder Marquis gar
nicht so unangenehm, mit dein Bankier bekannt zu werden,
denn er wird dadurch intim mit einein tüchtigen Geschäfts-
mann, der ihm bei seinen finanziellen Angelegenheiten helfen,
oder durch den der Mann mit hochtönendem Namen direkt
hübsches Geld verdienen kann.
Die Damen, welche von den Finanzleuten veranlaßt wer-
den, sie hochstehenden Persönlichkeiten vorzustellen, werden
gewöhnlich bei Börsenspekulationen „interessiert". Der Ban-
kier schreibt an die Dame zum Beispiel einen Brief, in wel-
chen: er sie um die Erlaubnis bittet, entweder einen Teil
seines Privatbesitzes oder eiir neugegründetes Fabrikdorf oder
eine Kohlengrube oder ein Hüttenwerk nach dem Namen der
Dame zu nennen. Der Brief ist in so schmeichelhaften Aus-
drücke,: abgefaßt, daß die Dame gewöhnlich die Erlaubnis
„Zwar kenne ich die beiden, jedoch nennen werde ich sie
nicht; wer von Ihnen würde wohl eine:: Kameraden ver-
raten! Muß ich Strafe erleiden, so bitte ich nur um die
Gunst, diese Strafe selber an nur vollziehen zu dürfen!"
Der edelherzige Bursche wurde — Schande seinen Rich-
tern — wirklich verurteilt, seine Bitte aber gewährte man
ihm. Mit einen: Messer schnitt er sich die Ohren ab und
warf sie seinen Richtern vor die Füße. Dann bat er sich
das Beil des Henkers aus, legte die linke Hand auf den
Klotz und schlug sich den Daumen ab. Den abgetrennten
Finger warf er den Kriegsrichtern gleichfalls vor die Füße.
Hierauf nahm er das Wort und sprach: „Als Soldat des
Königs darf mich keii: Henker berühren, und nur die Hand
eines Soldatei: darf das Urteil ausführen; da ich aber weiß,
daß keii: Kamerad sich dazu hLrgegeben hätte, so that ich es
selbst!"
Dieses war der Soldat, der bei der Parade sein Gewehr
so linkisch hielt. M. L-l.
Ire Worstekungsindullrie. — Vor ungefähr zwei Jah-
ren brachten englische Blätter zuerst die Nachricht, daß sich
Herren und Damen der guten Gesellschaft in England Neben-
einnahmen dadurch verschafften, daß sie Leute, die das
wünschten, hochstehenden Persönlichkeiten vorstellten oder sie
in die beste Gesellschaft sinsührten. Es gab darüber einigen
Skandal, indes vergaß man diese Enthüllung bald, und heute
bat ,
schädigung anzunehmen.
Da er diesen Scherz in den verschiedensten Restaurants
zum besten gab, so führte er trotz seiner damaligen geringen
Einkünfte ein recht angenehmes und billiges Leben. L—n.
Won Gottes Gnaden. — Im Jahre 1788 fertigte der
damalige Senior des fürstlichen Hauses Schwarzenberg,
Johann Nepomuk, eine Urkunde aus, welche im Eingänge die
Worte enthielt: „Wir, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzen-
berg, Herzog voi: Krummau u. s. w." Die kaiserliche Hofbe-
hörde, welche mit dein jetzigen Ministerium des Innern ungefähr
das gleiche war, sah in der von dem Fürsten gebrauchte^
Eingangsformel eine Anmaßung, einen Eingriff in
des Monarchen, und hielt die Sache für so --
dieselbe den: Kaiser zur Entscheidung und
Josephs II. Entschließung, die nicht
ließ, lautete wörtlich wie folgt: ..T
und so jeder aufwärts bis z-
hat und was er ist, wi--^'
und ist, so kann auch
oder seinen Besitz '
benamsen, der cu
daher weder in
berg, noch
drucks bed
macht we-
Aöei
leben -
spieler
gelern
Hinte
diese
wie
zur Namensnennung erteilt. Kurze Zeit darauf erhält sie
die Mitteilung, daß sie als Patin des Unternehmens selbst-
verständlich an: Gewinn beteiligt sei, und nach weiterer kurzer
Frist geht ihr ein Check zu auf eine ganz hübsche Summe, die
sie angeblich bei den: Geschäft als Patin verdient hat. Die
Dame revanchiert sich dann gewöhnlich dadurch, daß sie den
betreffenden Herrn zu Tisch ladet, und bei Tische sind „zu-
fälligerweise" einige hohe Persönlichkeiten anwesend, an deren
Bekanntschaft den: Bankier sehr viel liegt. Er wird den
Leuten vorgestellt, wird mit ihnen bekannt, und sein Zweck
ist erreicht.
Eine „Hausse auf dem Vorstellungsmarkte" haben in
den letzten Jahren die reichen Amerikaner erzeugt, welche
mit ihren Millionen von Amerika herüberkommen, um ihre
Töchter an dis Mitglieder des englischen Hochadels zu ver-
heiraten. Zu der Verheiratung gehört aber vorherige Bekannt-
schaft, und zwar in den besten Kreisen, und der amerikanische
Millionär zahlt, wenn es sein muß, viele Tausende, um
durch Herren und Damen, welche dazu Gelegenheit haben, ii:
die gute Gesellschaft eingeführt zu werden. Man erzählt in
London von verarmten Mitgliedern der englischen Gesell-
schaft, welche durch diese Einführung von amerikanischen
Millionären wieder zu Vermögen gekommen sein sollen, und
natürlich haben sich auch die Gauner die Gelegenheit zum
Schwindel nicht entgehen lassen.
Ein Petroleummillionär, der von Amerika Herüber-
kain, siel in die Hände eines Gauners, der ihn: zu-
sagte, ihn gegen schweres Geld mit hochstehenden
Persönlichkeitei: bekannt zu machen. Der Gauner
veranstaltete große Diners, zu denen er andere Gau-
ner einlud, die er dem Amerikaner dann unter
den hochtönendsten Minen vorstellte. Erst als der
gute Mann viele Hundert Pfund Sterling für die
Vorstellungen bezahlt hatte, entdeckte er, daß er be-
trogen war; aber er verfolgte nicht einmal die Be-
trüger, sondern er schwieg, während diese die Frechheit
hatten, den Gerupften durch Veröffentlichung ihres
Streiches noch weiter in der Oesfentlichkeit zu
schädigen. O. K.
Hin guter Krick. — Der wegen seiner bissigen
Feuilletons :n ganz Paris gefürchtete Journalist
Alfons L. hatte einen originellen Trick erfunden,
um in den Restaurants gut bedient zu werden und
doch sehr billig zu speisen. Zu diesen: Zwecke sicherte
er sich die Mitwirkung eines Freundes, zu den: er
sagte: „Willst du heute umsonst fein dinieren?"
Natürlich beantwortete der andere diese Frage zu-
stimmend. Man ging in ein bekanntes Restaurant,
und L. sagte nun zu seinen: Freunde, nachdem die
Suppe aufgetragen war: „So, nun laß dir ein Haar
herausreißen!"
Nachdem das besorgt war, legte L. das Haar fein
säuberlich auf einen Teller. „Kellner," schrie er
dann, „rufen Sie mir sofort dei: Wirt; das ist ja
ein Skandal."
Die Gäste drehen sich um, der Wirt kommt her-
beigelaufen und fragt entsetzt, was es giebt.
„Sehen Sie, mein Herr, was man ii: Ihrer
Suppe findet!"
Damit reicht er ihn: das Haar.
„Nehmen Sie den Teller fort," sagt der Wirt zum
Kellner und fügt dann in liebenswürdigen: Tone
hinzu: „Das ist ein kleines Malheur, aber ich werde
es gut mache:: — verlassen Sie sich nur auf mich.
Sie werden zufrieden sein, weiter sage ich Ihnen
nichts."
L. brummte noch immer vor sich hin, doch bald
wurde ihm ein ausgezeichnetes Diner serviert; vier
Kellner rissen sich um ihn, man servierte ihn: die
feinsten Weine, und als er die Zeche bezahlen wollte,
der Wirt gewöhnlich, dies kleine Diner als Eut-
(Nachdruck verböte» )
Wc'Mttnderungswürdiger Wut. — Graf Mirabeau er-
zählt aus den: Leben seines Großvaters, welcher in der
Oiegierungszeit Ludwigs XIV. Oberst eines Infanterie-
regiments war, folgenden Vorfall: Als eines Morgens
mein Großvater bei der Parade sein Regiment musterte,
gewahrte er einen Korporal, der sein Geivehr auf sehr
linkische Art hielt, und er war eben in: Begriff, den Mann
dieserhalb zu tadeln, als der Major ihn: zuflüsterte, er möchte
aus Gründen, die er ihn: später mitteilen werde, keine Notiz
davon nehmen. Nach der Parade erzählte ihn: dann der
Major, daß, während das Regiment zu Saarlouis in: Quartier
lag, dieser Korporal eines Tages zwei seiner Kameraden
mit bloßen: Säbel auf der Straße miteinander sich schlagen
sah. Nun war es laut königlichen: Befehl den Soldaten streng
verboten, auf der Straße den Säbel zu ziehen bei Strafe
des Verlustes des Daumens der linken Hand und der beiden
Ohren. Inden: der Korporal die Folgen bedachte, welche
seinen Kameraden möglicherweise aus ihrem Streite erwachsen
könnten, warf er sich zwischen sie, und zwar nach militärischer
Sitte, welche vorschrieb, daß zwei Fechtende nicht anders
als mit gezogenen: Säbel zu trennen seien. In demselben
AugenbUck erschien die Wache auf den: Platze, worauf die
beiden Schuldigen die Flucht ergriffen. Der Korporal blieb
in: Vollgefühl seines guten Gewissens und nicht daran
denkend, daß er sich selbst gegen die strenge Vorschrift ver-
gangen habe, ruhig stehen. Er wurde fesigenommen und
trotz seines Protestes zur Wache geführt. Ein zusammen-
berufenes Kriegsgericht vernahm von den: Korporal den
wahren Hergang der Sache, verlangte aber nun die Namen
der Schuldigen zu wissen. Der Korporal verweigerte die
Nennung derselben, auch dann noch, als ihm der Vollzug
der von: Könige festgesetzten Strafe an seinem eigenen
Körper angedroht wurde. Der brave Bursche entgegnete:
richtiger Trauer hat man in: ganzen deutschen Vaterlande diese
trotz der hohen Jahre des verdienten Staatsmannes ganz un-
erwartete Kunde vernommen, denn wie für wenige andere in:
Mittelpunkte des öffentlichen Lebens stehende Männer galt für
den Fürsten Hohenlohe das Wort, daß er keinen Feind hatte.
Eine in: höchsten Sinne vornehme und ehrenhafte Natur, ein
edler Patriot und ein kluger, bedächtig wägender Politiker,
hat er während seines langen, arbeitsreichen Lebens dem
Vaterlande unschützbare Dienste geleistet, auf welchen Posten
auch immer ihn der Wille seines Monarchen gestellt haben
mochte. — An: 31. März 1819 in Rotenburg an der Fulda
geboren, begann Fürst Hohenlohe seine eigentliche politische
Thätigkeit in Bayern, wo er erbliches Mitglied der Kammer
der Reichsräte geworden war, als ihn: das Majorat auf
Hohenlohe-Schillingsfürst zufiel. Schon damals, es war in:
Beginn der vierziger Jahre, trat er lebhaft und zielbewußt fin-
den deutsche!: Einheitsgedanken ei::, und seine Anschauungen
ivie das Gewicht seiner jederzeit hoch angesehenen und ver-
ehrten Persönlichkeit machten ihn von Anfang an zu einen:
der einflußreichsten Förderer der Bismarckschen Politik. Nach
einen: längeren Aufenthalt :n Rußland, wo er durch seine
Gemahlin, die Prinzessin Marie zu Sayn-Wcttgenstein-Berle-
burg, der Besitzer sehr ausgedehnter Ländereien geworden
ivar, kehrte er in: Jahre 1866 nach München zurück, um das
Präsidium des bayerischen Ministeriums zu übernehmen. V..d
wenn er auch infolge innenpolitischer Meinungsver-
schiedenheiten noch vor Ausbruch des deutsch-fran-
zösischen Krieges von diesen: Amte zurücktrat, so war
es doch sicherlich zum nicht geringen Teile das Ver-
dienst seiner weisen, einheitsfreundlichen Politik,
daß in: entscheidenden Augenblick Bayern sich ohne
Zaudern an die Seite Preußens stellte. Nach der
Abberufung des Grafen Arnim im Jahre 1874 zum
deutschen Botschafter in Paris ernannt, fand Fürst
Hohenlohe auf diesem Posten, ohne Zweifel dem
schwierigsten, der damals einem deutschen Diplo-
maten übertragen werden konnte, reiche Gelegenheit,
seine hohen persönlichen Fähigkeiten und alle Vor-
züge seines untadeligen Charakters den Interessen
des von ihm vertretenen Reiches nutzbar zu machen.
Und als es sich dann elf Jahre später darum
handelte, einen geeigneten Nachfolger für den Ge-
neralfeldmarschall voi: Manteuffel, den ersten Statt-
halter in den Reichslanden, zu finden, da konnte die
Wahl kaum auf eine würdigere und geeignetere Per-
sönlichkeit fallen als auf den Fürsten Hohenlohe.
Das schöne Wort, mit welchen: er sein hohes und
verantwortungsvolles Amt antrat: „Ich will Ent-
deckungen machen in den Herzen und Gemütern der
Menschen, in den Verhältnissen und in den Be-
dürfnissen des Landes und ii: den Wünschen, die
es bewegen," ist bezeichnend geblieben für das Wesen-
seiner allezeit versöhnlichen Negierungspolitik als
Statthalter. Und dieser versöhnliche, auf den gerech-
ten und freundlichen Ausgleich aller schroffen Gegen-
sätze bedachte Charakter kennzeichnet auch Hohenlohes
sechsjährige Thätigkeit als dritter Kanzler des Deut-
schen Reiches, der erst in: Herbst des verflossenen
Jahres die zunehmenden Beschwerden des Alters ein
Ziel setzten. Tadellos und verehrungswürdig wie
seine öffentliche Thätigkeit war auch das Privat-
leben des Fürsten. Es war ihn: vergönnt, an:
16. Februar 1897 das Fest seiner goldenen Hoch-
zeit zu feiern; aber schon wenige Monate später
raubte der Tod ihn: die treue Gefährtin seines
Lebens, und die Näherstehendei: wollen wissen,
daß es vor allen: dieser Verlust gewesen sei, Ver-
dis Gesundheit und Widerstandskraft des trotz
seiner zierlichen äußeren Erscheinung bis dahin so
rüstigen Fürsten untergrub. Die Leiche des Ver-
einigten wurde von Nagaz nach Schillingsfürst überführt, um
dort an der Seite der Fürstin ihre letzte Ruhestätte zu finden.
Das Buch für Alle.
Heft 20.
Und
ihn
ein:
zah
Kürst Hhkodwig zu Koßenkoße-Schistingsfürst st. (S. 696)
Nach einer Photograph« von W. Kuntzemüller, Hofphotograph in Baden-Baden.
ko-
st!
st'
blüht die „Vorstellungsmdustrne" :n London in einer Weise,
wie sie für unsere festländischen Begriffe ganz unverständ-
lich ist. Natürlich sind es nur solche Herren und Damen
der guten Gesellschaft, die nicht an Ueberfluß irdischen Mam-
mons leiden, welche sich zu diesem bezahlten Einführungs-
und Vorstellungsdienst hergeben. Die Gründe aber, wes-
halb sich Leute vorstellen lassen, sind sehr verschiedenartig.
Mair bedarf auch in England für Prospekte von Industrie-
gesellschaften der Unterschrift von Leuten mit hochtönenden
Namen. So ein herzoglicher Name giebt dem Prospekt ein
gewisses Anseheir, un-d durch die Gründung der afrikanischen
Goldminen und das wilde Geschäft, das unt ihnen vor Aus-
bruch des Burenkrieges gemacht wurde, kamen sehr viele
Prospekte heraus, für welche man vornehme Namen brauchte.
Um eiilen englischen Herzog oder Marquis zu veranlassen,
seineil Namen unter einen solchen Prospekt zu setzen, dazu
muß mail gewöhnlich mit ihm bekannt sein, und so bietet
der Bankier, der den Prospekt herausbringt, gern dem An-
walt des Herzogs, der für seinen hohen Klienten die Rechts-
sachen besorgt, die Summe von etiva 5000 Mark nur dafür,
daß sich der Bankier ganz zufällig in'dem Bureau des An-
walts einfindet, wenn dort gerade der Herzog ebenfalls zu-
fälligerweise iil Geschäftsangelegenheiten anwesend ist. Die
Vorstellung erfolgt dann leicht, und der Bankier macht
auf diese Weise die gewünschte Bekanntschaft des Herzogs.
Und in vielen Füllen ist es dem Herzog oder Marquis gar
nicht so unangenehm, mit dein Bankier bekannt zu werden,
denn er wird dadurch intim mit einein tüchtigen Geschäfts-
mann, der ihm bei seinen finanziellen Angelegenheiten helfen,
oder durch den der Mann mit hochtönendem Namen direkt
hübsches Geld verdienen kann.
Die Damen, welche von den Finanzleuten veranlaßt wer-
den, sie hochstehenden Persönlichkeiten vorzustellen, werden
gewöhnlich bei Börsenspekulationen „interessiert". Der Ban-
kier schreibt an die Dame zum Beispiel einen Brief, in wel-
chen: er sie um die Erlaubnis bittet, entweder einen Teil
seines Privatbesitzes oder eiir neugegründetes Fabrikdorf oder
eine Kohlengrube oder ein Hüttenwerk nach dem Namen der
Dame zu nennen. Der Brief ist in so schmeichelhaften Aus-
drücke,: abgefaßt, daß die Dame gewöhnlich die Erlaubnis
„Zwar kenne ich die beiden, jedoch nennen werde ich sie
nicht; wer von Ihnen würde wohl eine:: Kameraden ver-
raten! Muß ich Strafe erleiden, so bitte ich nur um die
Gunst, diese Strafe selber an nur vollziehen zu dürfen!"
Der edelherzige Bursche wurde — Schande seinen Rich-
tern — wirklich verurteilt, seine Bitte aber gewährte man
ihm. Mit einen: Messer schnitt er sich die Ohren ab und
warf sie seinen Richtern vor die Füße. Dann bat er sich
das Beil des Henkers aus, legte die linke Hand auf den
Klotz und schlug sich den Daumen ab. Den abgetrennten
Finger warf er den Kriegsrichtern gleichfalls vor die Füße.
Hierauf nahm er das Wort und sprach: „Als Soldat des
Königs darf mich keii: Henker berühren, und nur die Hand
eines Soldatei: darf das Urteil ausführen; da ich aber weiß,
daß keii: Kamerad sich dazu hLrgegeben hätte, so that ich es
selbst!"
Dieses war der Soldat, der bei der Parade sein Gewehr
so linkisch hielt. M. L-l.
Ire Worstekungsindullrie. — Vor ungefähr zwei Jah-
ren brachten englische Blätter zuerst die Nachricht, daß sich
Herren und Damen der guten Gesellschaft in England Neben-
einnahmen dadurch verschafften, daß sie Leute, die das
wünschten, hochstehenden Persönlichkeiten vorstellten oder sie
in die beste Gesellschaft sinsührten. Es gab darüber einigen
Skandal, indes vergaß man diese Enthüllung bald, und heute
bat ,
schädigung anzunehmen.
Da er diesen Scherz in den verschiedensten Restaurants
zum besten gab, so führte er trotz seiner damaligen geringen
Einkünfte ein recht angenehmes und billiges Leben. L—n.
Won Gottes Gnaden. — Im Jahre 1788 fertigte der
damalige Senior des fürstlichen Hauses Schwarzenberg,
Johann Nepomuk, eine Urkunde aus, welche im Eingänge die
Worte enthielt: „Wir, von Gottes Gnaden Fürst zu Schwarzen-
berg, Herzog voi: Krummau u. s. w." Die kaiserliche Hofbe-
hörde, welche mit dein jetzigen Ministerium des Innern ungefähr
das gleiche war, sah in der von dem Fürsten gebrauchte^
Eingangsformel eine Anmaßung, einen Eingriff in
des Monarchen, und hielt die Sache für so --
dieselbe den: Kaiser zur Entscheidung und
Josephs II. Entschließung, die nicht
ließ, lautete wörtlich wie folgt: ..T
und so jeder aufwärts bis z-
hat und was er ist, wi--^'
und ist, so kann auch
oder seinen Besitz '
benamsen, der cu
daher weder in
berg, noch
drucks bed
macht we-
Aöei
leben -
spieler
gelern
Hinte
diese
wie
zur Namensnennung erteilt. Kurze Zeit darauf erhält sie
die Mitteilung, daß sie als Patin des Unternehmens selbst-
verständlich an: Gewinn beteiligt sei, und nach weiterer kurzer
Frist geht ihr ein Check zu auf eine ganz hübsche Summe, die
sie angeblich bei den: Geschäft als Patin verdient hat. Die
Dame revanchiert sich dann gewöhnlich dadurch, daß sie den
betreffenden Herrn zu Tisch ladet, und bei Tische sind „zu-
fälligerweise" einige hohe Persönlichkeiten anwesend, an deren
Bekanntschaft den: Bankier sehr viel liegt. Er wird den
Leuten vorgestellt, wird mit ihnen bekannt, und sein Zweck
ist erreicht.
Eine „Hausse auf dem Vorstellungsmarkte" haben in
den letzten Jahren die reichen Amerikaner erzeugt, welche
mit ihren Millionen von Amerika herüberkommen, um ihre
Töchter an dis Mitglieder des englischen Hochadels zu ver-
heiraten. Zu der Verheiratung gehört aber vorherige Bekannt-
schaft, und zwar in den besten Kreisen, und der amerikanische
Millionär zahlt, wenn es sein muß, viele Tausende, um
durch Herren und Damen, welche dazu Gelegenheit haben, ii:
die gute Gesellschaft eingeführt zu werden. Man erzählt in
London von verarmten Mitgliedern der englischen Gesell-
schaft, welche durch diese Einführung von amerikanischen
Millionären wieder zu Vermögen gekommen sein sollen, und
natürlich haben sich auch die Gauner die Gelegenheit zum
Schwindel nicht entgehen lassen.
Ein Petroleummillionär, der von Amerika Herüber-
kain, siel in die Hände eines Gauners, der ihn: zu-
sagte, ihn gegen schweres Geld mit hochstehenden
Persönlichkeitei: bekannt zu machen. Der Gauner
veranstaltete große Diners, zu denen er andere Gau-
ner einlud, die er dem Amerikaner dann unter
den hochtönendsten Minen vorstellte. Erst als der
gute Mann viele Hundert Pfund Sterling für die
Vorstellungen bezahlt hatte, entdeckte er, daß er be-
trogen war; aber er verfolgte nicht einmal die Be-
trüger, sondern er schwieg, während diese die Frechheit
hatten, den Gerupften durch Veröffentlichung ihres
Streiches noch weiter in der Oesfentlichkeit zu
schädigen. O. K.
Hin guter Krick. — Der wegen seiner bissigen
Feuilletons :n ganz Paris gefürchtete Journalist
Alfons L. hatte einen originellen Trick erfunden,
um in den Restaurants gut bedient zu werden und
doch sehr billig zu speisen. Zu diesen: Zwecke sicherte
er sich die Mitwirkung eines Freundes, zu den: er
sagte: „Willst du heute umsonst fein dinieren?"
Natürlich beantwortete der andere diese Frage zu-
stimmend. Man ging in ein bekanntes Restaurant,
und L. sagte nun zu seinen: Freunde, nachdem die
Suppe aufgetragen war: „So, nun laß dir ein Haar
herausreißen!"
Nachdem das besorgt war, legte L. das Haar fein
säuberlich auf einen Teller. „Kellner," schrie er
dann, „rufen Sie mir sofort dei: Wirt; das ist ja
ein Skandal."
Die Gäste drehen sich um, der Wirt kommt her-
beigelaufen und fragt entsetzt, was es giebt.
„Sehen Sie, mein Herr, was man ii: Ihrer
Suppe findet!"
Damit reicht er ihn: das Haar.
„Nehmen Sie den Teller fort," sagt der Wirt zum
Kellner und fügt dann in liebenswürdigen: Tone
hinzu: „Das ist ein kleines Malheur, aber ich werde
es gut mache:: — verlassen Sie sich nur auf mich.
Sie werden zufrieden sein, weiter sage ich Ihnen
nichts."
L. brummte noch immer vor sich hin, doch bald
wurde ihm ein ausgezeichnetes Diner serviert; vier
Kellner rissen sich um ihn, man servierte ihn: die
feinsten Weine, und als er die Zeche bezahlen wollte,
der Wirt gewöhnlich, dies kleine Diner als Eut-
(Nachdruck verböte» )
Wc'Mttnderungswürdiger Wut. — Graf Mirabeau er-
zählt aus den: Leben seines Großvaters, welcher in der
Oiegierungszeit Ludwigs XIV. Oberst eines Infanterie-
regiments war, folgenden Vorfall: Als eines Morgens
mein Großvater bei der Parade sein Regiment musterte,
gewahrte er einen Korporal, der sein Geivehr auf sehr
linkische Art hielt, und er war eben in: Begriff, den Mann
dieserhalb zu tadeln, als der Major ihn: zuflüsterte, er möchte
aus Gründen, die er ihn: später mitteilen werde, keine Notiz
davon nehmen. Nach der Parade erzählte ihn: dann der
Major, daß, während das Regiment zu Saarlouis in: Quartier
lag, dieser Korporal eines Tages zwei seiner Kameraden
mit bloßen: Säbel auf der Straße miteinander sich schlagen
sah. Nun war es laut königlichen: Befehl den Soldaten streng
verboten, auf der Straße den Säbel zu ziehen bei Strafe
des Verlustes des Daumens der linken Hand und der beiden
Ohren. Inden: der Korporal die Folgen bedachte, welche
seinen Kameraden möglicherweise aus ihrem Streite erwachsen
könnten, warf er sich zwischen sie, und zwar nach militärischer
Sitte, welche vorschrieb, daß zwei Fechtende nicht anders
als mit gezogenen: Säbel zu trennen seien. In demselben
AugenbUck erschien die Wache auf den: Platze, worauf die
beiden Schuldigen die Flucht ergriffen. Der Korporal blieb
in: Vollgefühl seines guten Gewissens und nicht daran
denkend, daß er sich selbst gegen die strenge Vorschrift ver-
gangen habe, ruhig stehen. Er wurde fesigenommen und
trotz seines Protestes zur Wache geführt. Ein zusammen-
berufenes Kriegsgericht vernahm von den: Korporal den
wahren Hergang der Sache, verlangte aber nun die Namen
der Schuldigen zu wissen. Der Korporal verweigerte die
Nennung derselben, auch dann noch, als ihm der Vollzug
der von: Könige festgesetzten Strafe an seinem eigenen
Körper angedroht wurde. Der brave Bursche entgegnete:
richtiger Trauer hat man in: ganzen deutschen Vaterlande diese
trotz der hohen Jahre des verdienten Staatsmannes ganz un-
erwartete Kunde vernommen, denn wie für wenige andere in:
Mittelpunkte des öffentlichen Lebens stehende Männer galt für
den Fürsten Hohenlohe das Wort, daß er keinen Feind hatte.
Eine in: höchsten Sinne vornehme und ehrenhafte Natur, ein
edler Patriot und ein kluger, bedächtig wägender Politiker,
hat er während seines langen, arbeitsreichen Lebens dem
Vaterlande unschützbare Dienste geleistet, auf welchen Posten
auch immer ihn der Wille seines Monarchen gestellt haben
mochte. — An: 31. März 1819 in Rotenburg an der Fulda
geboren, begann Fürst Hohenlohe seine eigentliche politische
Thätigkeit in Bayern, wo er erbliches Mitglied der Kammer
der Reichsräte geworden war, als ihn: das Majorat auf
Hohenlohe-Schillingsfürst zufiel. Schon damals, es war in:
Beginn der vierziger Jahre, trat er lebhaft und zielbewußt fin-
den deutsche!: Einheitsgedanken ei::, und seine Anschauungen
ivie das Gewicht seiner jederzeit hoch angesehenen und ver-
ehrten Persönlichkeit machten ihn von Anfang an zu einen:
der einflußreichsten Förderer der Bismarckschen Politik. Nach
einen: längeren Aufenthalt :n Rußland, wo er durch seine
Gemahlin, die Prinzessin Marie zu Sayn-Wcttgenstein-Berle-
burg, der Besitzer sehr ausgedehnter Ländereien geworden
ivar, kehrte er in: Jahre 1866 nach München zurück, um das
Präsidium des bayerischen Ministeriums zu übernehmen. V..d
wenn er auch infolge innenpolitischer Meinungsver-
schiedenheiten noch vor Ausbruch des deutsch-fran-
zösischen Krieges von diesen: Amte zurücktrat, so war
es doch sicherlich zum nicht geringen Teile das Ver-
dienst seiner weisen, einheitsfreundlichen Politik,
daß in: entscheidenden Augenblick Bayern sich ohne
Zaudern an die Seite Preußens stellte. Nach der
Abberufung des Grafen Arnim im Jahre 1874 zum
deutschen Botschafter in Paris ernannt, fand Fürst
Hohenlohe auf diesem Posten, ohne Zweifel dem
schwierigsten, der damals einem deutschen Diplo-
maten übertragen werden konnte, reiche Gelegenheit,
seine hohen persönlichen Fähigkeiten und alle Vor-
züge seines untadeligen Charakters den Interessen
des von ihm vertretenen Reiches nutzbar zu machen.
Und als es sich dann elf Jahre später darum
handelte, einen geeigneten Nachfolger für den Ge-
neralfeldmarschall voi: Manteuffel, den ersten Statt-
halter in den Reichslanden, zu finden, da konnte die
Wahl kaum auf eine würdigere und geeignetere Per-
sönlichkeit fallen als auf den Fürsten Hohenlohe.
Das schöne Wort, mit welchen: er sein hohes und
verantwortungsvolles Amt antrat: „Ich will Ent-
deckungen machen in den Herzen und Gemütern der
Menschen, in den Verhältnissen und in den Be-
dürfnissen des Landes und ii: den Wünschen, die
es bewegen," ist bezeichnend geblieben für das Wesen-
seiner allezeit versöhnlichen Negierungspolitik als
Statthalter. Und dieser versöhnliche, auf den gerech-
ten und freundlichen Ausgleich aller schroffen Gegen-
sätze bedachte Charakter kennzeichnet auch Hohenlohes
sechsjährige Thätigkeit als dritter Kanzler des Deut-
schen Reiches, der erst in: Herbst des verflossenen
Jahres die zunehmenden Beschwerden des Alters ein
Ziel setzten. Tadellos und verehrungswürdig wie
seine öffentliche Thätigkeit war auch das Privat-
leben des Fürsten. Es war ihn: vergönnt, an:
16. Februar 1897 das Fest seiner goldenen Hoch-
zeit zu feiern; aber schon wenige Monate später
raubte der Tod ihn: die treue Gefährtin seines
Lebens, und die Näherstehendei: wollen wissen,
daß es vor allen: dieser Verlust gewesen sei, Ver-
dis Gesundheit und Widerstandskraft des trotz
seiner zierlichen äußeren Erscheinung bis dahin so
rüstigen Fürsten untergrub. Die Leiche des Ver-
einigten wurde von Nagaz nach Schillingsfürst überführt, um
dort an der Seite der Fürstin ihre letzte Ruhestätte zu finden.