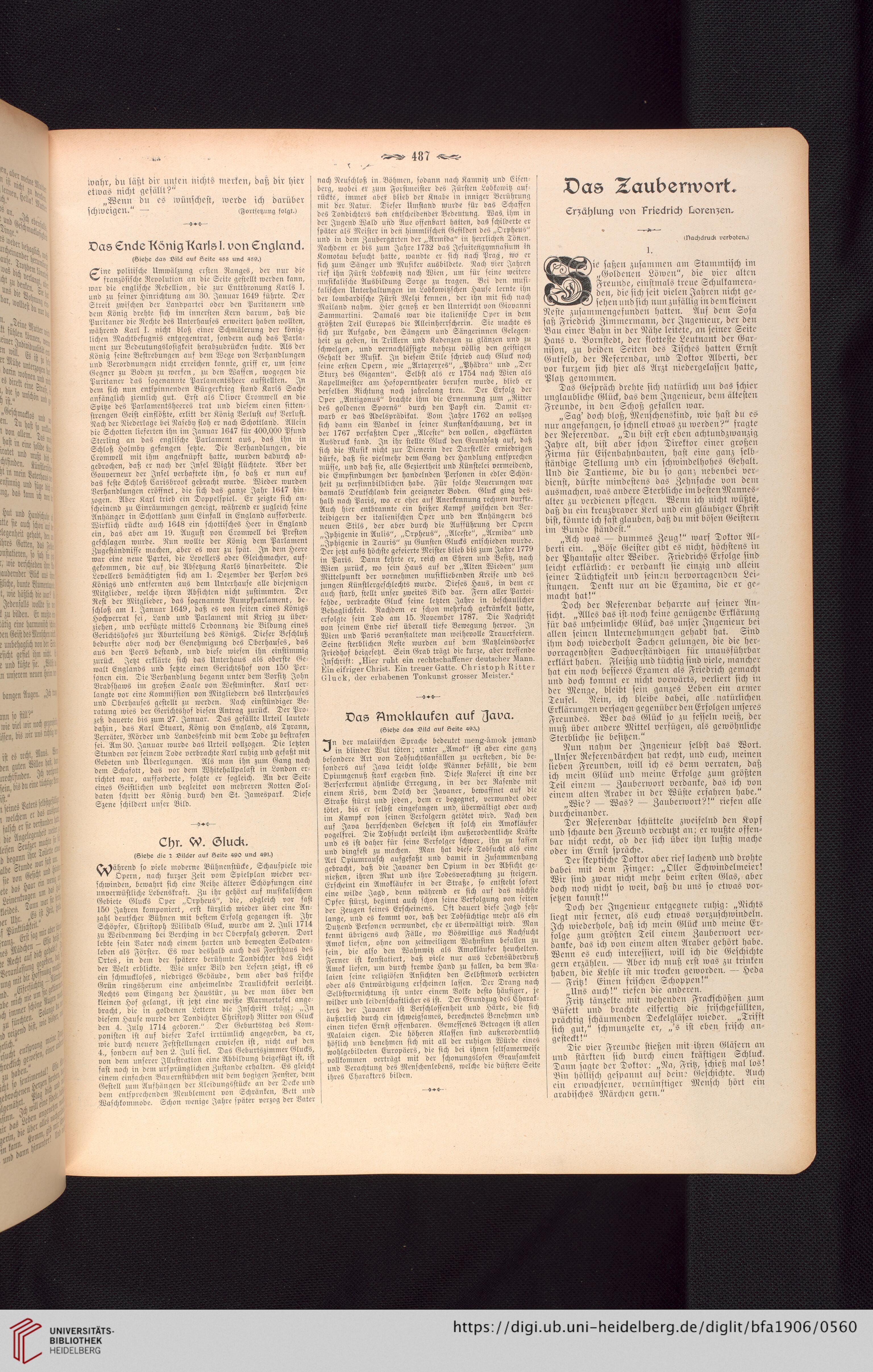487
wahr, du läßt dir unten nichts merken, daß dir Hier-
etwas wicht gefallt?"
„Wenn du es wünschest, werde ich darüber
schweigen.' - - »Fortsetzung folgt.»
Das Lncle ^önig 7<arls I. von Lnglanci.
(Sieho das Llld aut gelte qss und 4SS.)
^ine politische Umwälzung ersten Ranges, der nur die
französische Revolution an die Seite gestellt werden kann,
war die englische Rebellion, die zur Entthronung Karls I.
und zu seiner Hinrichtung am 30. Januar 1649 führte. Der
Streit zwischen der Landpartci oder den Puritanern und
dem König drehte sich im innersten Kern darum, daß die
Puritaner die Rechte des Unterhauses erweitert haben wollten,
während Karl I. nicht bloß einer Schmälerung der könig-
lichen Machtbefugnis entgegentrat, sondern auch das Parla-
ment zur Bedeutungslosigkeit herabzudrücken suchte. Als der
König seine Bestrebungen auf dem Wege von Verhandlungen
und Verordnungen nicht erreichen konnte, griff er, um seine
Gegner zu Boden zu werfen, zu den Waffen, wogegen die
Puritaner das sogenannte Parlamentsheer aufstellten. In
dem sich nun entspinnenden Bürgerkrieg stand Karls Sache
anfänglich ziemlich gut. Erst als Oliver Cromwell an die
Spitze des Parlamentsheeres trat und diesem einen sitten-
strengen Geist einflößte, erlitt der König Verlust auf Verlust.
Nach der Niederlage bei Naseby floh er nach Schottland. Allein
die Schotten lieferten ihn im Januar 1647 für 400,000 Pfund
Sterling an das englische Parlament aus, das ihn in
Schloß Holmby gefangen setzte. Die Verhandlungen, die
Cromwell mit ihm angeknüpft hatte, wurden dadurch ab-
gebrochen, daß er nach der Insel Wight flüchtete. Aber der
Gouverneur der Insel verhaftete ihn, so daß er nun auf
das feste Schloß Carisbrook gebracht wurde. Wieder wurden
Verhandlungen eröffnet, die sich das ganze Jahr 1647 hin-
zogen. Aber Karl trieb ein Doppelspiel. Er zeigte sich an-
scheinend zu Einräumungen geneigt, während er zugleich seine
Anhänger in Schottland zum Einfall in England aufforderte.
Wirklich rückte auch 1648 ein schottisches Heer iir England
ein, das aber ain 19. August von Cromwell bei Preston
geschlagen wurde. Nun wollte der König dem Parlament
Zugeständnisse machen, aber es war zu spät. In dein Heere
war eine neue Partei, die Levellers oder Gleichmacher, auf-
gekommen, die auf die Absetzung Karls hinarbeitete. Die
Levellers bemächtigten sich am 1. Dezember der Person des
Königs und entfernten aus dem Unterhause alle diejenigen
Mitglieder, welche ihren Absichten nicht zustimmten. Der
Rest der Mitglieder, das sogenannte Rumpfparlament, be-
schloß am 1. Januar 1649, daß es von feiten eines Königs
Hochverrat sei, Land und Parlament mit Krieg zu über-
ziehen, und verfügte mittels Ordonnanz die Bildung eines
Gerichtshofes zur Aburteilung des Königs. Dieser Beschluß
bedurfte aber noch der Genehmigung des -Oberhauses, das
aus den PeerS bestand, und diese wiesen ihn einstimmig
zurück. Jetzt erklärte sich das Unterhaus als oberste Ge-
walt Englands und setzte einen Gerichtshof von 150 Per-
sonen ein. Die Verhandlung begann unter dem Vorsitz John
Bradshaws im großen Saale von Westminster. Karl ver-
langte vor eine Kommission von Mitgliedern des Unterhauses
und Oberhauses gestellt zu werden. Nach cinstündiger Be-
ratung wies der Gerichtshof diesen Antrag zurück. Der Pro-
zeß dauerte bis zum 27. Januar. Das gefällte Urteil lautete
dahin, das Karl Stuart, König von England, als Tyrann,
Verräter, Mörder und Landesfeind mit dein Tode zu bestrafen
sei. Am 30. Januar wurde das Urteil vollzogen. Die letzten
Stunden vor seinem Tode verbrachte Karl ruhig und gefaßt mit
Gebeten und Überlegungen. Als man ihn zum Gang nach
dem Schafott, das vor dein Whitehallpalast in London er-
richtet war, aufforderte, folgte er sogleich. An der Seite
eines Geistlichen und begleitet von mehreren Rotten Sol-
daten schritt der König durch den St. Jamespark. Diese
Szene schildert unser Bild.
Ohr. Sluck.
(Siehe die I Südes aut Seite »so und 4SI.)
A-)ührend so viele inoderne Bühnenstücke, Schauspiele wie
Opern, nach kurzer Zeit vom Spielplan wieder ver-
schwinden, bewahrt sich eine Reihe älterer Schöpfungen eine
unverwüstliche Lebenskraft. Zu ihr gehört auf musikalischem
Gebiete Glucks Oper „Orpheus", die, obgleich vor fast
150 Jahren komponiert, erst kürzlich wieder über eine An-
zahl deutscher Bühnen mit bestem Erfolg gegangen ist. Ihr
Schöpfer, Christoph Wilibald Gluck, wurde am 2. Juli 1714
zu Weidenwang bei Berching in der Oberpfalz geboren. Dort
lebte sein Vater nach einem harten und bewegten Soldaten-
leben als Förster. Es war deshalb auch das Forsthaus des
Ortes, in dem der spätere berühmte Tondichter das Licht
der Welt erblickte. Wie unser Bild den Lesern zeigt, ist es
ein schmuckloses, niedriges Gebäude, dem aber das frische
Grün ringsherum eine anheimelnde Traulichkeit verleiht.
Rechts vom Eingang der Haustür, zu der man über den
kleinen Hof gelangt, ist jetzt eine weiße Marmortafel ange-
bracht, die in goldenen Lettern die Inschrift trägt» „In
diesem Hause wurde der Tondichter Christoph Ritter von Gluck
den 4. July 1714 geboren." Der Geburtstag des Kom-
ponisten ist auf dieser Tafel irrtümlich angegeben, da er,
wie durch neuere Feststellungen erwiesen ist, nicht auf den
4., sondern auf den 2. Juli fiel. Das Geburtszimmer Glucks,
von dem unserer Illustration eine Abbildung beigefügt ist, ist
fast noch in dem ursprünglichen Zustande erhalten^ -Es gleicht
einein einfachen Bauernstübchen mit dein bogigen Fenster, dem
Gestell zum Aushängen der Kleidungsstücke an der Decke und
dem entsprechenden Meublement von >schränken, Bett und
Waschkommode. Schon wenige Jahre später verzog der Vater
nach Neuschloß in Böhmen, sodann nach Kamnitz und Eisen-
berg, wobei St! zum Forstmeister des Fürsten Lobkowitz auf-
rückte, immet nbet blieb der Knabe in inniger Berührung
mit der Natur, dieser Ümstaüd wurde für das Schaffen
des Tondichters tioü eütscheideüder Bedeutung. Was. ihm in
der Jugend Wald utid Aue offenbart hätten, daS schilderte er
später als Meister in deck himmlischen Gefilden des „Orpheus"
und in dem Zaubergllrten der „Armida" in herrlichen Tönen.
Nachdem er bis zum Jahre 1732 das JesuiteNgymNasiuiN in
Komotau besucht hatte, wandte er sich Nach Prag, wo er
sich zum Sänger und Musiker ausbildete. Nach vier Jahren
rief ihn Fürst Lobkowitz nach Wien, um für seine weitere
musikalische Ausbildung Sorge zu tragen. Bei den musi-
kalischen Unterhaltungen im Lobkowitzschen Hause lernte ihn
der lombardische Fürst Melz: kennen, der ihn mit sich nach
Mailand nahm. Hier genoß er den Unterricht von Giovanni
Sammartini. Damals war die italienische Oper in dem
größten Teil Europas die Alleinherrscherin. Sie machte es
sich zur Aufgabe, den Sängern und Sängerinnen Gelegen-
heit zu geben, in Trillern und Kadenzen zu glänzen und zu
schwelgen, und vernachlässigte nahezu völlig den geistigen
Gehalt der Musik. In diesem Stile schrieb auch Gluck noch
seine ersten Opern, wie „Artaxerxes", „Phädra" und „Der
Sturz des Giganten". Selbst als er 1754 nach Wien als
Kapellmeister am Hofoperntheater berufen wurde, blieb er
derselben Richtung noch jahrelang treu. Der Erfolg der
Oper „Antigonus" brachte ihn: die Ernennung zum „Ritter
des goldenen Sporns" durch den Papst ein. Damit er-
warb er das Adelsprädikat. Vom Jahre 1762 an vollzog
sich dann ein Wandel in seiner Kunstanschauung, der in
der 1767 verfaßten Oper „Alceste" den vollen, abgeklärte»:
Ausdruck fand. In ihr stellte Gluck den Grundsatz auf, daß
sich die Musik nicht zur Dieneri»: der Därsteller erniedrigen
dürfe, daß sie vielmehr dem Gang der Handlung entspreche»:
müsse, und daß sie, alle Geziertheit und Künstelei vermeidend,
die Empfindungen der handelnden Personen ii: edler Schön-
heit zu versinnbildlichen habe. Für solche Neuerungen war
damals Deutschland kein geeigneter Boden. Gluck ging des-
halb nach Paris, wo er eher auf Anerkennung rechnen durfte.
Auch hier entbrannte ein heißer Kampf zwischen den Ver-
teidigern der italienischen Oper und den Anhängern des
neue»: Stils, der aber durch die Aufführung der Oper»:
„Iphigenie in Aulis", „Orpheus", „Alceste", „Armida" und
„Iphigenie in Tauris" zu Gunsten Glucks entschieden wurde.
Der jetzt aufs höchste gefeierte Meister blieb bis zum Jahre 1779
in Paris. Dani: kehrte er, reich an Ehren und Besitz, nach
Wien zurück, wo sein Haus auf der „Alten Wieden" zum
Mittelpunkt der vornehinen musikliebenden Kreise und des
jungen Künstlergeschlechts wurde. Dieses Haus, in den: er
auch starb, stellt unser zweites Bild dar. Feri: aller Partei-
fehde, verbrachte Gluck seine letzten Jahre in beschaulicher
Behaglichkeit. Nachdem er schon mehrfach gekränkelt hatte,
erfolgte sein Tod am 15. November 1787. Die Nachricht
von seinen: Ende rief überall tiefe Bewegung hervor. In
Wie»: und Paris veranstaltete man weihevolle Trauerfeiern.
Seine sterbliche»: Reste wurden auf dem Matzleinsdorfer
Friedhof beigesetzt. Sein Grab trägt die kurze, aber treffende
Inschrift: »Kisr rullt ein rsolltsotiuKsnsr äsutsobsr Nanu.
Lin sitri^sr Oürist. Lin trsusr Oatts. Ollristop k liittor
Oiuoie, äsr erimdsnsn l'onllunst grosser Kleister."
Das Amokläufen auf Java.
(Siehe das Süd aut Seite »so.)
der malaiischen Sprache bedeutet rnong-Lwok jemand
ii: blinder Wut töten; unter „Amok" ist aber eine ganz
besondere Art von Tobsuchtsanfttllen zu verstehen, die be-
sonders aus Java leicht solche Männer befällt, die den:
Opiumgenuß stark ergeben sind. Diese Raserei ist eine der
Berserkerwut ähnliche Erregung, in der der Rasende mit
einem Kris, dem Dolch der Javaner, bewaffnet auf die
Straße stürzt und jeden, den: er begegnet, verwundet oder
tötst, bis er selbst eingefangen und, überwältigt oder auch
iin Kampf von seinen Verfolgern getötet wird. Nach dei:
auf Java herrschende»: Gesetzen ist solch ein Amokläufer-
vogelfrei. Die Tobsucht verleiht ihm außerordentliche Kräfte
und es ist daher für seine Verfolger schwer, ihn zu fasse»:
und dingfest zu machen. Man hat diese Tobsucht als eine
Art Opiumrausch aufgefaßt und damit in Zusammenhang
gebracht, daß die Javaner den Opium in der Absicht ge-
nießen, ihren Mut und ihre Todesverachtung zu steigern.
Erscheint ein Amokläufer in der Straße, so entsteht sofort
eine wilde Jagd, denn während er sich auf das nächste
Opfer stürzt, beginnt auch schon seine Verfolgung von feiten
der Zeuge»: seines Erscheinens. Oft dauert diese Jagd sehr-
lange, und es kommt vor, daß der Tobsüchtige mehr als ein
Dutzend Personen verwundet, ehe er überwältigt wird. Man
kennt übrigens auch Fülle, wo Böswillige aus Rachsucht
Amok liefen, ohne voi: zeitweiligem Wahnsinn befalle»: zu
sein, die also den Wahnwitz als Amokläufer heuchelten.
Ferner ist konstatiert, daß viele nur aus Lebensüberdruß
Amok liefen, um durch fremde Hand zu fallen, da den: Ma-
laien seine religiösen Ansichten den Selbstmord verbieten
oder als Entwürdigung erscheinen lassen. Der Drang nach
Selbstvernichtung ist unter einen: Volke desto häufiger, je
wilder und leidenschaftlicher es ist. Der Grundzug des Charak-
ters der Javaner ist Verschlossenheit und Härte, die sich
äußerlich durch ein schweigsames, berechnetes Benehme»: und
einen tiefe»: Ernst offenbaren. Gemessenes Betragen ist allen
Malaien eigen. Die höhere»: Klasse»: sind außerordentlich
höflich und benehmen sich mit all der ruhigen Würde eines
wohlgebildeten Europäers, die sich bei ihnen seltsamerweise
vollkommen verträgt mit der schonungslosen Grausamkeit
und Verachtung des Menschenlebens, welche die düstere Seite
ihres Charakters bilden.
Das Zauberwort.
Stählung von l^rieclrich lüorenzen.
»Nachdruck verboten.)
1.
sahen zusammen am Stammtisch im
„Goldenen Löwen", die vier alten
Freunde, einstmals treue Schulkamera-
den, die sich seit vielen Jahren nicht ge-
sehen und sich nun zufällig in dem kleinen
Neste zusammengefunden hatten. Auf dem Sofa
saß Friedrich Zimmermann, der Ingenieur, der den
Bau einer Bahn in der Nähe leitete, an seiner Seite
Hans v. Bornstedt, der flotteste Leutnant der Gar-
nison, zu beiden Seiten des Tisches hatten Ernst
Gutfeld, der Referendar, und Doktor Alberti, der
vor kurzem sich hier als Arzt niedergelassen hatte,
Platz genommen.
Das Gespräch drehte sich natürlich um das schier
unglaubliche Glück, das dem Ingenieur, dem, ältesten
Freunde, in den Schoß gefallen war.
„Sag' doch bloß, Menfchenskind, wie hast du es
nur angefangen, so schnell etwas zu werden?" fragte
der Referendar. „Du bist erst eben achtundzwanzig
Jahre alt, bist aber schon Direktor einer großen
Firma für Eisenbahnbauten, hast eine ganz selb-
ständige Stellung und ein schwindelhohes Gehalt,
lind die Tantieme, die du so ganz nebenbei ver-
dienst, dürfte mindestens das Zehnfache von dem
ausmachen, was andere Sterbliche imbestenMannes-
alter zu verdienen pflegen. Wenn ich nicht wüßte,
daß du ein kreuzbraver Kerl und ein gläubiger Christ
bist, könnte ich fast glauben, daß du mit bösen Geistern
im Bunde ständest."
„Ach was — dummes Zeug!" warf Doktor Al-
berti ein. „Böse Geister gibt es nicht, höchstens in
der Phantasie alter Weiber. Friedrichs Erfolge sind
leicht erklärlich: er verdankt sie einzig und allein
seiner Tüchtigkeit und seinen hervorragenden Lei-
stungen. Denkt nur an die Examina, die er ge-
macht hat!"
Doch der Referendar beharrte auf seiner An-
sicht. „Alles das istmoch keine genügende Erklärung
für das unheimliche Glück, das unser Jngenieur^bei
allen seinen Unternehmungen gehabt hat. Sind
ihm doch wiederholt Sachen gelungen, die die her-
vorragendsten Sachverständigen für unausführbar
erklärt haben. Fleißig und tüchtig find viele, mancher
hat ein noch besseres Examen als Friedrich gemacht
und doch kommt er nicht vorwärts, verliert sich in
der Menge, bleibt sein ganzes Leben ein armer
Teufel. Nein, ich bleibe dabei, alle natürlichen
Erklärungen versagen gegenüber den Erfolgen unseres
Freundes. Wer das Glück so zu fesseln weiß, der
muß über andere Mittel verfügen, als gewöhnliche
Sterbliche sie besitzen."
Nun nahm der Ingenieur selbst das Wort.
„Unser Referendärchen hat recht, und euch, meinen
lieben Freunden, will ich es denn verraten, daß
ich mein Glück und meine Erfolge zum größten
Teil einem — Zauberwort verdanke, das ich von
einem alten Araber in der Wüste erfahren habe."
„Wie? — Was? — Zauberwort?!" riefen alle
durcheinander.
Der Referendar schüttelte zweifelnd den Kopf
und schaute den Freund verdutzt an; er wußte offen-
bar nicht recht, ob der sich über ihn lustig mache
oder im Ernst spräche.
Der skeptische Doktor aber rief lachend und drohte
dabei mit dem Finger: „Oller Schwindelmeier!
Wir sind zwar nicht mehr beim ersten Glas, aber
doch noch nicht so weit, daß du uns so etwas vor-
setzen kannst!"
' Doch der Ingenieur entgegnete ruhig: „Nichts
liegt mir ferner, als euch etwas vorzuschwindeln.
Ich wiederhole, daß ich mein Glück und meine Er-
folge zum größten Teil einem Zauberwort ver-
danke, das ich von einem alten Araber gehört habe.
Wenn es euch interessiert, will ich die Geschichte
gern erzählen. — Aber ich muß erst was zu trinken
haben, die Kehle ist mir trocken geworden. — Heda
— Fritz! Einen frischen Schoppen!"
„Uns auch!" riefen die anderen.
Fritz tänzelte mit wehenden Frackschößen zum
Büfett' und brachte eilfertig die frischgefüllten,
prächtig schäumenden Deckelgläser wieder. „Trifft
sich gut," schmunzelte er, „'s ist eben frisch an-
gesteckt!"
Die vier Freunde stießen mit ihren Gläsern an
und stärkten sich durch einen kräftigen Schluck.
Dann sagte der Doktor: „Na, Fritz, schieß mal los!
Bin höllisch gespannt auf deine Geschichte. Auch
ein erwachsener, vernünftiger Mensch hört ein
arabisches Machen gern."
wahr, du läßt dir unten nichts merken, daß dir Hier-
etwas wicht gefallt?"
„Wenn du es wünschest, werde ich darüber
schweigen.' - - »Fortsetzung folgt.»
Das Lncle ^önig 7<arls I. von Lnglanci.
(Sieho das Llld aut gelte qss und 4SS.)
^ine politische Umwälzung ersten Ranges, der nur die
französische Revolution an die Seite gestellt werden kann,
war die englische Rebellion, die zur Entthronung Karls I.
und zu seiner Hinrichtung am 30. Januar 1649 führte. Der
Streit zwischen der Landpartci oder den Puritanern und
dem König drehte sich im innersten Kern darum, daß die
Puritaner die Rechte des Unterhauses erweitert haben wollten,
während Karl I. nicht bloß einer Schmälerung der könig-
lichen Machtbefugnis entgegentrat, sondern auch das Parla-
ment zur Bedeutungslosigkeit herabzudrücken suchte. Als der
König seine Bestrebungen auf dem Wege von Verhandlungen
und Verordnungen nicht erreichen konnte, griff er, um seine
Gegner zu Boden zu werfen, zu den Waffen, wogegen die
Puritaner das sogenannte Parlamentsheer aufstellten. In
dem sich nun entspinnenden Bürgerkrieg stand Karls Sache
anfänglich ziemlich gut. Erst als Oliver Cromwell an die
Spitze des Parlamentsheeres trat und diesem einen sitten-
strengen Geist einflößte, erlitt der König Verlust auf Verlust.
Nach der Niederlage bei Naseby floh er nach Schottland. Allein
die Schotten lieferten ihn im Januar 1647 für 400,000 Pfund
Sterling an das englische Parlament aus, das ihn in
Schloß Holmby gefangen setzte. Die Verhandlungen, die
Cromwell mit ihm angeknüpft hatte, wurden dadurch ab-
gebrochen, daß er nach der Insel Wight flüchtete. Aber der
Gouverneur der Insel verhaftete ihn, so daß er nun auf
das feste Schloß Carisbrook gebracht wurde. Wieder wurden
Verhandlungen eröffnet, die sich das ganze Jahr 1647 hin-
zogen. Aber Karl trieb ein Doppelspiel. Er zeigte sich an-
scheinend zu Einräumungen geneigt, während er zugleich seine
Anhänger in Schottland zum Einfall in England aufforderte.
Wirklich rückte auch 1648 ein schottisches Heer iir England
ein, das aber ain 19. August von Cromwell bei Preston
geschlagen wurde. Nun wollte der König dem Parlament
Zugeständnisse machen, aber es war zu spät. In dein Heere
war eine neue Partei, die Levellers oder Gleichmacher, auf-
gekommen, die auf die Absetzung Karls hinarbeitete. Die
Levellers bemächtigten sich am 1. Dezember der Person des
Königs und entfernten aus dem Unterhause alle diejenigen
Mitglieder, welche ihren Absichten nicht zustimmten. Der
Rest der Mitglieder, das sogenannte Rumpfparlament, be-
schloß am 1. Januar 1649, daß es von feiten eines Königs
Hochverrat sei, Land und Parlament mit Krieg zu über-
ziehen, und verfügte mittels Ordonnanz die Bildung eines
Gerichtshofes zur Aburteilung des Königs. Dieser Beschluß
bedurfte aber noch der Genehmigung des -Oberhauses, das
aus den PeerS bestand, und diese wiesen ihn einstimmig
zurück. Jetzt erklärte sich das Unterhaus als oberste Ge-
walt Englands und setzte einen Gerichtshof von 150 Per-
sonen ein. Die Verhandlung begann unter dem Vorsitz John
Bradshaws im großen Saale von Westminster. Karl ver-
langte vor eine Kommission von Mitgliedern des Unterhauses
und Oberhauses gestellt zu werden. Nach cinstündiger Be-
ratung wies der Gerichtshof diesen Antrag zurück. Der Pro-
zeß dauerte bis zum 27. Januar. Das gefällte Urteil lautete
dahin, das Karl Stuart, König von England, als Tyrann,
Verräter, Mörder und Landesfeind mit dein Tode zu bestrafen
sei. Am 30. Januar wurde das Urteil vollzogen. Die letzten
Stunden vor seinem Tode verbrachte Karl ruhig und gefaßt mit
Gebeten und Überlegungen. Als man ihn zum Gang nach
dem Schafott, das vor dein Whitehallpalast in London er-
richtet war, aufforderte, folgte er sogleich. An der Seite
eines Geistlichen und begleitet von mehreren Rotten Sol-
daten schritt der König durch den St. Jamespark. Diese
Szene schildert unser Bild.
Ohr. Sluck.
(Siehe die I Südes aut Seite »so und 4SI.)
A-)ührend so viele inoderne Bühnenstücke, Schauspiele wie
Opern, nach kurzer Zeit vom Spielplan wieder ver-
schwinden, bewahrt sich eine Reihe älterer Schöpfungen eine
unverwüstliche Lebenskraft. Zu ihr gehört auf musikalischem
Gebiete Glucks Oper „Orpheus", die, obgleich vor fast
150 Jahren komponiert, erst kürzlich wieder über eine An-
zahl deutscher Bühnen mit bestem Erfolg gegangen ist. Ihr
Schöpfer, Christoph Wilibald Gluck, wurde am 2. Juli 1714
zu Weidenwang bei Berching in der Oberpfalz geboren. Dort
lebte sein Vater nach einem harten und bewegten Soldaten-
leben als Förster. Es war deshalb auch das Forsthaus des
Ortes, in dem der spätere berühmte Tondichter das Licht
der Welt erblickte. Wie unser Bild den Lesern zeigt, ist es
ein schmuckloses, niedriges Gebäude, dem aber das frische
Grün ringsherum eine anheimelnde Traulichkeit verleiht.
Rechts vom Eingang der Haustür, zu der man über den
kleinen Hof gelangt, ist jetzt eine weiße Marmortafel ange-
bracht, die in goldenen Lettern die Inschrift trägt» „In
diesem Hause wurde der Tondichter Christoph Ritter von Gluck
den 4. July 1714 geboren." Der Geburtstag des Kom-
ponisten ist auf dieser Tafel irrtümlich angegeben, da er,
wie durch neuere Feststellungen erwiesen ist, nicht auf den
4., sondern auf den 2. Juli fiel. Das Geburtszimmer Glucks,
von dem unserer Illustration eine Abbildung beigefügt ist, ist
fast noch in dem ursprünglichen Zustande erhalten^ -Es gleicht
einein einfachen Bauernstübchen mit dein bogigen Fenster, dem
Gestell zum Aushängen der Kleidungsstücke an der Decke und
dem entsprechenden Meublement von >schränken, Bett und
Waschkommode. Schon wenige Jahre später verzog der Vater
nach Neuschloß in Böhmen, sodann nach Kamnitz und Eisen-
berg, wobei St! zum Forstmeister des Fürsten Lobkowitz auf-
rückte, immet nbet blieb der Knabe in inniger Berührung
mit der Natur, dieser Ümstaüd wurde für das Schaffen
des Tondichters tioü eütscheideüder Bedeutung. Was. ihm in
der Jugend Wald utid Aue offenbart hätten, daS schilderte er
später als Meister in deck himmlischen Gefilden des „Orpheus"
und in dem Zaubergllrten der „Armida" in herrlichen Tönen.
Nachdem er bis zum Jahre 1732 das JesuiteNgymNasiuiN in
Komotau besucht hatte, wandte er sich Nach Prag, wo er
sich zum Sänger und Musiker ausbildete. Nach vier Jahren
rief ihn Fürst Lobkowitz nach Wien, um für seine weitere
musikalische Ausbildung Sorge zu tragen. Bei den musi-
kalischen Unterhaltungen im Lobkowitzschen Hause lernte ihn
der lombardische Fürst Melz: kennen, der ihn mit sich nach
Mailand nahm. Hier genoß er den Unterricht von Giovanni
Sammartini. Damals war die italienische Oper in dem
größten Teil Europas die Alleinherrscherin. Sie machte es
sich zur Aufgabe, den Sängern und Sängerinnen Gelegen-
heit zu geben, in Trillern und Kadenzen zu glänzen und zu
schwelgen, und vernachlässigte nahezu völlig den geistigen
Gehalt der Musik. In diesem Stile schrieb auch Gluck noch
seine ersten Opern, wie „Artaxerxes", „Phädra" und „Der
Sturz des Giganten". Selbst als er 1754 nach Wien als
Kapellmeister am Hofoperntheater berufen wurde, blieb er
derselben Richtung noch jahrelang treu. Der Erfolg der
Oper „Antigonus" brachte ihn: die Ernennung zum „Ritter
des goldenen Sporns" durch den Papst ein. Damit er-
warb er das Adelsprädikat. Vom Jahre 1762 an vollzog
sich dann ein Wandel in seiner Kunstanschauung, der in
der 1767 verfaßten Oper „Alceste" den vollen, abgeklärte»:
Ausdruck fand. In ihr stellte Gluck den Grundsatz auf, daß
sich die Musik nicht zur Dieneri»: der Därsteller erniedrigen
dürfe, daß sie vielmehr dem Gang der Handlung entspreche»:
müsse, und daß sie, alle Geziertheit und Künstelei vermeidend,
die Empfindungen der handelnden Personen ii: edler Schön-
heit zu versinnbildlichen habe. Für solche Neuerungen war
damals Deutschland kein geeigneter Boden. Gluck ging des-
halb nach Paris, wo er eher auf Anerkennung rechnen durfte.
Auch hier entbrannte ein heißer Kampf zwischen den Ver-
teidigern der italienischen Oper und den Anhängern des
neue»: Stils, der aber durch die Aufführung der Oper»:
„Iphigenie in Aulis", „Orpheus", „Alceste", „Armida" und
„Iphigenie in Tauris" zu Gunsten Glucks entschieden wurde.
Der jetzt aufs höchste gefeierte Meister blieb bis zum Jahre 1779
in Paris. Dani: kehrte er, reich an Ehren und Besitz, nach
Wien zurück, wo sein Haus auf der „Alten Wieden" zum
Mittelpunkt der vornehinen musikliebenden Kreise und des
jungen Künstlergeschlechts wurde. Dieses Haus, in den: er
auch starb, stellt unser zweites Bild dar. Feri: aller Partei-
fehde, verbrachte Gluck seine letzten Jahre in beschaulicher
Behaglichkeit. Nachdem er schon mehrfach gekränkelt hatte,
erfolgte sein Tod am 15. November 1787. Die Nachricht
von seinen: Ende rief überall tiefe Bewegung hervor. In
Wie»: und Paris veranstaltete man weihevolle Trauerfeiern.
Seine sterbliche»: Reste wurden auf dem Matzleinsdorfer
Friedhof beigesetzt. Sein Grab trägt die kurze, aber treffende
Inschrift: »Kisr rullt ein rsolltsotiuKsnsr äsutsobsr Nanu.
Lin sitri^sr Oürist. Lin trsusr Oatts. Ollristop k liittor
Oiuoie, äsr erimdsnsn l'onllunst grosser Kleister."
Das Amokläufen auf Java.
(Siehe das Süd aut Seite »so.)
der malaiischen Sprache bedeutet rnong-Lwok jemand
ii: blinder Wut töten; unter „Amok" ist aber eine ganz
besondere Art von Tobsuchtsanfttllen zu verstehen, die be-
sonders aus Java leicht solche Männer befällt, die den:
Opiumgenuß stark ergeben sind. Diese Raserei ist eine der
Berserkerwut ähnliche Erregung, in der der Rasende mit
einem Kris, dem Dolch der Javaner, bewaffnet auf die
Straße stürzt und jeden, den: er begegnet, verwundet oder
tötst, bis er selbst eingefangen und, überwältigt oder auch
iin Kampf von seinen Verfolgern getötet wird. Nach dei:
auf Java herrschende»: Gesetzen ist solch ein Amokläufer-
vogelfrei. Die Tobsucht verleiht ihm außerordentliche Kräfte
und es ist daher für seine Verfolger schwer, ihn zu fasse»:
und dingfest zu machen. Man hat diese Tobsucht als eine
Art Opiumrausch aufgefaßt und damit in Zusammenhang
gebracht, daß die Javaner den Opium in der Absicht ge-
nießen, ihren Mut und ihre Todesverachtung zu steigern.
Erscheint ein Amokläufer in der Straße, so entsteht sofort
eine wilde Jagd, denn während er sich auf das nächste
Opfer stürzt, beginnt auch schon seine Verfolgung von feiten
der Zeuge»: seines Erscheinens. Oft dauert diese Jagd sehr-
lange, und es kommt vor, daß der Tobsüchtige mehr als ein
Dutzend Personen verwundet, ehe er überwältigt wird. Man
kennt übrigens auch Fülle, wo Böswillige aus Rachsucht
Amok liefen, ohne voi: zeitweiligem Wahnsinn befalle»: zu
sein, die also den Wahnwitz als Amokläufer heuchelten.
Ferner ist konstatiert, daß viele nur aus Lebensüberdruß
Amok liefen, um durch fremde Hand zu fallen, da den: Ma-
laien seine religiösen Ansichten den Selbstmord verbieten
oder als Entwürdigung erscheinen lassen. Der Drang nach
Selbstvernichtung ist unter einen: Volke desto häufiger, je
wilder und leidenschaftlicher es ist. Der Grundzug des Charak-
ters der Javaner ist Verschlossenheit und Härte, die sich
äußerlich durch ein schweigsames, berechnetes Benehme»: und
einen tiefe»: Ernst offenbaren. Gemessenes Betragen ist allen
Malaien eigen. Die höhere»: Klasse»: sind außerordentlich
höflich und benehmen sich mit all der ruhigen Würde eines
wohlgebildeten Europäers, die sich bei ihnen seltsamerweise
vollkommen verträgt mit der schonungslosen Grausamkeit
und Verachtung des Menschenlebens, welche die düstere Seite
ihres Charakters bilden.
Das Zauberwort.
Stählung von l^rieclrich lüorenzen.
»Nachdruck verboten.)
1.
sahen zusammen am Stammtisch im
„Goldenen Löwen", die vier alten
Freunde, einstmals treue Schulkamera-
den, die sich seit vielen Jahren nicht ge-
sehen und sich nun zufällig in dem kleinen
Neste zusammengefunden hatten. Auf dem Sofa
saß Friedrich Zimmermann, der Ingenieur, der den
Bau einer Bahn in der Nähe leitete, an seiner Seite
Hans v. Bornstedt, der flotteste Leutnant der Gar-
nison, zu beiden Seiten des Tisches hatten Ernst
Gutfeld, der Referendar, und Doktor Alberti, der
vor kurzem sich hier als Arzt niedergelassen hatte,
Platz genommen.
Das Gespräch drehte sich natürlich um das schier
unglaubliche Glück, das dem Ingenieur, dem, ältesten
Freunde, in den Schoß gefallen war.
„Sag' doch bloß, Menfchenskind, wie hast du es
nur angefangen, so schnell etwas zu werden?" fragte
der Referendar. „Du bist erst eben achtundzwanzig
Jahre alt, bist aber schon Direktor einer großen
Firma für Eisenbahnbauten, hast eine ganz selb-
ständige Stellung und ein schwindelhohes Gehalt,
lind die Tantieme, die du so ganz nebenbei ver-
dienst, dürfte mindestens das Zehnfache von dem
ausmachen, was andere Sterbliche imbestenMannes-
alter zu verdienen pflegen. Wenn ich nicht wüßte,
daß du ein kreuzbraver Kerl und ein gläubiger Christ
bist, könnte ich fast glauben, daß du mit bösen Geistern
im Bunde ständest."
„Ach was — dummes Zeug!" warf Doktor Al-
berti ein. „Böse Geister gibt es nicht, höchstens in
der Phantasie alter Weiber. Friedrichs Erfolge sind
leicht erklärlich: er verdankt sie einzig und allein
seiner Tüchtigkeit und seinen hervorragenden Lei-
stungen. Denkt nur an die Examina, die er ge-
macht hat!"
Doch der Referendar beharrte auf seiner An-
sicht. „Alles das istmoch keine genügende Erklärung
für das unheimliche Glück, das unser Jngenieur^bei
allen seinen Unternehmungen gehabt hat. Sind
ihm doch wiederholt Sachen gelungen, die die her-
vorragendsten Sachverständigen für unausführbar
erklärt haben. Fleißig und tüchtig find viele, mancher
hat ein noch besseres Examen als Friedrich gemacht
und doch kommt er nicht vorwärts, verliert sich in
der Menge, bleibt sein ganzes Leben ein armer
Teufel. Nein, ich bleibe dabei, alle natürlichen
Erklärungen versagen gegenüber den Erfolgen unseres
Freundes. Wer das Glück so zu fesseln weiß, der
muß über andere Mittel verfügen, als gewöhnliche
Sterbliche sie besitzen."
Nun nahm der Ingenieur selbst das Wort.
„Unser Referendärchen hat recht, und euch, meinen
lieben Freunden, will ich es denn verraten, daß
ich mein Glück und meine Erfolge zum größten
Teil einem — Zauberwort verdanke, das ich von
einem alten Araber in der Wüste erfahren habe."
„Wie? — Was? — Zauberwort?!" riefen alle
durcheinander.
Der Referendar schüttelte zweifelnd den Kopf
und schaute den Freund verdutzt an; er wußte offen-
bar nicht recht, ob der sich über ihn lustig mache
oder im Ernst spräche.
Der skeptische Doktor aber rief lachend und drohte
dabei mit dem Finger: „Oller Schwindelmeier!
Wir sind zwar nicht mehr beim ersten Glas, aber
doch noch nicht so weit, daß du uns so etwas vor-
setzen kannst!"
' Doch der Ingenieur entgegnete ruhig: „Nichts
liegt mir ferner, als euch etwas vorzuschwindeln.
Ich wiederhole, daß ich mein Glück und meine Er-
folge zum größten Teil einem Zauberwort ver-
danke, das ich von einem alten Araber gehört habe.
Wenn es euch interessiert, will ich die Geschichte
gern erzählen. — Aber ich muß erst was zu trinken
haben, die Kehle ist mir trocken geworden. — Heda
— Fritz! Einen frischen Schoppen!"
„Uns auch!" riefen die anderen.
Fritz tänzelte mit wehenden Frackschößen zum
Büfett' und brachte eilfertig die frischgefüllten,
prächtig schäumenden Deckelgläser wieder. „Trifft
sich gut," schmunzelte er, „'s ist eben frisch an-
gesteckt!"
Die vier Freunde stießen mit ihren Gläsern an
und stärkten sich durch einen kräftigen Schluck.
Dann sagte der Doktor: „Na, Fritz, schieß mal los!
Bin höllisch gespannt auf deine Geschichte. Auch
ein erwachsener, vernünftiger Mensch hört ein
arabisches Machen gern."