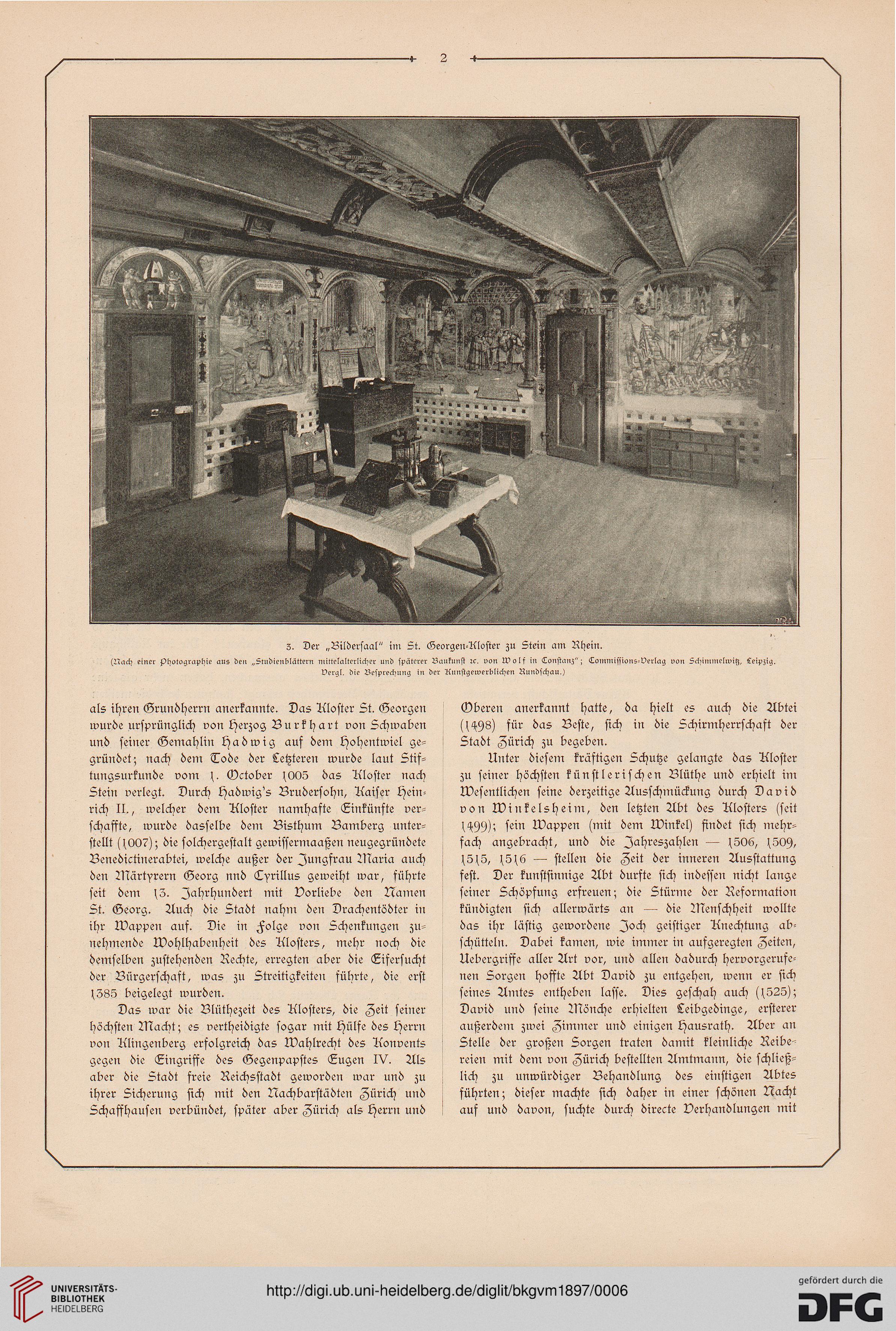3. Der „Bildersaal" im St. Georgen-Aloster zu Stein am Rhein.
(Nach einer Photographie aus den „Studienblättern nlittelalterlicher und späterer Baukunst rc. von Wolf in Lonstanz"; Lommissions-Verlag von Schimmelwitz, Leipzig.
vergl. die Besprechung in der kunstgewerblichen Bundschau.)
als ihren Grundherrn anerkannte. Das Kloster St. Georgen
wurde ursprünglich von Herzog Burk hart von Schwaben
und seiner Gemahlin hadwig auf dein Hohentwiel ge-
gründet; nach dem Tode der Letzteren wurde laut Stif-
tungsurkunde vom f. October f005 das Kloster nach
Stein verlegt. Durch hadwig's Brudersohn, Kaiser Hein-
rich II., welcher dem Kloster namhafte Einkünfte ver-
schaffte, wurde dasselbe dein Bisthum Bamberg unter-
stellt (s007); die solchergestalt gewissermaaßen neugegründete
Benedictinerabtei, welche außer der Jungfrau Maria auch
den Märtyrern Georg und Eyrillus geweiht war, führte
seit dem s3. Jahrhundert mit Vorliebe den Namen
5t. Georg. Auch die 5tadt nahm den Drachentödter in
ihr Mappen auf. Die in Folge von 5chenkungen zu
nehmende Mohlhabenheit des Klosters, mehr noch die
demselben zustehenden Rechte, erregten aber die Eifersucht
der Bürgerschaft, was zu 5treitigkeiten führte, die erst
f385 beigelegt wurden.
Das war die Blüthezeit des Klosters, die Zeit seiner
höchsten Macht; es vertheidigte sogar mit hülfe des Herrn
von Klingenberg erfolgreich das Mahlrecht des Konvents
gegen die Eiligriffe des Gegenpapstes Eugen IV. Als
aber die 5tadt freie Reichsstadt geworden war und zu
ihrer Sicherung sich mit den Nachbarstädten Zürich und
5chaffhausen verbündet, später aber Zürich als Herrn und
X_
Oberen anerkannt hatte, da hielt es auch die Abtei
(1^98) für das Beste, sich in die Schirmherrschaft der
5tadt Zürich zu begeben.
Unter diesein kräftigen Schutze gelangte das Kloster
zu seiner höchsten künstlerischen Blüthe und erhielt in:
Wesentlichen seine derzeitige Ausschmückung durch David
von Winkelsheim, den letzten Abt des Klosters heit
sq.99); fein Wappen (mit dem Winkel) findet sich mehr-
fach angebracht, und die Jahreszahlen — 1506, f509,
\5\5, f5f6 — stellen die Zeit der inneren Ausstattung
fest. Der kunstsinnige Abt durfte sich indessen nicht lange
seiner Schöpfung erfreuen; die Stürme der Reformation
kündigten sich allerwärts an — die Menschheit wollte
das ihr lästig gewordene Joch geistiger Knechtung ab-
schütteln. Dabei kamen, wie immer in aufgeregten Zeiten,
Uebergriffe aller Art vor, und allen dadurch hervorgerufe-
nen Sorgen hoffte Abt David zu entgehen, wenn er sich
seines Amtes entheben lasse. Dies geschah auch (\525);
David und seine Mönche erhielten Leibgedinge, ersterer
außerdem zwei Zimmer uud einigen Hausrath. Aber an
Stelle der großen Sorgen traten damit kleinliche Reibe
reien mit dem von Zürich bestellten Amtmann, die schließ-
lich zu unwürdiger Behandlung des einstigen Abtes
führten; dieser machte sich daher in einer schönen Nacht
auf und davon, suchte durch directe Verhandlungen mit
/
(Nach einer Photographie aus den „Studienblättern nlittelalterlicher und späterer Baukunst rc. von Wolf in Lonstanz"; Lommissions-Verlag von Schimmelwitz, Leipzig.
vergl. die Besprechung in der kunstgewerblichen Bundschau.)
als ihren Grundherrn anerkannte. Das Kloster St. Georgen
wurde ursprünglich von Herzog Burk hart von Schwaben
und seiner Gemahlin hadwig auf dein Hohentwiel ge-
gründet; nach dem Tode der Letzteren wurde laut Stif-
tungsurkunde vom f. October f005 das Kloster nach
Stein verlegt. Durch hadwig's Brudersohn, Kaiser Hein-
rich II., welcher dem Kloster namhafte Einkünfte ver-
schaffte, wurde dasselbe dein Bisthum Bamberg unter-
stellt (s007); die solchergestalt gewissermaaßen neugegründete
Benedictinerabtei, welche außer der Jungfrau Maria auch
den Märtyrern Georg und Eyrillus geweiht war, führte
seit dem s3. Jahrhundert mit Vorliebe den Namen
5t. Georg. Auch die 5tadt nahm den Drachentödter in
ihr Mappen auf. Die in Folge von 5chenkungen zu
nehmende Mohlhabenheit des Klosters, mehr noch die
demselben zustehenden Rechte, erregten aber die Eifersucht
der Bürgerschaft, was zu 5treitigkeiten führte, die erst
f385 beigelegt wurden.
Das war die Blüthezeit des Klosters, die Zeit seiner
höchsten Macht; es vertheidigte sogar mit hülfe des Herrn
von Klingenberg erfolgreich das Mahlrecht des Konvents
gegen die Eiligriffe des Gegenpapstes Eugen IV. Als
aber die 5tadt freie Reichsstadt geworden war und zu
ihrer Sicherung sich mit den Nachbarstädten Zürich und
5chaffhausen verbündet, später aber Zürich als Herrn und
X_
Oberen anerkannt hatte, da hielt es auch die Abtei
(1^98) für das Beste, sich in die Schirmherrschaft der
5tadt Zürich zu begeben.
Unter diesein kräftigen Schutze gelangte das Kloster
zu seiner höchsten künstlerischen Blüthe und erhielt in:
Wesentlichen seine derzeitige Ausschmückung durch David
von Winkelsheim, den letzten Abt des Klosters heit
sq.99); fein Wappen (mit dem Winkel) findet sich mehr-
fach angebracht, und die Jahreszahlen — 1506, f509,
\5\5, f5f6 — stellen die Zeit der inneren Ausstattung
fest. Der kunstsinnige Abt durfte sich indessen nicht lange
seiner Schöpfung erfreuen; die Stürme der Reformation
kündigten sich allerwärts an — die Menschheit wollte
das ihr lästig gewordene Joch geistiger Knechtung ab-
schütteln. Dabei kamen, wie immer in aufgeregten Zeiten,
Uebergriffe aller Art vor, und allen dadurch hervorgerufe-
nen Sorgen hoffte Abt David zu entgehen, wenn er sich
seines Amtes entheben lasse. Dies geschah auch (\525);
David und seine Mönche erhielten Leibgedinge, ersterer
außerdem zwei Zimmer uud einigen Hausrath. Aber an
Stelle der großen Sorgen traten damit kleinliche Reibe
reien mit dem von Zürich bestellten Amtmann, die schließ-
lich zu unwürdiger Behandlung des einstigen Abtes
führten; dieser machte sich daher in einer schönen Nacht
auf und davon, suchte durch directe Verhandlungen mit
/