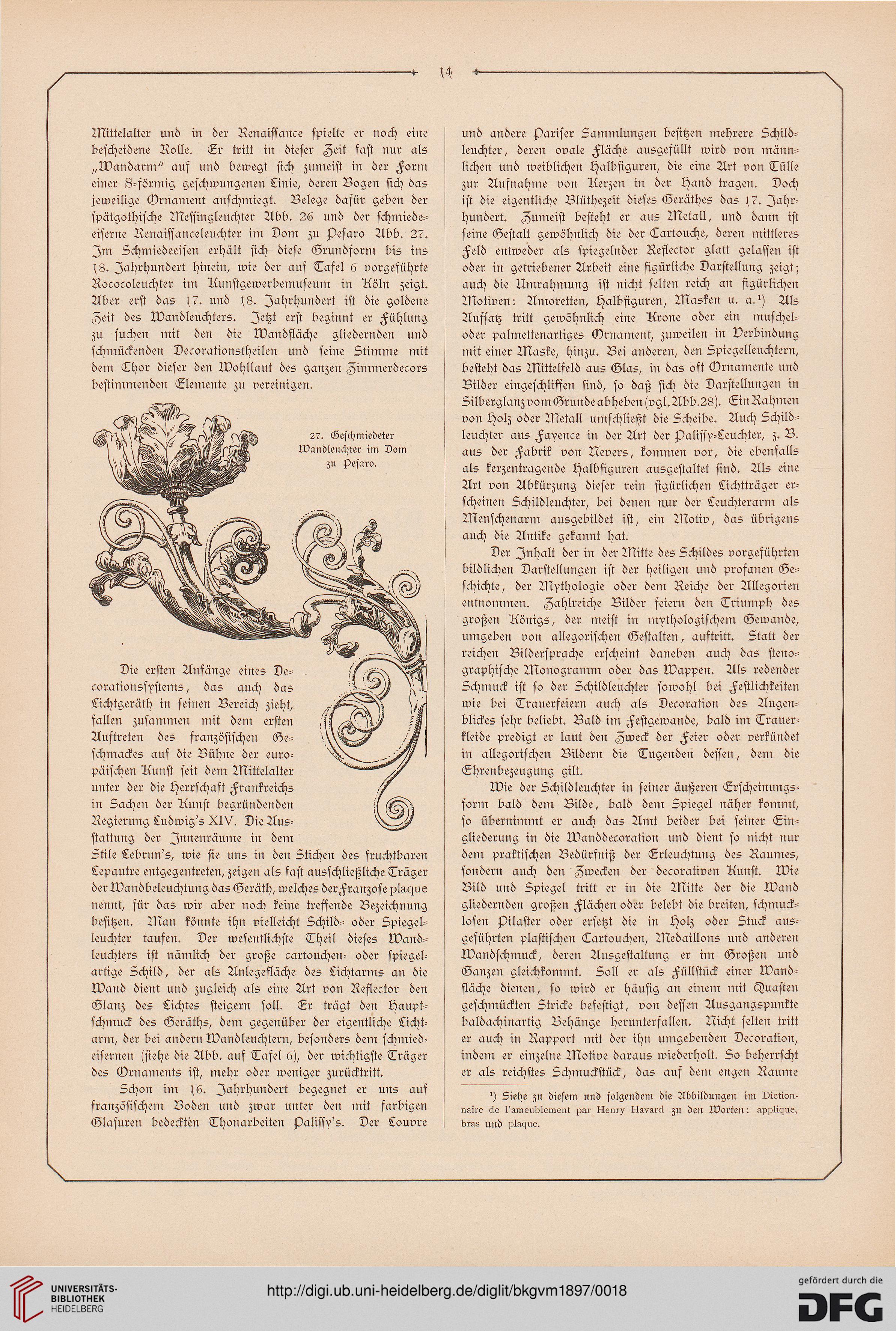Mittelalter und in der Renaissance spielte er noch eine
bescheidene Rolle. Tr tritt in dieser Zeit fast nur als
„Wandarm" auf und bewegt sich zumeist in der Form
einer 8-förmig geschwungenen Linie, deren Bogen sich das
jeweilige Ornament anschmiegt. Belege dafür geben der
spätgothische Messingleuchter Abb. 26 und der schmiede-
eiserne Renaissanceleuchter im Dom zu pesaro Abb. 27.
jm Schmiedeeisen erhält sich diese Grundform bis ins
\8. Jahrhundert hinein, wie der auf Tafel 6 vorgeführte
Rococoleuchter im Kunstgewerbemuseum in Adln zeigt.
Aber erst das f7. und f8. Zahrhundert ist die goldene
Zeit des Wandleuchters. 3^ erst beginnt er Fühlung
zu suchen mit den die Wandfläche gliedernden und
schmückenden Decorationstheilen und feine Stimme mit
dem Thor dieser den Wohllaut des ganzen Zimmerdecors
bestimmenden Elemente zu vereinigen.
27. Geschmiedeter
Wandleuckter in» Dom
zu Pesaro.
Die ersten Anfänge eines De- -
corationsfystems, das auch das
Lichtgeräth in feinen Bereich zieht,
fallen zusammen mit dem ersten
Auftreten des französischen Ge-
schmackes auf die Bühne der euro-
päischen Kunst seit dem Mittelalter
unter der die Herrschaft Frankreichs
in Sachen der Aunst begründenden
Regierung Ludwig's XIV. Die Aus-
stattung der 3unenräume in dem
Stile Lebrun's, wie sie uns in den Stichen des fruchtbaren
Lepautre entgegentreten, zeigen als fast ausschließliche Träger
der Waudbeleuchtuug das Geräth, welches derFranzose plaque
nennt, für das wir aber noch keine treffende Bezeichnung
besitzen. Man könnte ihn vielleicht Schild- oder Spiegel-
leuchter taufen. Der wesentlichste Theil dieses Wand-
leuchters ist nämlich der große cartouchen- oder spiegel-
artige Schild, der als Anlegefläche des Lichtarms an die
Wand dient und zugleich als eine Art von Reflector den
Glanz des Lichtes steigern soll. Tr trägt den Haupt-
schmuck des Geräths, dem gegenüber der eigentliche Licht-
arm, der bei andern Wandleuchtern, besonders dem fchmied-
eifernen (siehe die Abb. auf Tafel 6), der wichtigste Träger
des Ornaments ist, mehr oder weniger zurücktritt.
Schon im j6. 3ahrhundert begegnet er uns auf
französischem Boden und zwar unter den mit farbigen
Glasuren bedeckten Thonarbeiten Palissy's. Der Louvre
und andere pariser Sammlungen besitzen mehrere Schild-
leuchter, deren ovale Fläche ausgesüllt wird von männ-
lichen und weiblichen Halbfiguren, die eine Art von Tülle
zur Aufnahme von Kerzen in der Hand tragen. Doch
ist die eigentliche Blüthezeit dieses Geräthes das \7. (Jahr-
hundert. Zumeist besteht er aus Metall, und dann ist
seine Gestalt gewöhnlich die der Lartouche, deren mittleres
Feld entweder als spiegelnder Reflector glatt gelassen ist
oder in getriebener Arbeit eine figürliche Darstellung zeigt;
auch die Umrahmung ist nicht selten reich an figürlichen
Motiven: Amoretten, Halbfiguren, Masken u. a.') Als
Aufsatz tritt gewöhnlich eine Krone oder ein muschel-
oder palmettenartiges Ornament, zuweilen in Verbindung
mit einer Maske, hinzu. Bei anderen, den Spiegelleuchtern,
besteht das Mittelfeld aus Glas, in das oft Ornamente und
Bilder eingeschliffen sind, so daß sich die Darstellungen in
Silberglanz vom Grunde abheben (vgl. Abb.28). Tin Rahmen
von Holz oder Metall umschließt die Scheibe. Auch Schild-
leuchter aus Fayence in der Art der Paliffy-Leuchter, z. B.
aus der Fabrik von Nevers, kommen vor, die ebenfalls
als kerzentragende Halbfiguren ausgestaltet sind. Als eins
Art von Abkürzung dieser rein figürlichen Lichtträger er-
scheinen Schildleuchter, bei denen nur der Leuchterarm als
Menschenarm ausgebildet ist, ein Motiv, das übrigens
auch die Antike gekannt hat.
Der Zuhalt der in der Mitte des Schildes vorgeführten
bildlichen Darstellungen ist der heiligen und profanen Ge-
schichte, der Mythologie oder dem Reiche der Allegorien
entnommen. Zahlreiche Bilder feiern den Triumph des
großen Königs, der meist in mythologischem Gewände,
umgeben von allegorischen Gestalten, auftritt. Statt der
reichen Bildersprache erscheint daneben auch das steno-
graphische Monogramm oder das Wappen. Als redender
Schmuck ist so der Schildleuchter sowohl bei Festlichkeiten
wie bei Trauerfeiern auch als Decoration des Augen-
blickes sehr beliebt. Bald im Festgewande, bald im Trauer-
kleide predigt er laut den Zweck der Feier oder verkündet
in allegorischen Bildern die Tugenden dessen, dem die
Threnbezeuguug gilt.
Wie der Schildleuchter in seiner äußeren Trscheinungs-
form bald dem Bilde, bald dem Spiegel näher kommt,
so übernimmt er auch das Amt beider bei seiner Tin-
gliederung in die Wanddecoration und dient so nicht nur
dem praktischen Bedürfniß der Erleuchtung des Raumes,
sondern auch den Zwecken der decorativen Kunst. Wie
Bild und Spiegel tritt er in die Mitte der die Wand
gliedernden großen Flächen oder belebt die breiten, schmuck-
losen Pilaster oder ersetzt die in Holz oder Stuck aus-
geführten plastischen Tartouchen, Aledaillons und anderen
Wandschmuck, deren Ausgestaltung er im Großen und
Ganzen gleichkommt. Soll er als Füllstück einer Wand-
fläche dienen, so wird er häufig an einem mit Quasten
geschmückten Stricke befestigt, von dessen Ausgangspunkte
baldachinartig Behänge herunterfallen. Nicht selten tritt
er auch in Rapport mit der ihn umgebenden Decoration,
indem er einzelne Motive daraus wiederholt. So beherrscht
er als reichstes Schmuckstück, das auf dem engen Raume *)
*) Siehe zu diesem und folgendem die Abbildungen im Diction-
naire de l’ameublement par Henry Havard zu den Worten: applique,
bras und plaque.
bescheidene Rolle. Tr tritt in dieser Zeit fast nur als
„Wandarm" auf und bewegt sich zumeist in der Form
einer 8-förmig geschwungenen Linie, deren Bogen sich das
jeweilige Ornament anschmiegt. Belege dafür geben der
spätgothische Messingleuchter Abb. 26 und der schmiede-
eiserne Renaissanceleuchter im Dom zu pesaro Abb. 27.
jm Schmiedeeisen erhält sich diese Grundform bis ins
\8. Jahrhundert hinein, wie der auf Tafel 6 vorgeführte
Rococoleuchter im Kunstgewerbemuseum in Adln zeigt.
Aber erst das f7. und f8. Zahrhundert ist die goldene
Zeit des Wandleuchters. 3^ erst beginnt er Fühlung
zu suchen mit den die Wandfläche gliedernden und
schmückenden Decorationstheilen und feine Stimme mit
dem Thor dieser den Wohllaut des ganzen Zimmerdecors
bestimmenden Elemente zu vereinigen.
27. Geschmiedeter
Wandleuckter in» Dom
zu Pesaro.
Die ersten Anfänge eines De- -
corationsfystems, das auch das
Lichtgeräth in feinen Bereich zieht,
fallen zusammen mit dem ersten
Auftreten des französischen Ge-
schmackes auf die Bühne der euro-
päischen Kunst seit dem Mittelalter
unter der die Herrschaft Frankreichs
in Sachen der Aunst begründenden
Regierung Ludwig's XIV. Die Aus-
stattung der 3unenräume in dem
Stile Lebrun's, wie sie uns in den Stichen des fruchtbaren
Lepautre entgegentreten, zeigen als fast ausschließliche Träger
der Waudbeleuchtuug das Geräth, welches derFranzose plaque
nennt, für das wir aber noch keine treffende Bezeichnung
besitzen. Man könnte ihn vielleicht Schild- oder Spiegel-
leuchter taufen. Der wesentlichste Theil dieses Wand-
leuchters ist nämlich der große cartouchen- oder spiegel-
artige Schild, der als Anlegefläche des Lichtarms an die
Wand dient und zugleich als eine Art von Reflector den
Glanz des Lichtes steigern soll. Tr trägt den Haupt-
schmuck des Geräths, dem gegenüber der eigentliche Licht-
arm, der bei andern Wandleuchtern, besonders dem fchmied-
eifernen (siehe die Abb. auf Tafel 6), der wichtigste Träger
des Ornaments ist, mehr oder weniger zurücktritt.
Schon im j6. 3ahrhundert begegnet er uns auf
französischem Boden und zwar unter den mit farbigen
Glasuren bedeckten Thonarbeiten Palissy's. Der Louvre
und andere pariser Sammlungen besitzen mehrere Schild-
leuchter, deren ovale Fläche ausgesüllt wird von männ-
lichen und weiblichen Halbfiguren, die eine Art von Tülle
zur Aufnahme von Kerzen in der Hand tragen. Doch
ist die eigentliche Blüthezeit dieses Geräthes das \7. (Jahr-
hundert. Zumeist besteht er aus Metall, und dann ist
seine Gestalt gewöhnlich die der Lartouche, deren mittleres
Feld entweder als spiegelnder Reflector glatt gelassen ist
oder in getriebener Arbeit eine figürliche Darstellung zeigt;
auch die Umrahmung ist nicht selten reich an figürlichen
Motiven: Amoretten, Halbfiguren, Masken u. a.') Als
Aufsatz tritt gewöhnlich eine Krone oder ein muschel-
oder palmettenartiges Ornament, zuweilen in Verbindung
mit einer Maske, hinzu. Bei anderen, den Spiegelleuchtern,
besteht das Mittelfeld aus Glas, in das oft Ornamente und
Bilder eingeschliffen sind, so daß sich die Darstellungen in
Silberglanz vom Grunde abheben (vgl. Abb.28). Tin Rahmen
von Holz oder Metall umschließt die Scheibe. Auch Schild-
leuchter aus Fayence in der Art der Paliffy-Leuchter, z. B.
aus der Fabrik von Nevers, kommen vor, die ebenfalls
als kerzentragende Halbfiguren ausgestaltet sind. Als eins
Art von Abkürzung dieser rein figürlichen Lichtträger er-
scheinen Schildleuchter, bei denen nur der Leuchterarm als
Menschenarm ausgebildet ist, ein Motiv, das übrigens
auch die Antike gekannt hat.
Der Zuhalt der in der Mitte des Schildes vorgeführten
bildlichen Darstellungen ist der heiligen und profanen Ge-
schichte, der Mythologie oder dem Reiche der Allegorien
entnommen. Zahlreiche Bilder feiern den Triumph des
großen Königs, der meist in mythologischem Gewände,
umgeben von allegorischen Gestalten, auftritt. Statt der
reichen Bildersprache erscheint daneben auch das steno-
graphische Monogramm oder das Wappen. Als redender
Schmuck ist so der Schildleuchter sowohl bei Festlichkeiten
wie bei Trauerfeiern auch als Decoration des Augen-
blickes sehr beliebt. Bald im Festgewande, bald im Trauer-
kleide predigt er laut den Zweck der Feier oder verkündet
in allegorischen Bildern die Tugenden dessen, dem die
Threnbezeuguug gilt.
Wie der Schildleuchter in seiner äußeren Trscheinungs-
form bald dem Bilde, bald dem Spiegel näher kommt,
so übernimmt er auch das Amt beider bei seiner Tin-
gliederung in die Wanddecoration und dient so nicht nur
dem praktischen Bedürfniß der Erleuchtung des Raumes,
sondern auch den Zwecken der decorativen Kunst. Wie
Bild und Spiegel tritt er in die Mitte der die Wand
gliedernden großen Flächen oder belebt die breiten, schmuck-
losen Pilaster oder ersetzt die in Holz oder Stuck aus-
geführten plastischen Tartouchen, Aledaillons und anderen
Wandschmuck, deren Ausgestaltung er im Großen und
Ganzen gleichkommt. Soll er als Füllstück einer Wand-
fläche dienen, so wird er häufig an einem mit Quasten
geschmückten Stricke befestigt, von dessen Ausgangspunkte
baldachinartig Behänge herunterfallen. Nicht selten tritt
er auch in Rapport mit der ihn umgebenden Decoration,
indem er einzelne Motive daraus wiederholt. So beherrscht
er als reichstes Schmuckstück, das auf dem engen Raume *)
*) Siehe zu diesem und folgendem die Abbildungen im Diction-
naire de l’ameublement par Henry Havard zu den Worten: applique,
bras und plaque.