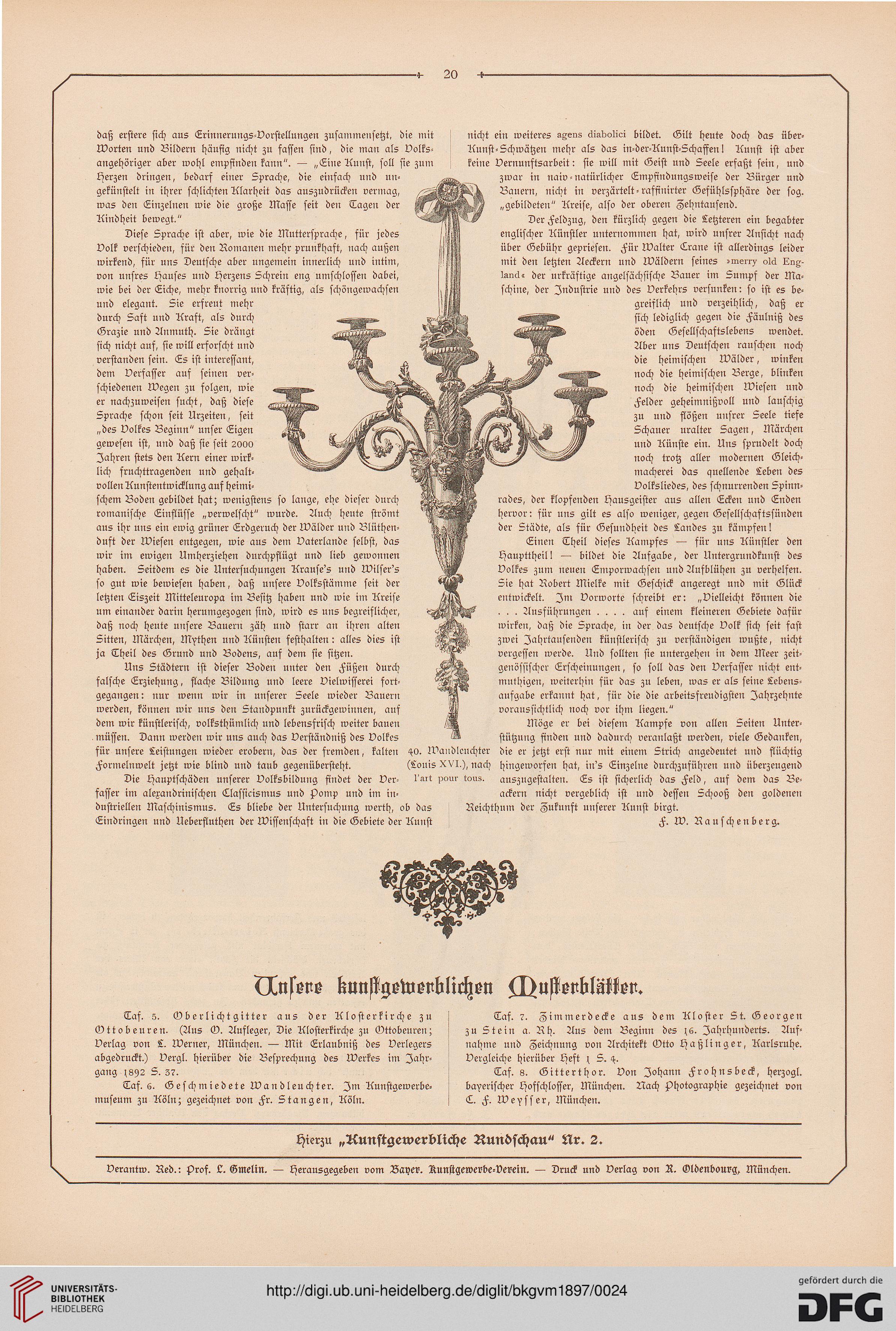■4- 20
daß erstere sich aus Erinnerungs-Vorstellungen zusammensetzt, die mit
Worten und Bildern häufig nicht zu fassen sind, die man als Volks-
angehöriger aber wohl empfinden kann". — „Line Kuust, soll sie zum
Herzen dringen, bedarf einer Sprache, die einfach und un-
gekünstelt in ihrer schlichten Klarheit das auszudrücken vermag,
was den Einzelnen wie die große Nasse seit den Tagen der
Kindheit bewegt."
Diese Sprache ist aber, wie die Muttersprache, für jedes
Volk verschieden, für den Romanen mehr xrunkhaft, nach außen
wirkend, für uns Deutsche aber ungemein innerlich und intim,
von unsres Hauses und Herzens Schrein eng umschlossen dabei,
wie bei der Eiche, mehr knorrig und kräftig, als schöngewachsen
und elegant. Sie erfreut mehr
durch Saft und Kraft, als durch
Grazie und Anmuth. Sie drängt
sich nicht auf, sie will erforscht und
verstanden sein. Es ist interessant,
dem Verfasser auf seinen ver-
schiedenen Wegen zu folgen, wie
er nachzuweisen sucht, daß diese
Sprache schon seit Urzeiten, seit
„des Volkes Beginn" unser Eigen
gewesen ist, und daß sie seit 2000
Jahren stets den Kern einer wirk-
lich fruchttragenden und gehalt-
vollen Kunstentwicklung auf heimi-
schem Boden gebildet hat; wenigstens so lange, ehe dieser durch
romanische Einflüsse „verwelscht" wurde. Auch heute strömt
aus ihr uns ein ewig grüner Erdgeruch der Wälder und Blüthen-
duft der Wiesen entgegen, wie aus dem Vaterlande selbst, das
wir im ewigen Umherziehen durchpflügt und lieb gewonnen
haben. Seitdem es die Untersuchungen Krause's und wilser's
so gut wie bewiesen haben, daß unsere Volksstämme seit der
letzten Eiszeit Nitteleuroxa im Besitz haben und wie im Kreise
um einander darin herumgezogen sind, wird es uns begreiflicher,
daß noch heute unsere Bauern zäh und starr an ihren alten
Sitten, Märchen, Mythen und Künsten sesthalten: alles dies ist
ja Theil des Grund und Bodens, auf dem sie sitzen.
Uns Städtern ist dieser Boden unter den Füßen durch
falsche Erziehung, flache Bildung und leere Vielwisserei fort-
gegangen: nur wenn wir in unserer Seele wieder Bauern
werden, können wir uns den Standpunkt zurückgewinnen, auf
dem wir künstlerisch, volksthümlich und lebensfrisch weiter bauen
. müssen. Dann werden wir uns auch das verständniß des Volkes
für unsere Leistungen wieder erobern, das der fremden, kalten
Formelnwelt jetzt wie blind und taub gegenübersteht.
Die Hauxtschäden unserer Volksbildung findet der Ver-
fasser im alexandrinischen Llassicismus und Pomp und im in-
dustriellen Maschinismus. Es bliebe der Untersuchung werth, ob das
Eindringen und Ueberfluthen der Wissenschaft in die Gebiete der Kunst
^0. Wandlcnchter
(Louis XVI.), nach
l’art pour tous.
nicht ein weiteres agens diabolici bildet. Gilt heute doch das über-
Kunst-Schwätzen mehr als das in-der-Kunst-Schaffen! Kunst ist aber
keine Vernunftsarbeit: sie will mit Geist und Seele erfaßt sein, und
zwar in naiv-natürlicher Lmxfindungsweise der Bürger und
Bauern, nicht in verzärtelt - raffinirter Gefühlssxhäre der sog.
„gebildeten" Kreise, also der oberen Zehntausend.
Der Feldzug, den kürzlich gegen die Letzteren ein begabter
englischer Künstler unternommen hat, wird unsrer Ansicht nach
über Gebühr gepriesen. Für Walter Erane ist allerdings leider
mit den letzten Aeckern und Wäldern seines »merry old Eng-
land» der urkräftige angelsächsische Bauer im Sumpf der Ma-
schine, der Industrie und des Verkehrs versunken: so ist es be-
greiflich und verzeihlich, daß er
sich lediglich gegen die Fäulniß des
öden Gefellschaftslebens wendet.
Aber uns Deutschen rauschen noch
die heimischen Wälder, winken
noch die heimischen Berge, blinken
noch die heimischen wiesen und
Felder geheimnißvoll und lauschig
zu und flößen unsrer Seele tiefe
Schauer uralter Sagen, Märchen
und Künste ein. Uns sprudelt doch
noch trotz aller modernen Gleich-
macherei das quellende Leben des
Volksliedes, des schnurrenden Spinn-
rades, der klopfenden Hausgeister aus allen Ecken und Enden
hervor: für uns gilt es also weniger, gegen Gesellschaftssünden
der Städte, als für Gesundheit des Landes zu kämpfen!
Einen Theil dieses Kampfes — für uns Künstler den
Hauxttheil! — bildet die Aufgabe, der Untergrundkunst des
Volkes zum neuen Emxorwachsen und Aufblühen zu verhelfen.
Sie hat Robert Mielke mit Geschick angeregt und mit Glück
entwickelt. Im Vorworte schreibt er: „Vielleicht können die
. . . Ausführungen .... auf einem kleineren Gebiete dafür
wirken, daß die Sprache, in der das deutsche Volk sich seit fast
zwei Jahrtausenden künstlerisch zu verständigen wußte, nicht
vergessen werde. Und sollten sie untergehen in dem Meer zeit-
genössischer Erscheinungen, so soll das den Verfasser nicht ent-
muthigen, weiterhin für das zu leben, was er als seine Lebens-
aufgabe erkannt hat, für die die arbeitsfreudigsten Jahrzehnte
voraussichtlich noch vor ihm liegen."
Möge er bei diesem Kampfe von allen Seiten Unter-
stützung finden und dadurch veranlaßt werden, viele Gedanken,
die er jetzt erst nur mit einem Strich angedeutet und flüchtig
hingeworfen hat, in's Einzelne durchzuführen und überzeugend
auszugestalten. Es ist sicherlich das Feld, auf dem das Be-
ackern nicht vergeblich ist und dessen Schooß den goldenen
Reichthnni der Zukunft unserer Kunst birgt.
F. W. Rauschender g.
Unsere kunstgewerblichen (DusterblMer.
Taf. 5. Bb erlicht gitter aus der Klosterkirche zu
Gttobeuren. (Aus G. Aufleger, Die Klosterkirche zu Gttobeuren;
Verlag von L. Werner, München. — Mit Erlaubniß des Verlegers
abgedruckt.) vergl. hierüber die Besprechung des Werkes im Jahr-
gang 1892 S. 37.
Taf. s. Geschmiedete Wandleuchter. Im Kunstgewerbe-
museum zu Köln; gezeichnet von Fr. Stangen, Köln.
Taf. 7. Zimmerdecke aus dem Kloster St. Georgen
zu Stein a. Rh. Aus dem Beginn des is. Jahrhunderts. Auf-
nahme und Zeichnung von Architekt Btto Haßlinger, Karlsruhe.
Vergleiche hierüber Heft 1 S.
Taf. 8. Gitterthor. Von Johann Frohnsbeck, Herzog!,
bayerischer Hofschlosser, München. Nach Photographie gezeichnet von
E. F. Weysser, München.
hierzu „kunstgewerbliche Rundschau" Ar. 2.
verantw. Red.: Prof. L. Gmelin. — Herausgegeben vom Bayer. Lunstgerverbe-Verein. — Druck und Verlag von R. Gldenbourg, München.
daß erstere sich aus Erinnerungs-Vorstellungen zusammensetzt, die mit
Worten und Bildern häufig nicht zu fassen sind, die man als Volks-
angehöriger aber wohl empfinden kann". — „Line Kuust, soll sie zum
Herzen dringen, bedarf einer Sprache, die einfach und un-
gekünstelt in ihrer schlichten Klarheit das auszudrücken vermag,
was den Einzelnen wie die große Nasse seit den Tagen der
Kindheit bewegt."
Diese Sprache ist aber, wie die Muttersprache, für jedes
Volk verschieden, für den Romanen mehr xrunkhaft, nach außen
wirkend, für uns Deutsche aber ungemein innerlich und intim,
von unsres Hauses und Herzens Schrein eng umschlossen dabei,
wie bei der Eiche, mehr knorrig und kräftig, als schöngewachsen
und elegant. Sie erfreut mehr
durch Saft und Kraft, als durch
Grazie und Anmuth. Sie drängt
sich nicht auf, sie will erforscht und
verstanden sein. Es ist interessant,
dem Verfasser auf seinen ver-
schiedenen Wegen zu folgen, wie
er nachzuweisen sucht, daß diese
Sprache schon seit Urzeiten, seit
„des Volkes Beginn" unser Eigen
gewesen ist, und daß sie seit 2000
Jahren stets den Kern einer wirk-
lich fruchttragenden und gehalt-
vollen Kunstentwicklung auf heimi-
schem Boden gebildet hat; wenigstens so lange, ehe dieser durch
romanische Einflüsse „verwelscht" wurde. Auch heute strömt
aus ihr uns ein ewig grüner Erdgeruch der Wälder und Blüthen-
duft der Wiesen entgegen, wie aus dem Vaterlande selbst, das
wir im ewigen Umherziehen durchpflügt und lieb gewonnen
haben. Seitdem es die Untersuchungen Krause's und wilser's
so gut wie bewiesen haben, daß unsere Volksstämme seit der
letzten Eiszeit Nitteleuroxa im Besitz haben und wie im Kreise
um einander darin herumgezogen sind, wird es uns begreiflicher,
daß noch heute unsere Bauern zäh und starr an ihren alten
Sitten, Märchen, Mythen und Künsten sesthalten: alles dies ist
ja Theil des Grund und Bodens, auf dem sie sitzen.
Uns Städtern ist dieser Boden unter den Füßen durch
falsche Erziehung, flache Bildung und leere Vielwisserei fort-
gegangen: nur wenn wir in unserer Seele wieder Bauern
werden, können wir uns den Standpunkt zurückgewinnen, auf
dem wir künstlerisch, volksthümlich und lebensfrisch weiter bauen
. müssen. Dann werden wir uns auch das verständniß des Volkes
für unsere Leistungen wieder erobern, das der fremden, kalten
Formelnwelt jetzt wie blind und taub gegenübersteht.
Die Hauxtschäden unserer Volksbildung findet der Ver-
fasser im alexandrinischen Llassicismus und Pomp und im in-
dustriellen Maschinismus. Es bliebe der Untersuchung werth, ob das
Eindringen und Ueberfluthen der Wissenschaft in die Gebiete der Kunst
^0. Wandlcnchter
(Louis XVI.), nach
l’art pour tous.
nicht ein weiteres agens diabolici bildet. Gilt heute doch das über-
Kunst-Schwätzen mehr als das in-der-Kunst-Schaffen! Kunst ist aber
keine Vernunftsarbeit: sie will mit Geist und Seele erfaßt sein, und
zwar in naiv-natürlicher Lmxfindungsweise der Bürger und
Bauern, nicht in verzärtelt - raffinirter Gefühlssxhäre der sog.
„gebildeten" Kreise, also der oberen Zehntausend.
Der Feldzug, den kürzlich gegen die Letzteren ein begabter
englischer Künstler unternommen hat, wird unsrer Ansicht nach
über Gebühr gepriesen. Für Walter Erane ist allerdings leider
mit den letzten Aeckern und Wäldern seines »merry old Eng-
land» der urkräftige angelsächsische Bauer im Sumpf der Ma-
schine, der Industrie und des Verkehrs versunken: so ist es be-
greiflich und verzeihlich, daß er
sich lediglich gegen die Fäulniß des
öden Gefellschaftslebens wendet.
Aber uns Deutschen rauschen noch
die heimischen Wälder, winken
noch die heimischen Berge, blinken
noch die heimischen wiesen und
Felder geheimnißvoll und lauschig
zu und flößen unsrer Seele tiefe
Schauer uralter Sagen, Märchen
und Künste ein. Uns sprudelt doch
noch trotz aller modernen Gleich-
macherei das quellende Leben des
Volksliedes, des schnurrenden Spinn-
rades, der klopfenden Hausgeister aus allen Ecken und Enden
hervor: für uns gilt es also weniger, gegen Gesellschaftssünden
der Städte, als für Gesundheit des Landes zu kämpfen!
Einen Theil dieses Kampfes — für uns Künstler den
Hauxttheil! — bildet die Aufgabe, der Untergrundkunst des
Volkes zum neuen Emxorwachsen und Aufblühen zu verhelfen.
Sie hat Robert Mielke mit Geschick angeregt und mit Glück
entwickelt. Im Vorworte schreibt er: „Vielleicht können die
. . . Ausführungen .... auf einem kleineren Gebiete dafür
wirken, daß die Sprache, in der das deutsche Volk sich seit fast
zwei Jahrtausenden künstlerisch zu verständigen wußte, nicht
vergessen werde. Und sollten sie untergehen in dem Meer zeit-
genössischer Erscheinungen, so soll das den Verfasser nicht ent-
muthigen, weiterhin für das zu leben, was er als seine Lebens-
aufgabe erkannt hat, für die die arbeitsfreudigsten Jahrzehnte
voraussichtlich noch vor ihm liegen."
Möge er bei diesem Kampfe von allen Seiten Unter-
stützung finden und dadurch veranlaßt werden, viele Gedanken,
die er jetzt erst nur mit einem Strich angedeutet und flüchtig
hingeworfen hat, in's Einzelne durchzuführen und überzeugend
auszugestalten. Es ist sicherlich das Feld, auf dem das Be-
ackern nicht vergeblich ist und dessen Schooß den goldenen
Reichthnni der Zukunft unserer Kunst birgt.
F. W. Rauschender g.
Unsere kunstgewerblichen (DusterblMer.
Taf. 5. Bb erlicht gitter aus der Klosterkirche zu
Gttobeuren. (Aus G. Aufleger, Die Klosterkirche zu Gttobeuren;
Verlag von L. Werner, München. — Mit Erlaubniß des Verlegers
abgedruckt.) vergl. hierüber die Besprechung des Werkes im Jahr-
gang 1892 S. 37.
Taf. s. Geschmiedete Wandleuchter. Im Kunstgewerbe-
museum zu Köln; gezeichnet von Fr. Stangen, Köln.
Taf. 7. Zimmerdecke aus dem Kloster St. Georgen
zu Stein a. Rh. Aus dem Beginn des is. Jahrhunderts. Auf-
nahme und Zeichnung von Architekt Btto Haßlinger, Karlsruhe.
Vergleiche hierüber Heft 1 S.
Taf. 8. Gitterthor. Von Johann Frohnsbeck, Herzog!,
bayerischer Hofschlosser, München. Nach Photographie gezeichnet von
E. F. Weysser, München.
hierzu „kunstgewerbliche Rundschau" Ar. 2.
verantw. Red.: Prof. L. Gmelin. — Herausgegeben vom Bayer. Lunstgerverbe-Verein. — Druck und Verlag von R. Gldenbourg, München.