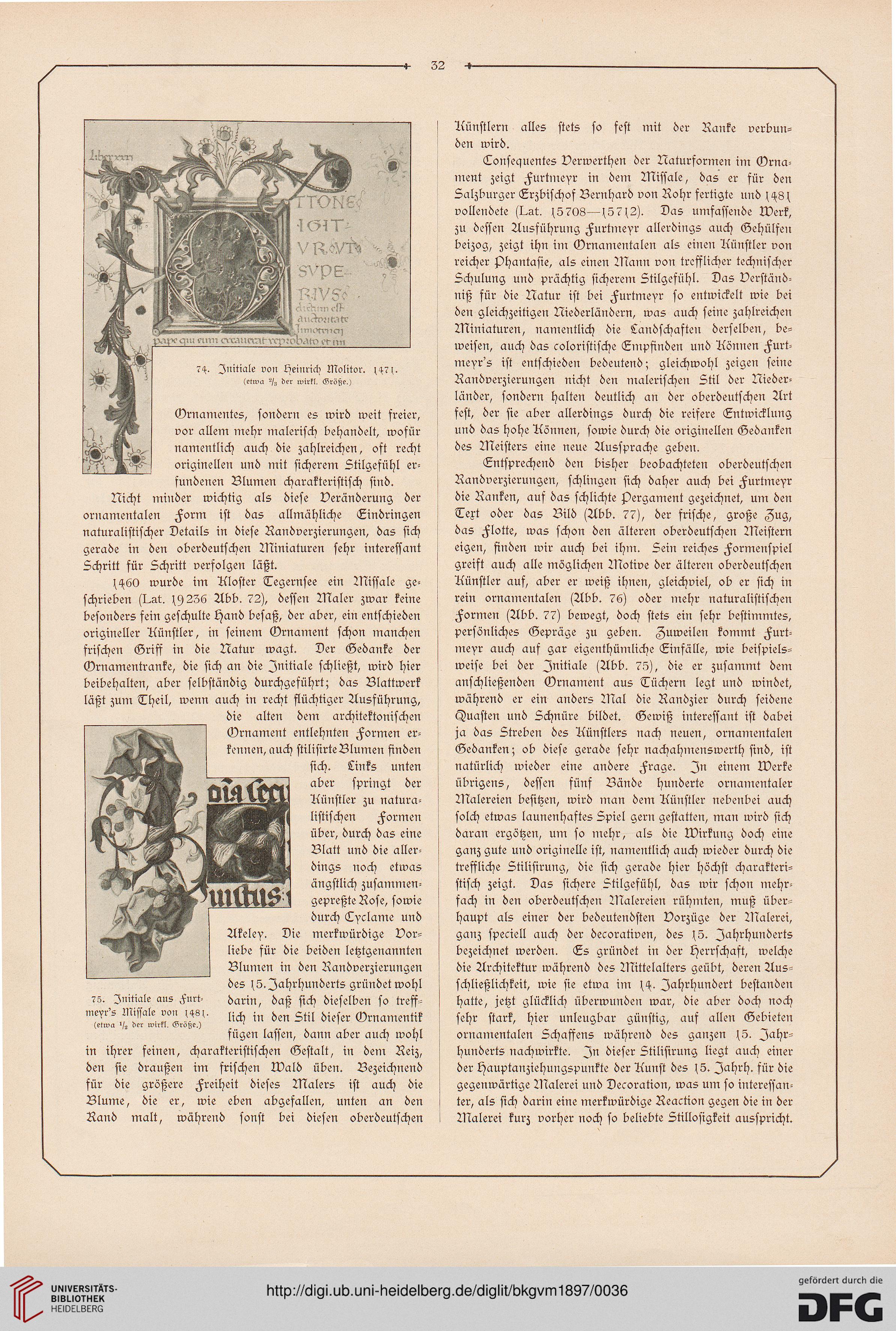TON£<
•iom
VR ovh
SVpE .
RIV5o '
dichnn
auSwitatc
jlirnonmcrj
gm; nv.mrtnr ny.-ol-um >tnn
74. Initiale von Heinrich Molitor. (47;.
(etwa 2/g der wirkt. Größe.)
Ornamentes, sondern es wird weit freier,
vor allem inehr malerisch behandelt, wofür
namentlich auch die zahlreichen, oft recht
originellen und mit sicherem Stilgefühl er-
fundenen Blumen charakteristisch sind.
Nicht minder wichtig als diese Veränderung der
ornamentalen Form ist das allmähliche Eindringen
naturalistischer Details in diese Randverzierungen, das sich
gerade in den oberdeutschen Miniaturen sehr interessant
Schritt für Schritt verfolgen läßt.
s-s60 wurde im Rloster Tegernsee ein Miffale ge-
schrieben (Lat. \()256 Abb. 72), dessen Maler zwar keine
besonders fein geschulte Hand besaß, der aber, ein entschieden
origineller Rünstler, in seinem Ornament schon manchen
frischen Griff in die Natur wagt. Der Gedanke der
Grnamentranke, die sich an die Initiale schließt, wird hier
beibehalten, aber selbständig durchgeführt; das Blattwerk
läßt zum Theil, wenn auch in recht flüchtiger Ausführung,
die alten dem architektonischen
Ornament entlehnten Formen er-
kennen, auch stilisirteBlumen finden
sich. Links unten
aber springt der
Rünstler zu natura-
listischen Formen
über, durch das eine
Blatt und die aller-
dings noch etwas
ängstlich zusammen-
gepreßte Rose, sowie
durch Tyclame und
Akeley. Die merkwürdige Vor-
liebe für die beiden letztgenannten
Blumen in den Randverzierungen
des (5.Jahrhunderts gründet wohl
7s. Initiale aus Furt- darin, daß sich dieselben so treff-
meyr's Miffale von (W- H{^ in Stu dieser Ornamentik
(etwa Va der wirk!. Große.) 1 1
fügen lassen, dann aber auch wohl
in ihrer feinen, charakteristischen Gestalt, in den: Reiz,
den sie draußen im frischen A)ald üben. Bezeichnend
für die größere Freiheit dieses Malers ist auch die
Blume, die er, wie eben abgefallen, unten an den
Rand malt, während sonst bei diesen oberdeutschen
Rünstlern alles stets so fest mit der Ranke verbun-
den wird.
Tonsequentes Verwerthen der Naturformen im Grna-
ntent zeigt Furtmeyr in dem Miffale, das er für den
Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr fertigte und l^8s
vollendete (Lat. ^5708—\57{2). Das umfassende Werk,
zu dessen Ausführung Furtmeyr allerdings auch Gehülfen
beizog, zeigt ihn im Ornamentalen als einen Aünstler von
reicher Phantasie, als einen Mann von trefflicher technischer
Schulung und prächtig sicherem Stilgefühl. Das Verständ-
niß für die Natur ist bei Furtmeyr so entwickelt wie bei
den gleichzeitigen Niederländern, was auch seine zahlreichen
Miniaturen, namentlich die Landschaften derselben, be-
weisen, auch das coloristifchs Empfinden und Rönnen Furt-
meyr's ist entschieden bedeutend; gleichwohl zeigen seine
Randverzierungen nicht den malerischen Stil der Nieder-
länder, sondern halten deutlich an der oberdeutschen Art
fest, der sie aber allerdings durch die reifere Entwicklung
und das hohe Rönnen, sowie durch die originellen Gedanken
des Meisters eine neue Aussprache geben.
Entsprechend den bisher beobachteten oberdeutschen
Randverzierungen, schlingen sich daher auch bei Furtmeyr
die Ranken, aus das schlichte Pergament gezeichnet, um den
Text oder das Bild (Abb. 77), der frische, große Zug,
das Flotte, was schon den älteren oberdeutschen Meistern
eigen, finden wir auch bei ihm. Sein reiches Formenspiel
greift auch alle möglichen Motive der älteren oberdeutschen
Rünstler auf, aber er weiß ihnen, gleichviel, ob er sich in
rein ornamentalen (Abb. 76) oder inehr naturalistischen
Formen (Abb. 77) bewegt, doch stets ein sehr bestimmtes,
persönliches Gepräge zu geben. Zuweilen kommt Furt-
meyr auch auf gar eigenthümliche Einfälle, wie beispiels-
weise bei der Initiale (Abb. 75), die er zusammt dem
anschließenden Ornament aus Tüchern legt und windet,
während er ein anders Mal die Randzier durch seidene
Quasten und Schnüre bildet. Gewiß interessant ist dabei
ja das Streben des Rünstlers nach neuen, ornamentalen
Gedanken ; ob diese gerade sehr nachahmenswerth sind, ist
natürlich wieder eine andere Frage. In einem Werke
übrigens, dessen fünf Bände Hunderte ornamentaler
Malereien besitzen, wird man dem Rünstler nebenbei auch
solch etwas launenhaftes Spiel gern gestatten, man wird sich
daran ergötzen, um so inehr, als die Wirkung doch eine
ganz gute und originelle ist, namentlich auch wieder durch die
treffliche Stilisirung, die sich gerade hier höchst charakteri-
stisch zeigt. Das sichere Stilgefühl, das wir schon mehr-
fach in den oberdeutschen Malereien rühmten, muß über-
haupt als einer der bedeutendsten Vorzüge der Malerei,
ganz speciell auch der decorativen, des (5. Jahrhunderts
bezeichnet werden. Es gründet in der Herrschaft, welche
die Architektur während des Mittelalters geübt, deren Aus-
fchließlichkeit, wie sie etwa im fp Jahrhundert bestanden
hatte, jetzt glücklich überwunden war, die aber doch noch
sehr stark, hier unleugbar günstig, aus allen Gebieten
ornamentalen Schaffens während des ganzen f5. Jahr-
hunderts nachwirkte. In dieser Stilisirung liegt auch einer
der Hauptanziehungspunkte der Runst des ;5. Iahrh. für die
gegenwärtige Malerei und Decoration, was um so interessan-
ter, als sich darin eine merkwürdige Reaction gegen die in der
Malerei kurz vorher noch so beliebte Stillosigkeit ausspricht.
•iom
VR ovh
SVpE .
RIV5o '
dichnn
auSwitatc
jlirnonmcrj
gm; nv.mrtnr ny.-ol-um >tnn
74. Initiale von Heinrich Molitor. (47;.
(etwa 2/g der wirkt. Größe.)
Ornamentes, sondern es wird weit freier,
vor allem inehr malerisch behandelt, wofür
namentlich auch die zahlreichen, oft recht
originellen und mit sicherem Stilgefühl er-
fundenen Blumen charakteristisch sind.
Nicht minder wichtig als diese Veränderung der
ornamentalen Form ist das allmähliche Eindringen
naturalistischer Details in diese Randverzierungen, das sich
gerade in den oberdeutschen Miniaturen sehr interessant
Schritt für Schritt verfolgen läßt.
s-s60 wurde im Rloster Tegernsee ein Miffale ge-
schrieben (Lat. \()256 Abb. 72), dessen Maler zwar keine
besonders fein geschulte Hand besaß, der aber, ein entschieden
origineller Rünstler, in seinem Ornament schon manchen
frischen Griff in die Natur wagt. Der Gedanke der
Grnamentranke, die sich an die Initiale schließt, wird hier
beibehalten, aber selbständig durchgeführt; das Blattwerk
läßt zum Theil, wenn auch in recht flüchtiger Ausführung,
die alten dem architektonischen
Ornament entlehnten Formen er-
kennen, auch stilisirteBlumen finden
sich. Links unten
aber springt der
Rünstler zu natura-
listischen Formen
über, durch das eine
Blatt und die aller-
dings noch etwas
ängstlich zusammen-
gepreßte Rose, sowie
durch Tyclame und
Akeley. Die merkwürdige Vor-
liebe für die beiden letztgenannten
Blumen in den Randverzierungen
des (5.Jahrhunderts gründet wohl
7s. Initiale aus Furt- darin, daß sich dieselben so treff-
meyr's Miffale von (W- H{^ in Stu dieser Ornamentik
(etwa Va der wirk!. Große.) 1 1
fügen lassen, dann aber auch wohl
in ihrer feinen, charakteristischen Gestalt, in den: Reiz,
den sie draußen im frischen A)ald üben. Bezeichnend
für die größere Freiheit dieses Malers ist auch die
Blume, die er, wie eben abgefallen, unten an den
Rand malt, während sonst bei diesen oberdeutschen
Rünstlern alles stets so fest mit der Ranke verbun-
den wird.
Tonsequentes Verwerthen der Naturformen im Grna-
ntent zeigt Furtmeyr in dem Miffale, das er für den
Salzburger Erzbischof Bernhard von Rohr fertigte und l^8s
vollendete (Lat. ^5708—\57{2). Das umfassende Werk,
zu dessen Ausführung Furtmeyr allerdings auch Gehülfen
beizog, zeigt ihn im Ornamentalen als einen Aünstler von
reicher Phantasie, als einen Mann von trefflicher technischer
Schulung und prächtig sicherem Stilgefühl. Das Verständ-
niß für die Natur ist bei Furtmeyr so entwickelt wie bei
den gleichzeitigen Niederländern, was auch seine zahlreichen
Miniaturen, namentlich die Landschaften derselben, be-
weisen, auch das coloristifchs Empfinden und Rönnen Furt-
meyr's ist entschieden bedeutend; gleichwohl zeigen seine
Randverzierungen nicht den malerischen Stil der Nieder-
länder, sondern halten deutlich an der oberdeutschen Art
fest, der sie aber allerdings durch die reifere Entwicklung
und das hohe Rönnen, sowie durch die originellen Gedanken
des Meisters eine neue Aussprache geben.
Entsprechend den bisher beobachteten oberdeutschen
Randverzierungen, schlingen sich daher auch bei Furtmeyr
die Ranken, aus das schlichte Pergament gezeichnet, um den
Text oder das Bild (Abb. 77), der frische, große Zug,
das Flotte, was schon den älteren oberdeutschen Meistern
eigen, finden wir auch bei ihm. Sein reiches Formenspiel
greift auch alle möglichen Motive der älteren oberdeutschen
Rünstler auf, aber er weiß ihnen, gleichviel, ob er sich in
rein ornamentalen (Abb. 76) oder inehr naturalistischen
Formen (Abb. 77) bewegt, doch stets ein sehr bestimmtes,
persönliches Gepräge zu geben. Zuweilen kommt Furt-
meyr auch auf gar eigenthümliche Einfälle, wie beispiels-
weise bei der Initiale (Abb. 75), die er zusammt dem
anschließenden Ornament aus Tüchern legt und windet,
während er ein anders Mal die Randzier durch seidene
Quasten und Schnüre bildet. Gewiß interessant ist dabei
ja das Streben des Rünstlers nach neuen, ornamentalen
Gedanken ; ob diese gerade sehr nachahmenswerth sind, ist
natürlich wieder eine andere Frage. In einem Werke
übrigens, dessen fünf Bände Hunderte ornamentaler
Malereien besitzen, wird man dem Rünstler nebenbei auch
solch etwas launenhaftes Spiel gern gestatten, man wird sich
daran ergötzen, um so inehr, als die Wirkung doch eine
ganz gute und originelle ist, namentlich auch wieder durch die
treffliche Stilisirung, die sich gerade hier höchst charakteri-
stisch zeigt. Das sichere Stilgefühl, das wir schon mehr-
fach in den oberdeutschen Malereien rühmten, muß über-
haupt als einer der bedeutendsten Vorzüge der Malerei,
ganz speciell auch der decorativen, des (5. Jahrhunderts
bezeichnet werden. Es gründet in der Herrschaft, welche
die Architektur während des Mittelalters geübt, deren Aus-
fchließlichkeit, wie sie etwa im fp Jahrhundert bestanden
hatte, jetzt glücklich überwunden war, die aber doch noch
sehr stark, hier unleugbar günstig, aus allen Gebieten
ornamentalen Schaffens während des ganzen f5. Jahr-
hunderts nachwirkte. In dieser Stilisirung liegt auch einer
der Hauptanziehungspunkte der Runst des ;5. Iahrh. für die
gegenwärtige Malerei und Decoration, was um so interessan-
ter, als sich darin eine merkwürdige Reaction gegen die in der
Malerei kurz vorher noch so beliebte Stillosigkeit ausspricht.