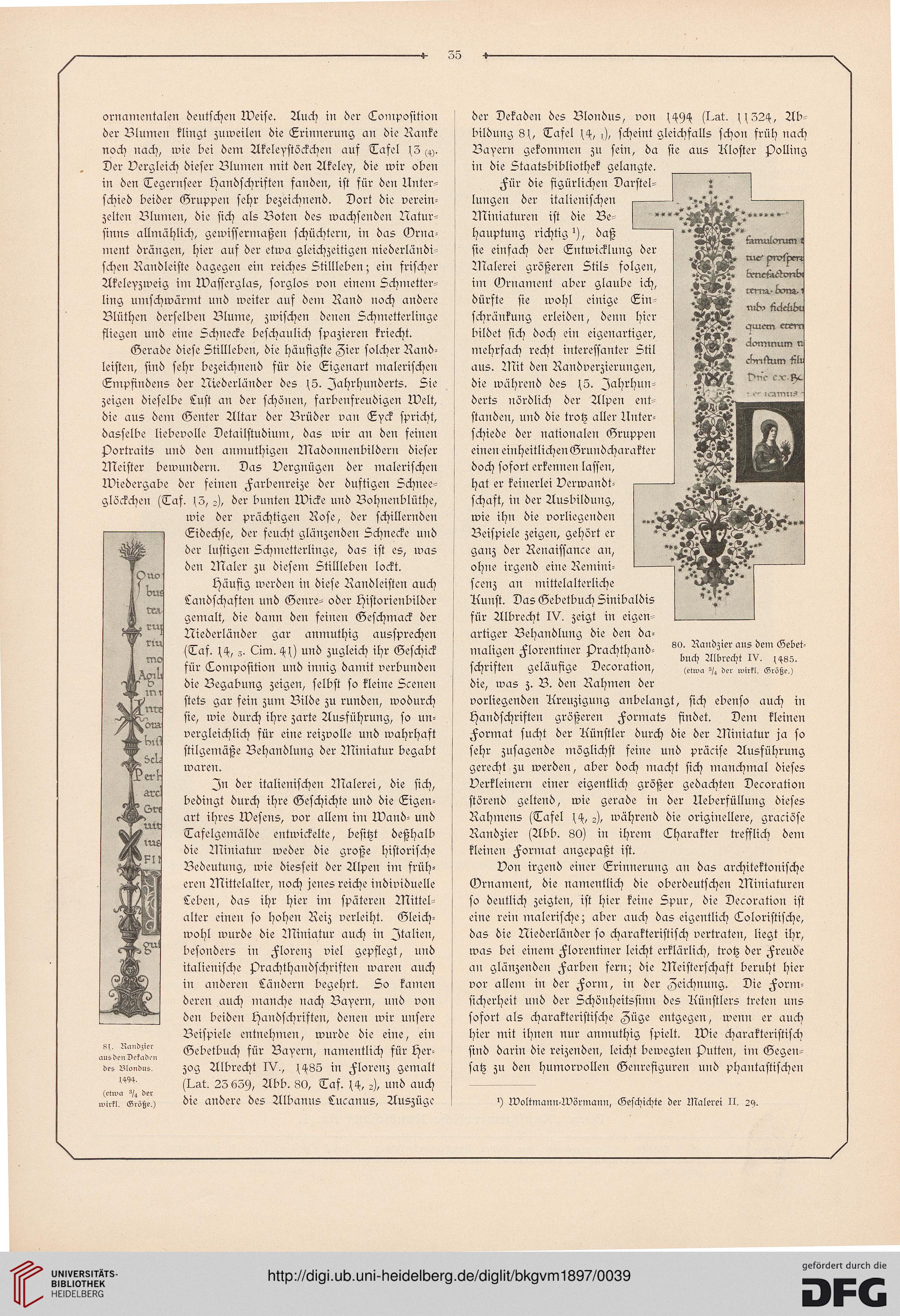55
ornamentalen deutschen Weise. Auch in der Komposition
der Blumen klingt zuweilen die Erinnerung an die Ranke
noch nach, wie bei dem Akeleystöckchen auf Tafel 1^5 (<y.
Der Vergleich dieser Blumen mit den Akeley, die wir oben
in den Tegernseer Handschriften fanden, ist für den Unter-
schied beider Gruppen sehr bezeichnend. Dort die verein-
zelten Blumen, die sich als Boten des wachsenden Natur-
sinns allmählich, gewissermaßen schüchtern, in das Orna-
ment drängen, hier auf der etwa gleichzeitigen niederländi
schen Randleiste dagegen ein reiches Stillleben; ein frischer
Akeleyzweig im Wasserglas, sorglos von einem Schmetter-
ling umschwärmt und weiter auf dem Rand noch andere
Blüthen derselben Blume, zwischen denen Schmetterlinge
fliegen und eine Schnecke beschaulich spazieren kriecht.
Gerade diese Stillleben, die häufigste Zier solcher Rand-
leisteu, sind sehr bezeichnend für die Eigenart malerischen
Empfindens der Niederländer des 15. Jahrhunderts. Sie
zeigen dieselbe Lust an der schönen, farbenfreudigen Welt,
die aus dem Genter Altar der Brüder van Eyck spricht,
dasselbe liebevolle Detailstudium, das wir an den feinen
portraits und den anmuthigen Madonnenbildern dieser
Meister bewundern. Das Vergnügen der malerischen
Wiedergabe der seinen Farbenreize der duftigen Schnee-
glöckchen (Taf. 15, 2), der bunten Wicke und Bohnenblüthe,
wie der prächtigen Rose, der schillernden
Eidechse, der feucht glänzenden Schnecke und
der lustigen Schmetterlinge, das ist es, was
den Maler zu diesem Stillleben lockt.
chäufig werden in diese Randleisten auch
Landschaften und Genre- oder Historienbilder
gemalt, die dann den feinen Geschmack der
Niederländer gar anmuthig aussprechen
(Taf. 1-1, 3. Cim. -11) und zugleich ihr Geschick
für Eomposition und innig damit verbunden
die Begabung zeigen, selbst so kleine Scenen
stets gar fein zum Bilde zu runden, wodurch
sie, wie durch ihre zarte Ausführung, so un-
vergleichlich für eine reizvolle und wahrhaft
stilgemäße Behandlung der Miniatur begabt
waren.
In der italienischen Malerei, die sich,
bedingt durch ihre Geschichte und die Eigen-
art ihres Wesens, vor allem im Wand- und
Tafelgemälde entwickelte, besitzt deßhalb
die Miniatur weder die große historische
Bedeutung, wie diesseit der Alpen im früh-
eren Mittelalter, noch jenes reiche individuelle
Leben, das ihr hier im späteren Mittel-
alter einen so hohen Reiz verleiht. Gleich-
wohl wurde die Miniatur auch in Italien,
besonders in Florenz viel gepflegt, und
italienische Prachthandschriften waren auch
in anderen Ländern begehrt. So kamen
deren auch manche nach Bayern, und von
den beiden Handschriften, denen wir unsere
Beispiele entnehmen, wurde die eine, ein
auibenBeff&nt Gebetbuch für Bayern, namentlich für cher-
bes sionbus. zog Albrecht IV., 1-185 in Florenz gemalt
(Val. 25 659, Abb. 80, Taf. Ich 2), und auch
roufi. ®ri>6e.) die andere des Albanus Lucanus, Auszüge
der Dekaden des Blondus, von H91 (Val. 11521, Ab-
bildung 81, Tafel 11, n), scheint gleichfalls schon früh nach
Bayern gekommen zu sein, da sie aus Kloster Polling
in die Staatsbibliothek gelangte.
Für die figürlichen Darstel-
lungen der italienischen
Miniaturen ist die Be-
tkrmiforwn 1
tue" prcrfpm
trocfai-lwbi
tma>Wi
ntK' fkfdibu
quiem ecerv
dotmnum r.
cfmftum tili
t>nV e.xr.fV.
hauptung richtig '), daß
sie einfach der Entwicklung der
Malerei größeren Stils folgen,
im Ornament aber glaube ich,
dürfte sie wohl einige Ein-
schränkung erleiden, denn hier
bildet sich doch ein eigenartiger,
mehrfach recht interessanter Stil
aus. Mit den Randverzierungen,
die während des 15. Jahrhun-
derts nördlich der Alpen ent-
standen, und die trotz aller Unter-
schiede der nationalen Gruppen
einen einheitlichen Grundcharakter
doch sofort erkennen lassen,
hat er keinerlei Verwandt-
schaft, in der Ausbildung,
wie ihn die vorliegenden
Beispiele zeigen, gehört er-
gänz der Renaissance an,
ohne irgend eine Remini-
scenz an mittelalterliche
Kunst. Das Gebetbuch Siuibaldis
für Albrecht IV. zeigt in eigen-
artiger Behandlung die den da-
maligen Florentiner Prachthand-
schriften geläufige Decoration,
die, was z. B. den Rahmen der
vorliegenden Kreuzigung anbelangt, sich ebenso auch in
Handschriften größeren Formats findet. Dem kleinen
Format sucht der Künstler durch die der Miniatur ja so
sehr zusagende möglichst feine und präcise Ausführung
gerecht zu werden, aber doch macht sich manchmal dieses
Verkleinern einer eigentlich größer gedachten Decoration
störend geltend, wie gerade in der Ueberfüllung dieses
Rahmens (Tafel H, 2), während die originellere, graciöfe
Randzier (Abb. 80) in ihrem Tharakter trefflich dem
kleinen Format angepaßt ist.
Von irgend einer Erinnerung an das architektonische
Ornament, die namentlich die oberdeutschen Miniaturen
so deutlich zeigten, ist hier keine Spur, die Decoration ist
eine rein malerische; aber auch das eigentlich Toloristische,
das die Niederländer so charakteristisch vertraten, liegt ihr,
was bei einem Florentiner leicht erklärlich, trotz der Freude
an glänzenden Farben fern; die Meisterschaft beruht hier
vor allem iu der Form, in der Zeichnung. Die Form-
sicherheit und der Schönheitssinn des Künstlers treten uns
sofort als charakteristische Züge entgegen, wenn er auch
hier mit ihnen nur anmuthig spielt. Wie charakteristisch
sind darin die reizenden, leicht bewegten Putten, im Gegen-
satz zu den humorvolleu Genrefiguren und phantastischen
80. Randzier aus dem Gebet-
buch Albrecht IV. ;^85.
(etwa 3/4 der wirk!. Größe.)
') Woltmann-Wörmann, Geschichte der Malerei II. 29.
\
ornamentalen deutschen Weise. Auch in der Komposition
der Blumen klingt zuweilen die Erinnerung an die Ranke
noch nach, wie bei dem Akeleystöckchen auf Tafel 1^5 (<y.
Der Vergleich dieser Blumen mit den Akeley, die wir oben
in den Tegernseer Handschriften fanden, ist für den Unter-
schied beider Gruppen sehr bezeichnend. Dort die verein-
zelten Blumen, die sich als Boten des wachsenden Natur-
sinns allmählich, gewissermaßen schüchtern, in das Orna-
ment drängen, hier auf der etwa gleichzeitigen niederländi
schen Randleiste dagegen ein reiches Stillleben; ein frischer
Akeleyzweig im Wasserglas, sorglos von einem Schmetter-
ling umschwärmt und weiter auf dem Rand noch andere
Blüthen derselben Blume, zwischen denen Schmetterlinge
fliegen und eine Schnecke beschaulich spazieren kriecht.
Gerade diese Stillleben, die häufigste Zier solcher Rand-
leisteu, sind sehr bezeichnend für die Eigenart malerischen
Empfindens der Niederländer des 15. Jahrhunderts. Sie
zeigen dieselbe Lust an der schönen, farbenfreudigen Welt,
die aus dem Genter Altar der Brüder van Eyck spricht,
dasselbe liebevolle Detailstudium, das wir an den feinen
portraits und den anmuthigen Madonnenbildern dieser
Meister bewundern. Das Vergnügen der malerischen
Wiedergabe der seinen Farbenreize der duftigen Schnee-
glöckchen (Taf. 15, 2), der bunten Wicke und Bohnenblüthe,
wie der prächtigen Rose, der schillernden
Eidechse, der feucht glänzenden Schnecke und
der lustigen Schmetterlinge, das ist es, was
den Maler zu diesem Stillleben lockt.
chäufig werden in diese Randleisten auch
Landschaften und Genre- oder Historienbilder
gemalt, die dann den feinen Geschmack der
Niederländer gar anmuthig aussprechen
(Taf. 1-1, 3. Cim. -11) und zugleich ihr Geschick
für Eomposition und innig damit verbunden
die Begabung zeigen, selbst so kleine Scenen
stets gar fein zum Bilde zu runden, wodurch
sie, wie durch ihre zarte Ausführung, so un-
vergleichlich für eine reizvolle und wahrhaft
stilgemäße Behandlung der Miniatur begabt
waren.
In der italienischen Malerei, die sich,
bedingt durch ihre Geschichte und die Eigen-
art ihres Wesens, vor allem im Wand- und
Tafelgemälde entwickelte, besitzt deßhalb
die Miniatur weder die große historische
Bedeutung, wie diesseit der Alpen im früh-
eren Mittelalter, noch jenes reiche individuelle
Leben, das ihr hier im späteren Mittel-
alter einen so hohen Reiz verleiht. Gleich-
wohl wurde die Miniatur auch in Italien,
besonders in Florenz viel gepflegt, und
italienische Prachthandschriften waren auch
in anderen Ländern begehrt. So kamen
deren auch manche nach Bayern, und von
den beiden Handschriften, denen wir unsere
Beispiele entnehmen, wurde die eine, ein
auibenBeff&nt Gebetbuch für Bayern, namentlich für cher-
bes sionbus. zog Albrecht IV., 1-185 in Florenz gemalt
(Val. 25 659, Abb. 80, Taf. Ich 2), und auch
roufi. ®ri>6e.) die andere des Albanus Lucanus, Auszüge
der Dekaden des Blondus, von H91 (Val. 11521, Ab-
bildung 81, Tafel 11, n), scheint gleichfalls schon früh nach
Bayern gekommen zu sein, da sie aus Kloster Polling
in die Staatsbibliothek gelangte.
Für die figürlichen Darstel-
lungen der italienischen
Miniaturen ist die Be-
tkrmiforwn 1
tue" prcrfpm
trocfai-lwbi
tma>Wi
ntK' fkfdibu
quiem ecerv
dotmnum r.
cfmftum tili
t>nV e.xr.fV.
hauptung richtig '), daß
sie einfach der Entwicklung der
Malerei größeren Stils folgen,
im Ornament aber glaube ich,
dürfte sie wohl einige Ein-
schränkung erleiden, denn hier
bildet sich doch ein eigenartiger,
mehrfach recht interessanter Stil
aus. Mit den Randverzierungen,
die während des 15. Jahrhun-
derts nördlich der Alpen ent-
standen, und die trotz aller Unter-
schiede der nationalen Gruppen
einen einheitlichen Grundcharakter
doch sofort erkennen lassen,
hat er keinerlei Verwandt-
schaft, in der Ausbildung,
wie ihn die vorliegenden
Beispiele zeigen, gehört er-
gänz der Renaissance an,
ohne irgend eine Remini-
scenz an mittelalterliche
Kunst. Das Gebetbuch Siuibaldis
für Albrecht IV. zeigt in eigen-
artiger Behandlung die den da-
maligen Florentiner Prachthand-
schriften geläufige Decoration,
die, was z. B. den Rahmen der
vorliegenden Kreuzigung anbelangt, sich ebenso auch in
Handschriften größeren Formats findet. Dem kleinen
Format sucht der Künstler durch die der Miniatur ja so
sehr zusagende möglichst feine und präcise Ausführung
gerecht zu werden, aber doch macht sich manchmal dieses
Verkleinern einer eigentlich größer gedachten Decoration
störend geltend, wie gerade in der Ueberfüllung dieses
Rahmens (Tafel H, 2), während die originellere, graciöfe
Randzier (Abb. 80) in ihrem Tharakter trefflich dem
kleinen Format angepaßt ist.
Von irgend einer Erinnerung an das architektonische
Ornament, die namentlich die oberdeutschen Miniaturen
so deutlich zeigten, ist hier keine Spur, die Decoration ist
eine rein malerische; aber auch das eigentlich Toloristische,
das die Niederländer so charakteristisch vertraten, liegt ihr,
was bei einem Florentiner leicht erklärlich, trotz der Freude
an glänzenden Farben fern; die Meisterschaft beruht hier
vor allem iu der Form, in der Zeichnung. Die Form-
sicherheit und der Schönheitssinn des Künstlers treten uns
sofort als charakteristische Züge entgegen, wenn er auch
hier mit ihnen nur anmuthig spielt. Wie charakteristisch
sind darin die reizenden, leicht bewegten Putten, im Gegen-
satz zu den humorvolleu Genrefiguren und phantastischen
80. Randzier aus dem Gebet-
buch Albrecht IV. ;^85.
(etwa 3/4 der wirk!. Größe.)
') Woltmann-Wörmann, Geschichte der Malerei II. 29.
\