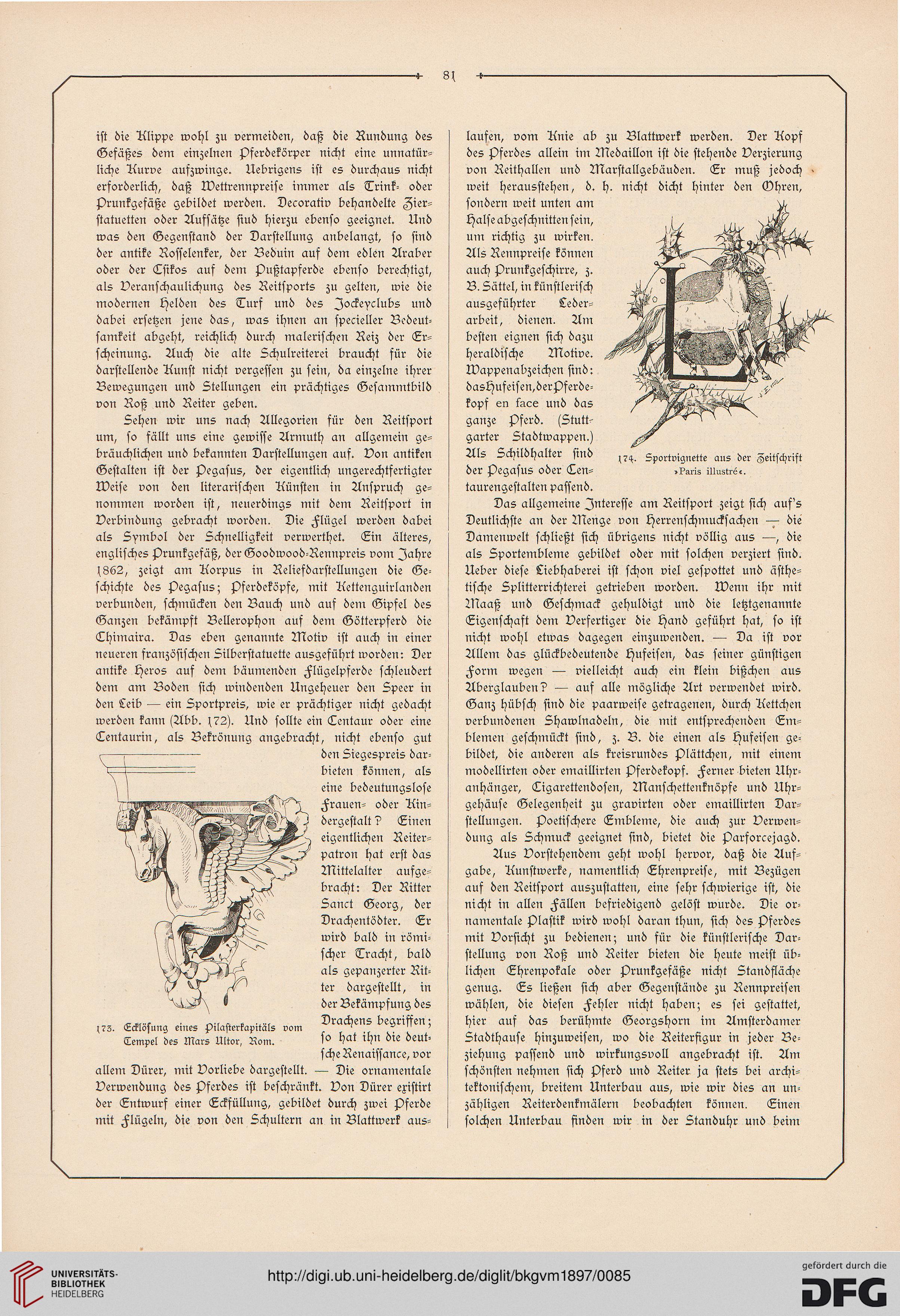ist die Klippe wohl zu vermeiden, daß die Rundung des
Gefäßes dem einzelnen Pferdekörper nicht eine unnatür-
liche Kurve aufzwinge. Uebrigens ist es durchaus nicht
erforderlich, daß Wettrennpreise immer als Trink- oder
Prunkgefäße gebildet werden. Decorativ behandelte Zier-
statuetten oder Aufsätze siud hierzu ebenso geeignet. And
was den Gegenstand der Darstellung anbelangt, so sind
der antike Rosfelenker, der Beduin auf dem edlen Araber
oder der Tsikos auf dem Pußtapferde ebenso berechtigt,
als Veranschaulichung des Reitsports zu gelten, wie die
modernen Pelden des Turf und des Iockeyclubs und
dabei ersetzen jene das, was ihnen an fpecieller Bedeut-
samkeit abgeht, reichlich durch malerischen Reiz der Er-
scheinung. Auch die alte Schulreiterei braucht für die
darstellende Kunst nicht vergessen zu sein, da einzelne ihrer
Bewegungen und Stellungen ein prächtiges Gesammtbild
von Roß und Reiter geben.
Lehen wir uns nach Allegorien für den Reitsport
um, so fällt uns eine gewisse Arinuth an allgemein ge-
bräuchlichen und bekannten Darstellungen aus. Von antiken
Gestalten ist der Pegasus, der eigentlich ungerechtfertigter
Weise von den literarischen Künsten in Anspruch ge-
nommen worden ist, neuerdings mit dem Reitsport in
Verbindung gebracht worden. Die Flügel werden dabei
als Symbol der Schnelligkeit verwerthet. Ein älteres,
englisches Prunkgefäß, der Goodwood-Rennpreis vom Jahre
\862, zeigt am Korpus in Reliefdarstellungen die Ge-
schichte des Pegasus; Pferdeköpfe, mit Kettenguirlanden
verbunden, schmücken den Bauch und auf dem Gipfel des
Ganzen bekämpft Bellerophon auf dem Götterpferd die
Ehimaira. Das eben genannte Motiv ist auch in einer
neueren französischen Silberstatuette ausgeführt worden: Der
antike peros auf dem bäumenden Flügelpferde schleudert
dem am Boden sich windenden Ungeheuer den Speer in
den Leib — ein Sportpreis, wie er prächtiger nicht gedacht
werden kann (Abb. \72). Und sollte ein Eentaur oder eine
Eentaurin, als Bekrönung angebracht, nicht ebenso gut
den Siegespreis dar-
bieten können, als
eine bedeutungslose
Frauen- oder Kin-
dergestalt ? Einen
eigentlichen Reiter-
patron hat erst das
Mittelalter aufge-
bracht: Der Ritter
Sauet Georg, der
Drachentödter. Er
wird bald in römi-
scher Tracht, bald
als gepanzerter Rit-
ter dargestellt, in
der Bekämpfung des
;?z. Lcklösung eines jdilasterkaxitäls vom Drachens begriffen;
Tempel des Mars Ultor, Rom. ^ie deut-
sche Renaissance, vor
allem Dürer, mit Vorliebe dargestellt. — Die ornamentale
Verwendung des Pferdes ist beschränkt. Von Dürer existirt
der Entwurf einer Eckfüllung, gebildet durch zwei Pferde
mit Flügeln, die von den Schultern an in Blattwerk aus-
laufen, vom Knie ab zu Blattwerk werden. Der Kopf
des Pferdes allein im Medaillon ist die stehende Verzierung
von Reithallen und Marstallgebäuden. Er muß jedoch
weit herausstehen, d. h. nicht dicht hinter den Ohren,
sondern weit unten am
Palse abgeschnitten sein,
um richtig zu wirken.
Als Rennpreise können
auch Prunkgeschirre, z.
B. Sättel, in künstlerisch
ausgeführter Leder-
arbeit, dienen. Am
besten eignen sich dazu
heraldische Motive.
Mappenabzeichen sind:
daspufeisen,derpserde-
kopf en kace und das
ganze Pferd. (Stutt-
garter Stadtwappen.)
Als Schildhalter sind
der Pegasus oder Len-
taurengestalten paffend.
Das allgemeine Interesse am Reitsport zeigt sich auf's
Deutlichste an der Menge von Perrenschmucksachen — die
Damenwelt schließt sich übrigens nicht völlig aus ■—, die
als Sportembleme gebildet oder mit solchen verziert sind.
Ueber diese Liebhaberei ist schon viel gespottet und ästhe-
tische Splitterrichterei getrieben worden. Wenn ihr mit
Maaß und Geschmack gehuldigt und die letztgenannte
Eigenschaft dem Verfertiger die Pand geführt hat, so ist
nicht wohl etwas dagegen einzuwenden. ■— Da ist vor
Allem das glückbedeutende Pufeisen, das seiner günstigen
Form wegen — vielleicht auch ein klein bißchen aus
Aberglauben? — auf alle mögliche Art verwendet wird.
Ganz hübsch sind die paarweise getragenen, durch Kettchen
verbundenen Shawlnadeln, die mit entsprechenden Em-
blemen geschmückt sind, z. B. die einen als Pufeisen ge-
bildet, die anderen als kreisrundes Plättchen, mit einem
modellirten oder emaillirten Pferdekopf. Ferner bieten Uhr-
anhänger, Eigarettendosen, Manschettenknöpse und Uhr-
gehäuse Gelegenheit zu gravirten oder emaillirten Dar-
stellungen. Poetischere Embleme, die auch zur Verwen-
dung als Schmuck geeignet sind, bietet die Parforcejagd.
Aus Vorstehendem geht wohl hervor, daß die Auf-
gabe, Kunstwerke, namentlich Ehrenpreise, mit Bezügen
auf den Reitsport auszustatten, eine sehr schwierige ist, die
nicht in allen Fällen befriedigend gelöst wurde. Die or-
namentale Plastik wird wohl daran thun, sich des Pferdes
mit Vorsicht zu bedienen; und für die künstlerische Dar-
stellung von Roß und Reiter bieten die heute meist üb-
lichen Ehrenpokale oder Prunkgesäße nicht Standfläche
genug. Es ließen sich aber Gegenstände zu Rennpreisen
wählen, die diesen Fehler nicht haben; es sei gestattet,
hier auf das berühmte Georgshorn im Amsterdamer
Stadthause hinzuweisen, wo die Reiterfigur in jeder Be-
ziehung passend und wirkungsvoll angebracht ist. Am
schönsten nehmen sich Pferd und Reiter ja stets bei archi-
tektonischem, breitem Unterbau aus, wie wir dies an un-
zähligen Reiterdenkmälern beobachten können. Einen
solchen Unterbau finden wir in der Standuhr und beim
;7^. Sportvignette aus der Zeitschrift
»Paris illustre«.
Gefäßes dem einzelnen Pferdekörper nicht eine unnatür-
liche Kurve aufzwinge. Uebrigens ist es durchaus nicht
erforderlich, daß Wettrennpreise immer als Trink- oder
Prunkgefäße gebildet werden. Decorativ behandelte Zier-
statuetten oder Aufsätze siud hierzu ebenso geeignet. And
was den Gegenstand der Darstellung anbelangt, so sind
der antike Rosfelenker, der Beduin auf dem edlen Araber
oder der Tsikos auf dem Pußtapferde ebenso berechtigt,
als Veranschaulichung des Reitsports zu gelten, wie die
modernen Pelden des Turf und des Iockeyclubs und
dabei ersetzen jene das, was ihnen an fpecieller Bedeut-
samkeit abgeht, reichlich durch malerischen Reiz der Er-
scheinung. Auch die alte Schulreiterei braucht für die
darstellende Kunst nicht vergessen zu sein, da einzelne ihrer
Bewegungen und Stellungen ein prächtiges Gesammtbild
von Roß und Reiter geben.
Lehen wir uns nach Allegorien für den Reitsport
um, so fällt uns eine gewisse Arinuth an allgemein ge-
bräuchlichen und bekannten Darstellungen aus. Von antiken
Gestalten ist der Pegasus, der eigentlich ungerechtfertigter
Weise von den literarischen Künsten in Anspruch ge-
nommen worden ist, neuerdings mit dem Reitsport in
Verbindung gebracht worden. Die Flügel werden dabei
als Symbol der Schnelligkeit verwerthet. Ein älteres,
englisches Prunkgefäß, der Goodwood-Rennpreis vom Jahre
\862, zeigt am Korpus in Reliefdarstellungen die Ge-
schichte des Pegasus; Pferdeköpfe, mit Kettenguirlanden
verbunden, schmücken den Bauch und auf dem Gipfel des
Ganzen bekämpft Bellerophon auf dem Götterpferd die
Ehimaira. Das eben genannte Motiv ist auch in einer
neueren französischen Silberstatuette ausgeführt worden: Der
antike peros auf dem bäumenden Flügelpferde schleudert
dem am Boden sich windenden Ungeheuer den Speer in
den Leib — ein Sportpreis, wie er prächtiger nicht gedacht
werden kann (Abb. \72). Und sollte ein Eentaur oder eine
Eentaurin, als Bekrönung angebracht, nicht ebenso gut
den Siegespreis dar-
bieten können, als
eine bedeutungslose
Frauen- oder Kin-
dergestalt ? Einen
eigentlichen Reiter-
patron hat erst das
Mittelalter aufge-
bracht: Der Ritter
Sauet Georg, der
Drachentödter. Er
wird bald in römi-
scher Tracht, bald
als gepanzerter Rit-
ter dargestellt, in
der Bekämpfung des
;?z. Lcklösung eines jdilasterkaxitäls vom Drachens begriffen;
Tempel des Mars Ultor, Rom. ^ie deut-
sche Renaissance, vor
allem Dürer, mit Vorliebe dargestellt. — Die ornamentale
Verwendung des Pferdes ist beschränkt. Von Dürer existirt
der Entwurf einer Eckfüllung, gebildet durch zwei Pferde
mit Flügeln, die von den Schultern an in Blattwerk aus-
laufen, vom Knie ab zu Blattwerk werden. Der Kopf
des Pferdes allein im Medaillon ist die stehende Verzierung
von Reithallen und Marstallgebäuden. Er muß jedoch
weit herausstehen, d. h. nicht dicht hinter den Ohren,
sondern weit unten am
Palse abgeschnitten sein,
um richtig zu wirken.
Als Rennpreise können
auch Prunkgeschirre, z.
B. Sättel, in künstlerisch
ausgeführter Leder-
arbeit, dienen. Am
besten eignen sich dazu
heraldische Motive.
Mappenabzeichen sind:
daspufeisen,derpserde-
kopf en kace und das
ganze Pferd. (Stutt-
garter Stadtwappen.)
Als Schildhalter sind
der Pegasus oder Len-
taurengestalten paffend.
Das allgemeine Interesse am Reitsport zeigt sich auf's
Deutlichste an der Menge von Perrenschmucksachen — die
Damenwelt schließt sich übrigens nicht völlig aus ■—, die
als Sportembleme gebildet oder mit solchen verziert sind.
Ueber diese Liebhaberei ist schon viel gespottet und ästhe-
tische Splitterrichterei getrieben worden. Wenn ihr mit
Maaß und Geschmack gehuldigt und die letztgenannte
Eigenschaft dem Verfertiger die Pand geführt hat, so ist
nicht wohl etwas dagegen einzuwenden. ■— Da ist vor
Allem das glückbedeutende Pufeisen, das seiner günstigen
Form wegen — vielleicht auch ein klein bißchen aus
Aberglauben? — auf alle mögliche Art verwendet wird.
Ganz hübsch sind die paarweise getragenen, durch Kettchen
verbundenen Shawlnadeln, die mit entsprechenden Em-
blemen geschmückt sind, z. B. die einen als Pufeisen ge-
bildet, die anderen als kreisrundes Plättchen, mit einem
modellirten oder emaillirten Pferdekopf. Ferner bieten Uhr-
anhänger, Eigarettendosen, Manschettenknöpse und Uhr-
gehäuse Gelegenheit zu gravirten oder emaillirten Dar-
stellungen. Poetischere Embleme, die auch zur Verwen-
dung als Schmuck geeignet sind, bietet die Parforcejagd.
Aus Vorstehendem geht wohl hervor, daß die Auf-
gabe, Kunstwerke, namentlich Ehrenpreise, mit Bezügen
auf den Reitsport auszustatten, eine sehr schwierige ist, die
nicht in allen Fällen befriedigend gelöst wurde. Die or-
namentale Plastik wird wohl daran thun, sich des Pferdes
mit Vorsicht zu bedienen; und für die künstlerische Dar-
stellung von Roß und Reiter bieten die heute meist üb-
lichen Ehrenpokale oder Prunkgesäße nicht Standfläche
genug. Es ließen sich aber Gegenstände zu Rennpreisen
wählen, die diesen Fehler nicht haben; es sei gestattet,
hier auf das berühmte Georgshorn im Amsterdamer
Stadthause hinzuweisen, wo die Reiterfigur in jeder Be-
ziehung passend und wirkungsvoll angebracht ist. Am
schönsten nehmen sich Pferd und Reiter ja stets bei archi-
tektonischem, breitem Unterbau aus, wie wir dies an un-
zähligen Reiterdenkmälern beobachten können. Einen
solchen Unterbau finden wir in der Standuhr und beim
;7^. Sportvignette aus der Zeitschrift
»Paris illustre«.