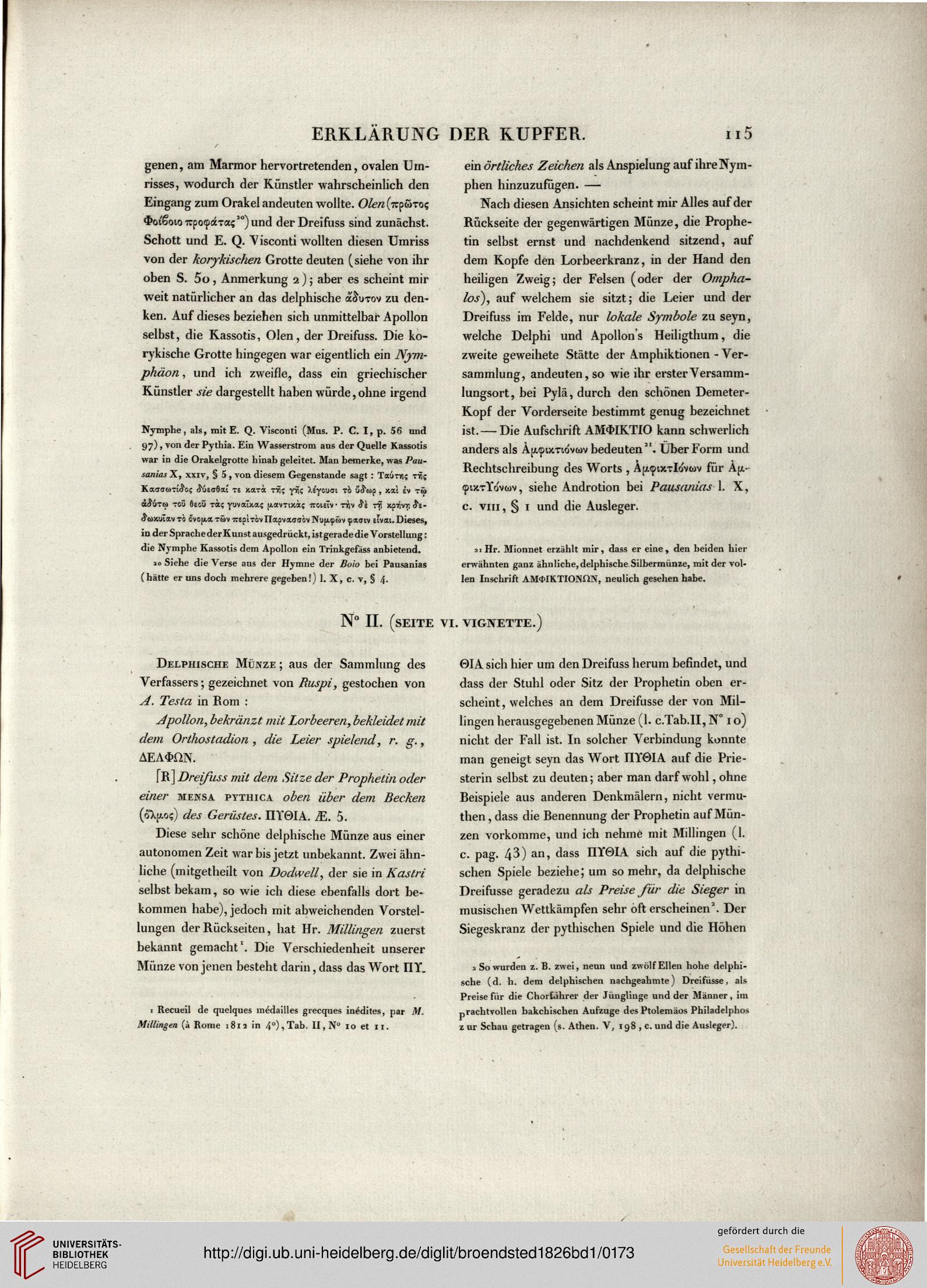ERKLÄRUNG DER KUPFER.
n5
genen, am Marmor hervortretenden, ovalen Urn-
risses, wodurch der Künstler wahrscheinlich den
Eingang zum Orakel andeuten wollte. Ölen (-repöTo?
<Poi§oiOTcpo(pa-rasJO)und der Dreifuss sind zunächst.
Schott und E. Q. Visconti Wollten diesen Umriss
von der korykischen Grotte deuten (siehe von ihr
oben S. 5o, Anmerkung 2); aber es scheint mir
weit natürlicher an das delphische a£u-rov zu den-
ken. Auf dieses beziehen sich unmittelbar Apollon
selbst, die Rassotis, Ölen, der Dreifuss. Die ko-
rykische Grotte hingegen war eigentlich ein Njm-
phäon, und ich zweifle, dass ein griechischer
Künstler sie dargestellt haben würde, ohne irgend
Nymphe, als, mit E. Q. Visconti (Mus. P. C. I, p. 56 und
97), von der Pythia. Ein Wasserstrom aus der Quelle Kassotis
war in die Orakelgrotte hinab geleitet. Man bemerke, was Pau-
sanias X, xxiv, § 5 , von diesem Gegenstande sagt: T<xutyis tu;
KacrffUTtoo? ^u£GÖat re jcaxä rü; yxs Xeycuai to UfSVp , xal ev tu
äeJÜTw toO fleoü t«{ Yüvsüxa; (iOTTixi; irouTv rnv <H r»i xpiivr, $i-
SamXa.vzb ävopLaTwvxEp'[TÖvnapvaaibvNo(if(ivip«oiv ttvat.Dieses,
in der SprachederKunst ausgedrückt, ist geradedie Vorstellung:
die Nymphe Kassotis dem Apollon ein Trinkgefäss anbietend.
>• Siehe die Verse aus der Hymne der Boio bei Pausanias
(hätte er uns doch mehrere gegeben!) 1. X, c. v, § 4.
ein örtliches Zeichen als Anspielung auf ihre Nym-
phen hinzuzufügen. —
Nach diesen Ansichten scheint mir Alles auf der
Rückseite der gegenwärtigen Münze, die Prophe-
tin selbst ernst und nachdenkend sitzend, auf
dem Kopfe den Lorbeerkranz, in der Hand den
heiligen Zweig; der Felsen (oder der Ompha-
los), auf welchem sie sitzt; die Leier und der
Dreifuss im Felde, nur lokale Symbole zu seyn,
welche Delphi und Apollon's Heiligthum, die
zweite geweihete Stätte der Amphiktionen - Ver-
sammlung, andeuten, so wie ihr erster Versamm-
lungsort, bei Pylä, durch den schönen Demeter-
Kopf der Vorderseite bestimmt genug bezeichnet
ist.— Die Aufschrift AM*IKTIO kann schwerlich
anders als Äj/.<p»tTiov(ov bedeuten2'. Über Form und
Rechtschreibung des Worts , Äfüpixxlovwv für Ä(x-
(pixrYovcov, siehe Androtion bei Pausanias \. X,
c. viii, § 1 und die Ausleger.
21 Hr. Mionnet erzählt mir, dass er eine, den beiden hier
erwähnten ganz ähnliche, delphische Silbermünze, mit der vol-
len Inschrift AMtlKTIONfiN, neulich gesehen habe.
N° II. (SEITE VI. VIGNETTE.)
Delphische Münze ; aus der Sammlung des
Verfassers; gezeichnet von Ruspi, gestochen von
A. Testa in Rom :
Apollon, bekränzt mit Lorbeeren, bekleidet mit
dem Orthostadion, die Leier spielend, r. g.,
AEAfcftN.
[R] Dreifuss mit dem Sitze der Prophetin oder
einer mensa ptthica oben über dem Becken
(öXjao?) des Gerüstes. IIY0IA. JE. 5.
Diese sehr schöne delphische Münze aus einer
autonomen Zeit war bis jetzt unbekannt. Zwei ähn-
liche (mitgetheilt von Dodwell, der sie in Kastri
selbst bekam, so wie ich diese ebenfalls dort be-
kommen habe), jedoch mit abweichenden Vorstel-
lungen der Rückseiten, hat Hr. Millingen zuerst
bekannt gemacht1. Die Verschiedenheit unserer
Münze von jenen besteht darin, dass das Wort nY.
i Recueil de quelques medailles grecques in^dites, par M.
Millingen (ä Rome 1811 in 4°),Tab. II, N° 10 et n.
0IA sich hier um den Dreifuss herum befindet, und
dass der Stuhl oder Sitz der Prophetin oben er-
scheint , welches an dem Dreifusse der von Mil-
lingen herausgegebenen Münze (1. c.Tab.H, N° i o)
nicht der Fall ist. In solcher Verbindung konnte
man geneigt seyn das Wort nYOIA auf die Prie-
sterin selbst zu deuten; aber man darf wohl, ohne
Beispiele aus anderen Denkmälern, nicht vermu-
then, dass die Benennung der Prophetin auf Mün-
zen vorkomme, und ich nehme mit Millingen (1.
c. pag. 43) an, dass nY0IA sich auf die pythi-
schen Spiele beziehe; um so mehr, da delphische
Dreifusse geradezu als Preise für die Sieger in
musischen Wettkämpfen sehr oft erscheinen3. Der
Siegeskranz der pythischen Spiele und die Höhen
s So wurden z. B. zwei, neun und zwölf Ellen hohe delphi-
sche (d. h. dem delphischen nachgeahmte) Dreifusse, als
Preise für die Chorfahrer der Jünglinge und der Männer, im
prachtvollen bakchischen Aufzuge des Ptolemäos Philadelphos
z ur Schau getragen (s. Athen. V, 198 , c. und die Ausleger).
n5
genen, am Marmor hervortretenden, ovalen Urn-
risses, wodurch der Künstler wahrscheinlich den
Eingang zum Orakel andeuten wollte. Ölen (-repöTo?
<Poi§oiOTcpo(pa-rasJO)und der Dreifuss sind zunächst.
Schott und E. Q. Visconti Wollten diesen Umriss
von der korykischen Grotte deuten (siehe von ihr
oben S. 5o, Anmerkung 2); aber es scheint mir
weit natürlicher an das delphische a£u-rov zu den-
ken. Auf dieses beziehen sich unmittelbar Apollon
selbst, die Rassotis, Ölen, der Dreifuss. Die ko-
rykische Grotte hingegen war eigentlich ein Njm-
phäon, und ich zweifle, dass ein griechischer
Künstler sie dargestellt haben würde, ohne irgend
Nymphe, als, mit E. Q. Visconti (Mus. P. C. I, p. 56 und
97), von der Pythia. Ein Wasserstrom aus der Quelle Kassotis
war in die Orakelgrotte hinab geleitet. Man bemerke, was Pau-
sanias X, xxiv, § 5 , von diesem Gegenstande sagt: T<xutyis tu;
KacrffUTtoo? ^u£GÖat re jcaxä rü; yxs Xeycuai to UfSVp , xal ev tu
äeJÜTw toO fleoü t«{ Yüvsüxa; (iOTTixi; irouTv rnv <H r»i xpiivr, $i-
SamXa.vzb ävopLaTwvxEp'[TÖvnapvaaibvNo(if(ivip«oiv ttvat.Dieses,
in der SprachederKunst ausgedrückt, ist geradedie Vorstellung:
die Nymphe Kassotis dem Apollon ein Trinkgefäss anbietend.
>• Siehe die Verse aus der Hymne der Boio bei Pausanias
(hätte er uns doch mehrere gegeben!) 1. X, c. v, § 4.
ein örtliches Zeichen als Anspielung auf ihre Nym-
phen hinzuzufügen. —
Nach diesen Ansichten scheint mir Alles auf der
Rückseite der gegenwärtigen Münze, die Prophe-
tin selbst ernst und nachdenkend sitzend, auf
dem Kopfe den Lorbeerkranz, in der Hand den
heiligen Zweig; der Felsen (oder der Ompha-
los), auf welchem sie sitzt; die Leier und der
Dreifuss im Felde, nur lokale Symbole zu seyn,
welche Delphi und Apollon's Heiligthum, die
zweite geweihete Stätte der Amphiktionen - Ver-
sammlung, andeuten, so wie ihr erster Versamm-
lungsort, bei Pylä, durch den schönen Demeter-
Kopf der Vorderseite bestimmt genug bezeichnet
ist.— Die Aufschrift AM*IKTIO kann schwerlich
anders als Äj/.<p»tTiov(ov bedeuten2'. Über Form und
Rechtschreibung des Worts , Äfüpixxlovwv für Ä(x-
(pixrYovcov, siehe Androtion bei Pausanias \. X,
c. viii, § 1 und die Ausleger.
21 Hr. Mionnet erzählt mir, dass er eine, den beiden hier
erwähnten ganz ähnliche, delphische Silbermünze, mit der vol-
len Inschrift AMtlKTIONfiN, neulich gesehen habe.
N° II. (SEITE VI. VIGNETTE.)
Delphische Münze ; aus der Sammlung des
Verfassers; gezeichnet von Ruspi, gestochen von
A. Testa in Rom :
Apollon, bekränzt mit Lorbeeren, bekleidet mit
dem Orthostadion, die Leier spielend, r. g.,
AEAfcftN.
[R] Dreifuss mit dem Sitze der Prophetin oder
einer mensa ptthica oben über dem Becken
(öXjao?) des Gerüstes. IIY0IA. JE. 5.
Diese sehr schöne delphische Münze aus einer
autonomen Zeit war bis jetzt unbekannt. Zwei ähn-
liche (mitgetheilt von Dodwell, der sie in Kastri
selbst bekam, so wie ich diese ebenfalls dort be-
kommen habe), jedoch mit abweichenden Vorstel-
lungen der Rückseiten, hat Hr. Millingen zuerst
bekannt gemacht1. Die Verschiedenheit unserer
Münze von jenen besteht darin, dass das Wort nY.
i Recueil de quelques medailles grecques in^dites, par M.
Millingen (ä Rome 1811 in 4°),Tab. II, N° 10 et n.
0IA sich hier um den Dreifuss herum befindet, und
dass der Stuhl oder Sitz der Prophetin oben er-
scheint , welches an dem Dreifusse der von Mil-
lingen herausgegebenen Münze (1. c.Tab.H, N° i o)
nicht der Fall ist. In solcher Verbindung konnte
man geneigt seyn das Wort nYOIA auf die Prie-
sterin selbst zu deuten; aber man darf wohl, ohne
Beispiele aus anderen Denkmälern, nicht vermu-
then, dass die Benennung der Prophetin auf Mün-
zen vorkomme, und ich nehme mit Millingen (1.
c. pag. 43) an, dass nY0IA sich auf die pythi-
schen Spiele beziehe; um so mehr, da delphische
Dreifusse geradezu als Preise für die Sieger in
musischen Wettkämpfen sehr oft erscheinen3. Der
Siegeskranz der pythischen Spiele und die Höhen
s So wurden z. B. zwei, neun und zwölf Ellen hohe delphi-
sche (d. h. dem delphischen nachgeahmte) Dreifusse, als
Preise für die Chorfahrer der Jünglinge und der Männer, im
prachtvollen bakchischen Aufzuge des Ptolemäos Philadelphos
z ur Schau getragen (s. Athen. V, 198 , c. und die Ausleger).