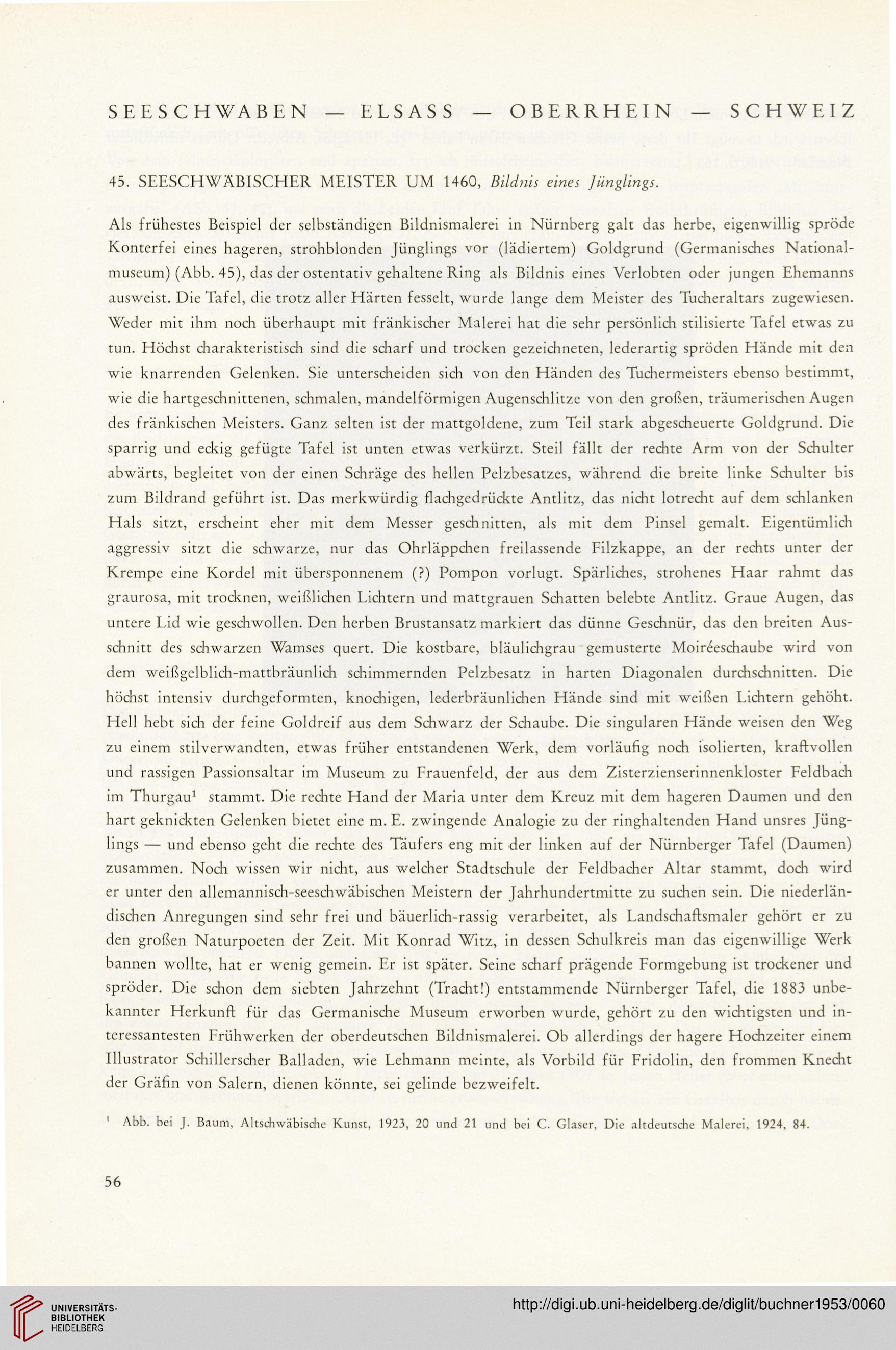SEESCHWABEN
ELSAS S
OBERRHEIN
SCHWEIZ
45. SEESCHWÄBISCHER MEISTER UM 1460, Bildnis eines Jünglings.
Als frühestes Beispiel der selbständigen Bildnismalerei in Nürnberg galt das herbe, eigenwillig spröde
Konterfei eines hageren, strohblonden Jünglings vor (lädiertem) Goldgrund (Germanisches National-
museum) (Abb. 45), das der ostentativ gehaltene Ring als Bildnis eines Verlobten oder jungen Ehemanns
ausweist. Die Tafel, die trotz aller Härten fesselt, wurde lange dem Meister des Tucheraltars zugewiesen.
Weder mit ihm noch überhaupt mit fränkischer Malerei hat die sehr persönlich stilisierte Tafel etwas zu
tun. Höchst charakteristisch sind die scharf und trocken gezeichneten, lederartig spröden Hände mit den
wie knarrenden Gelenken. Sie unterscheiden sich von den Händen des Tuchermeisters ebenso bestimmt,
wie die hartgeschnittenen, schmalen, mandelförmigen Augenschlitze von den großen, träumerischen Augen
des fränkischen Meisters. Ganz selten ist der mattgoldene, zum Teil stark abgescheuerte Goldgrund. Die
sparrig und eckig gefügte Tafel ist unten etwas verkürzt. Steil fällt der rechte Arm von der Schulter
abwärts, begleitet von der einen Schräge des hellen Pelzbesatzes, während die breite linke Schulter bis
zum Bildrand geführt ist. Das merkwürdig flachgedrückte Antlitz, das nicht lotrecht auf dem schlanken
Hals sitzt, erscheint eher mit dem Messer geschnitten, als mit dem Pinsel gemalt. Eigentümlich
aggressiv sitzt die schwarze, nur das Ohrläppchen freilassende Filzkappe, an der rechts unter der
Krempe eine Kordel mit übersponnenem (?) Pompon vorlugt. Spärliches, strohenes Haar rahmt das
graurosa, mit trocknen, weißlichen Lichtern und mattgrauen Schatten belebte Antlitz. Graue Augen, das
untere Lid wie geschwollen. Den herben Brustansatz markiert das dünne Geschnür, das den breiten Aus-
schnitt des schwarzen Wamses quert. Die kostbare, bläulichgrau gemusterte Moireeschaube wird von
dem weißgelblich-mattbräunlich schimmernden Pelzbesatz in harten Diagonalen durchschnitten. Die
höchst intensiv durchgeformten, knochigen, lederbräunlichen Hände sind mit weißen Lichtern gehöht.
Hell hebt sich der feine Goldreif aus dem Schwarz der Schaube. Die singularen Hände weisen den Weg
zu einem stilverwandten, etwas früher entstandenen Werk, dem vorläufig noch isolierten, kraftvollen
und rassigen Passionsaltar im Museum zu Frauenfeld, der aus dem Zisterzienserinnenkloster Feldbach
im Thurgau 1 stammt. Die rechte Hand der Maria unter dem Kreuz mit dem hageren Daumen und den
hart geknickten Gelenken bietet eine m. E. zwingende Analogie zu der ringhaltenden Hand unsres Jüng-
lings — und ebenso geht die rechte des Täufers eng mit der linken auf der Nürnberger Tafel (Daumen)
zusammen. Noch wissen wir nicht, aus welcher Stadtschule der Feldbacher Altar stammt, doch wird
er unter den allemannisch-seeschwäbischen Meistern der Jahrhundertmitte zu suchen sein. Die niederlän-
dischen Anregungen sind sehr frei und bäuerlich-rassig verarbeitet, als Landschaftsmaler gehört er zu
den großen Naturpoeten der Zeit. Mit Konrad Witz, in dessen Schulkreis man das eigenwillige Werk
bannen wollte, hat er wenig gemein. Er ist später. Seine scharf prägende Formgebung ist trockener und
spröder. Die schon dem siebten Jahrzehnt (Tracht!) entstammende Nürnberger Tafel, die 1883 unbe-
kannter Herkunft für das Germanische Museum erworben wurde, gehört zu den wichtigsten und in-
teressantesten Frühwerken der oberdeutschen Bildnismalerei. Ob allerdings der hagere Hochzeiter einem
lllustrator Schillerscher Balladen, wie Lehmann meinte, als Vorbild für Fridolin, den frommen Knecht
der Gräfin von Salern, dienen könnte, sei gelinde bezweifelt.
' Abb. bei J. Baum, Altschwäbische Kunst, 1923, 20 und 21 und bei C. Glaser, Die altdeutsche Malerei, 1924, 84.
56
ELSAS S
OBERRHEIN
SCHWEIZ
45. SEESCHWÄBISCHER MEISTER UM 1460, Bildnis eines Jünglings.
Als frühestes Beispiel der selbständigen Bildnismalerei in Nürnberg galt das herbe, eigenwillig spröde
Konterfei eines hageren, strohblonden Jünglings vor (lädiertem) Goldgrund (Germanisches National-
museum) (Abb. 45), das der ostentativ gehaltene Ring als Bildnis eines Verlobten oder jungen Ehemanns
ausweist. Die Tafel, die trotz aller Härten fesselt, wurde lange dem Meister des Tucheraltars zugewiesen.
Weder mit ihm noch überhaupt mit fränkischer Malerei hat die sehr persönlich stilisierte Tafel etwas zu
tun. Höchst charakteristisch sind die scharf und trocken gezeichneten, lederartig spröden Hände mit den
wie knarrenden Gelenken. Sie unterscheiden sich von den Händen des Tuchermeisters ebenso bestimmt,
wie die hartgeschnittenen, schmalen, mandelförmigen Augenschlitze von den großen, träumerischen Augen
des fränkischen Meisters. Ganz selten ist der mattgoldene, zum Teil stark abgescheuerte Goldgrund. Die
sparrig und eckig gefügte Tafel ist unten etwas verkürzt. Steil fällt der rechte Arm von der Schulter
abwärts, begleitet von der einen Schräge des hellen Pelzbesatzes, während die breite linke Schulter bis
zum Bildrand geführt ist. Das merkwürdig flachgedrückte Antlitz, das nicht lotrecht auf dem schlanken
Hals sitzt, erscheint eher mit dem Messer geschnitten, als mit dem Pinsel gemalt. Eigentümlich
aggressiv sitzt die schwarze, nur das Ohrläppchen freilassende Filzkappe, an der rechts unter der
Krempe eine Kordel mit übersponnenem (?) Pompon vorlugt. Spärliches, strohenes Haar rahmt das
graurosa, mit trocknen, weißlichen Lichtern und mattgrauen Schatten belebte Antlitz. Graue Augen, das
untere Lid wie geschwollen. Den herben Brustansatz markiert das dünne Geschnür, das den breiten Aus-
schnitt des schwarzen Wamses quert. Die kostbare, bläulichgrau gemusterte Moireeschaube wird von
dem weißgelblich-mattbräunlich schimmernden Pelzbesatz in harten Diagonalen durchschnitten. Die
höchst intensiv durchgeformten, knochigen, lederbräunlichen Hände sind mit weißen Lichtern gehöht.
Hell hebt sich der feine Goldreif aus dem Schwarz der Schaube. Die singularen Hände weisen den Weg
zu einem stilverwandten, etwas früher entstandenen Werk, dem vorläufig noch isolierten, kraftvollen
und rassigen Passionsaltar im Museum zu Frauenfeld, der aus dem Zisterzienserinnenkloster Feldbach
im Thurgau 1 stammt. Die rechte Hand der Maria unter dem Kreuz mit dem hageren Daumen und den
hart geknickten Gelenken bietet eine m. E. zwingende Analogie zu der ringhaltenden Hand unsres Jüng-
lings — und ebenso geht die rechte des Täufers eng mit der linken auf der Nürnberger Tafel (Daumen)
zusammen. Noch wissen wir nicht, aus welcher Stadtschule der Feldbacher Altar stammt, doch wird
er unter den allemannisch-seeschwäbischen Meistern der Jahrhundertmitte zu suchen sein. Die niederlän-
dischen Anregungen sind sehr frei und bäuerlich-rassig verarbeitet, als Landschaftsmaler gehört er zu
den großen Naturpoeten der Zeit. Mit Konrad Witz, in dessen Schulkreis man das eigenwillige Werk
bannen wollte, hat er wenig gemein. Er ist später. Seine scharf prägende Formgebung ist trockener und
spröder. Die schon dem siebten Jahrzehnt (Tracht!) entstammende Nürnberger Tafel, die 1883 unbe-
kannter Herkunft für das Germanische Museum erworben wurde, gehört zu den wichtigsten und in-
teressantesten Frühwerken der oberdeutschen Bildnismalerei. Ob allerdings der hagere Hochzeiter einem
lllustrator Schillerscher Balladen, wie Lehmann meinte, als Vorbild für Fridolin, den frommen Knecht
der Gräfin von Salern, dienen könnte, sei gelinde bezweifelt.
' Abb. bei J. Baum, Altschwäbische Kunst, 1923, 20 und 21 und bei C. Glaser, Die altdeutsche Malerei, 1924, 84.
56