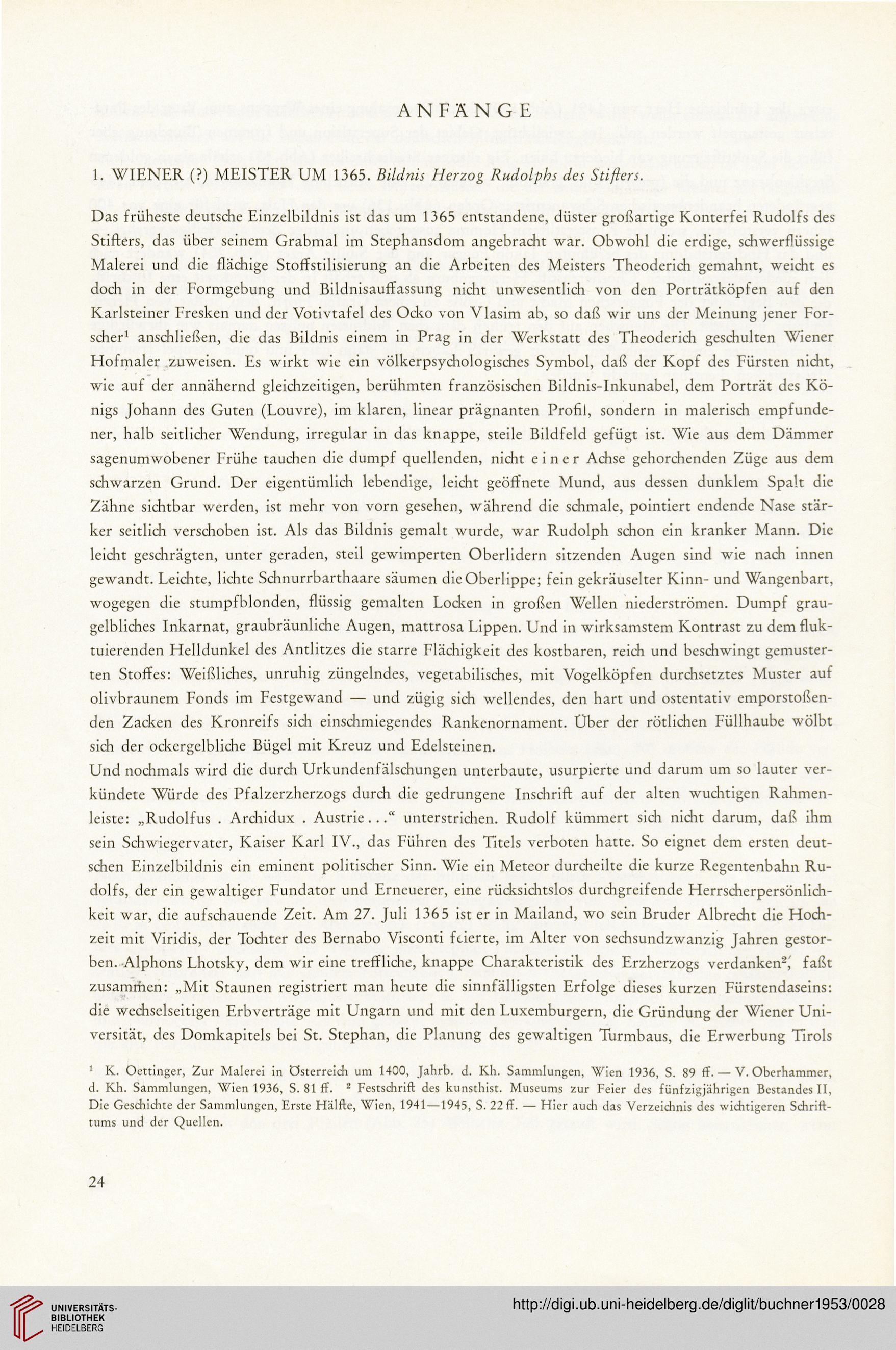ANFÄN G E
1. WIENER (?) MEISTER UM 1365. Bildnis Herzog Rudolphs des Stifters.
Das früheste deutsche Einzelbildnis ist das um 1365 entstandene, düster großartige Konterfei Rudolfs des
Stiflers, das über seinem Grabmal im Stephansdom angebracht war. Obwohl die erdige, schwerflüssige
Malerei und die flächige Stoffstilisierung an die Arbeiten des Meisters Theoderich gemahnt, weicht es
doch in der Formgebung und Bildnisauffassung nicht unwesentlich von den Porträtköpfen auf den
Karlsteiner Fresken und der Votivtafel des Ocko von Vlasim ab, so daß wir uns der Meinung jener For-
scher 1 anschließen, die das Bildnis einem in Prag in der Werkstatt des Theoderich geschulten Wiener
Hofmaler zuweisen. Es wirkt wie ein völkerpsychologisches Symbol, daß der Kopf des Fürsten nicht,
wie auf der annähernd gleichzeitigen, berühmten französischen Bildnis-Inkunabel, dem Porträt des Kö-
nigs Johann des Guten (Louvre), im klaren, linear prägnanten Profii, sondern in malerisch empfunde-
ner, halb seitlicher Wendung, irregular in das knappe, steile Bildfeld gefügt ist. Wie aus dem Dämmer
sagenumwobener Frühe tauchen die dumpf quellenden, nicht e i n e r Achse gehorchenden Züge aus dem
schwarzen Grund. Der eigentümlich lebendige, leicht geöffnete Mund, aus dessen dunklem Spalt die
Zähne sichtbar werden, ist mehr von vorn gesehen, während die schmale, pointiert endende Nase stär-
ker seitlich verschoben ist. Als das Bildnis gemalt wurde, war Rudolph schon ein kranker Mann. Die
leicht geschrägten, unter geraden, steil gewimperten Oberlidern sitzenden Augen sind wie nach innen
gewandt. Leichte, lichte Schnurrbarthaare säumen dieOberlippe; fein gekräuselter Kinn- und Wangenbart,
wogegen die stumpfblonden, flüssig gemalten Locken in großen Wellen niederströmen. Dumpf grau-
gelbliches Inkarnat, graubräunliche Augen, mattrosa Lippen. Und in wirksamstem Kontrast zu dem fluk-
tuierenden Helldunkel des Antlitzes die starre Flächigkeit des kostbaren, reich und beschwingt gemuster-
ten Stoffes: Weißliches, unruhig züngelndes, vegetabilisches, mit Vogelköpfen durchsetztes Muster auf
olivbraunem Fonds im Festgewand — und zügig sich wellendes, den hart und ostentativ emporstoßen-
den Zacken des Kronreifs sich einschmiegendes Rankenornament. Über der rötlichen Füllhaube wölbt
sich der ockergelbliche Bügel mit Kreuz und Edelsteinen.
Und nochmals wird die durch Urkundenfälschungen unterbaute, usurpierte und darum um so lauter ver-
kündete Würde des Pfalzerzherzogs durch die gedrungene Inschrift auf der alten wuchtigen Rahmen-
leiste: „Rudolfus . Archidux . Austrie..unterstrichen. Rudolf kümmert sich nicht darum, daß ihm
sein Schwiegervater, Kaiser Karl IV., das Führen des Titels verboten hatte. So eignet dem ersten deut-
schen Einzelbildnis ein eminent politischer Sinn. Wie ein Meteor durcheilte die kurze Regentenbahn Ru-
dolfs, der ein gewaltiger Fundator und Erneuerer, eine rücksichtslos durchgreifende Herrscherpersönlich-
keit war, die aufschauende Zeit. Am 27. Juli 1365 ist er in Mailand, wo sein Bruder Albrecht die Hoch-
zeit mit Viridis, der Tochter des Bernabo Visconti ftierte, im Alter von sechsundzwanzig Jahren gestor-
ben. Alphons Lhotsky, dem wir eine treffliche, knappe Charakteristik des Erzherzogs verdanken 2,' faßt
zusammen: „Mit Staunen registriert man heute die sinnfälligsten Erfolge dieses kurzen Fürstendaseins:
die wechselseitigen Erbverträge mit Ungarn und mit den Luxemburgern, die Gründung der Wiener Uni-
versität, des Domkapitels bei St. Stephan, die Planung des gewaltigen Turmbaus, die Erwerbung Tirols
1 K. Oettinger, Zur Malerei in österreich um 1400, Jahrb. d. Kh. Sammlungen, Wien 1936, S. 89 ff. — V. Oberhammer,
d. Kh. Sammlungen, Wien 1936, S. 81 ff. 2 Festschrift des kunsthist. Museums zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes II,
Die Geschichte der Sammlungen, Erste Hälfte, Wien, 1941—1945, S. 22 ff. — Hier auch das Verzeichnis des wichtigeren Schrift-
tums und der Quellen.
24
1. WIENER (?) MEISTER UM 1365. Bildnis Herzog Rudolphs des Stifters.
Das früheste deutsche Einzelbildnis ist das um 1365 entstandene, düster großartige Konterfei Rudolfs des
Stiflers, das über seinem Grabmal im Stephansdom angebracht war. Obwohl die erdige, schwerflüssige
Malerei und die flächige Stoffstilisierung an die Arbeiten des Meisters Theoderich gemahnt, weicht es
doch in der Formgebung und Bildnisauffassung nicht unwesentlich von den Porträtköpfen auf den
Karlsteiner Fresken und der Votivtafel des Ocko von Vlasim ab, so daß wir uns der Meinung jener For-
scher 1 anschließen, die das Bildnis einem in Prag in der Werkstatt des Theoderich geschulten Wiener
Hofmaler zuweisen. Es wirkt wie ein völkerpsychologisches Symbol, daß der Kopf des Fürsten nicht,
wie auf der annähernd gleichzeitigen, berühmten französischen Bildnis-Inkunabel, dem Porträt des Kö-
nigs Johann des Guten (Louvre), im klaren, linear prägnanten Profii, sondern in malerisch empfunde-
ner, halb seitlicher Wendung, irregular in das knappe, steile Bildfeld gefügt ist. Wie aus dem Dämmer
sagenumwobener Frühe tauchen die dumpf quellenden, nicht e i n e r Achse gehorchenden Züge aus dem
schwarzen Grund. Der eigentümlich lebendige, leicht geöffnete Mund, aus dessen dunklem Spalt die
Zähne sichtbar werden, ist mehr von vorn gesehen, während die schmale, pointiert endende Nase stär-
ker seitlich verschoben ist. Als das Bildnis gemalt wurde, war Rudolph schon ein kranker Mann. Die
leicht geschrägten, unter geraden, steil gewimperten Oberlidern sitzenden Augen sind wie nach innen
gewandt. Leichte, lichte Schnurrbarthaare säumen dieOberlippe; fein gekräuselter Kinn- und Wangenbart,
wogegen die stumpfblonden, flüssig gemalten Locken in großen Wellen niederströmen. Dumpf grau-
gelbliches Inkarnat, graubräunliche Augen, mattrosa Lippen. Und in wirksamstem Kontrast zu dem fluk-
tuierenden Helldunkel des Antlitzes die starre Flächigkeit des kostbaren, reich und beschwingt gemuster-
ten Stoffes: Weißliches, unruhig züngelndes, vegetabilisches, mit Vogelköpfen durchsetztes Muster auf
olivbraunem Fonds im Festgewand — und zügig sich wellendes, den hart und ostentativ emporstoßen-
den Zacken des Kronreifs sich einschmiegendes Rankenornament. Über der rötlichen Füllhaube wölbt
sich der ockergelbliche Bügel mit Kreuz und Edelsteinen.
Und nochmals wird die durch Urkundenfälschungen unterbaute, usurpierte und darum um so lauter ver-
kündete Würde des Pfalzerzherzogs durch die gedrungene Inschrift auf der alten wuchtigen Rahmen-
leiste: „Rudolfus . Archidux . Austrie..unterstrichen. Rudolf kümmert sich nicht darum, daß ihm
sein Schwiegervater, Kaiser Karl IV., das Führen des Titels verboten hatte. So eignet dem ersten deut-
schen Einzelbildnis ein eminent politischer Sinn. Wie ein Meteor durcheilte die kurze Regentenbahn Ru-
dolfs, der ein gewaltiger Fundator und Erneuerer, eine rücksichtslos durchgreifende Herrscherpersönlich-
keit war, die aufschauende Zeit. Am 27. Juli 1365 ist er in Mailand, wo sein Bruder Albrecht die Hoch-
zeit mit Viridis, der Tochter des Bernabo Visconti ftierte, im Alter von sechsundzwanzig Jahren gestor-
ben. Alphons Lhotsky, dem wir eine treffliche, knappe Charakteristik des Erzherzogs verdanken 2,' faßt
zusammen: „Mit Staunen registriert man heute die sinnfälligsten Erfolge dieses kurzen Fürstendaseins:
die wechselseitigen Erbverträge mit Ungarn und mit den Luxemburgern, die Gründung der Wiener Uni-
versität, des Domkapitels bei St. Stephan, die Planung des gewaltigen Turmbaus, die Erwerbung Tirols
1 K. Oettinger, Zur Malerei in österreich um 1400, Jahrb. d. Kh. Sammlungen, Wien 1936, S. 89 ff. — V. Oberhammer,
d. Kh. Sammlungen, Wien 1936, S. 81 ff. 2 Festschrift des kunsthist. Museums zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes II,
Die Geschichte der Sammlungen, Erste Hälfte, Wien, 1941—1945, S. 22 ff. — Hier auch das Verzeichnis des wichtigeren Schrift-
tums und der Quellen.
24