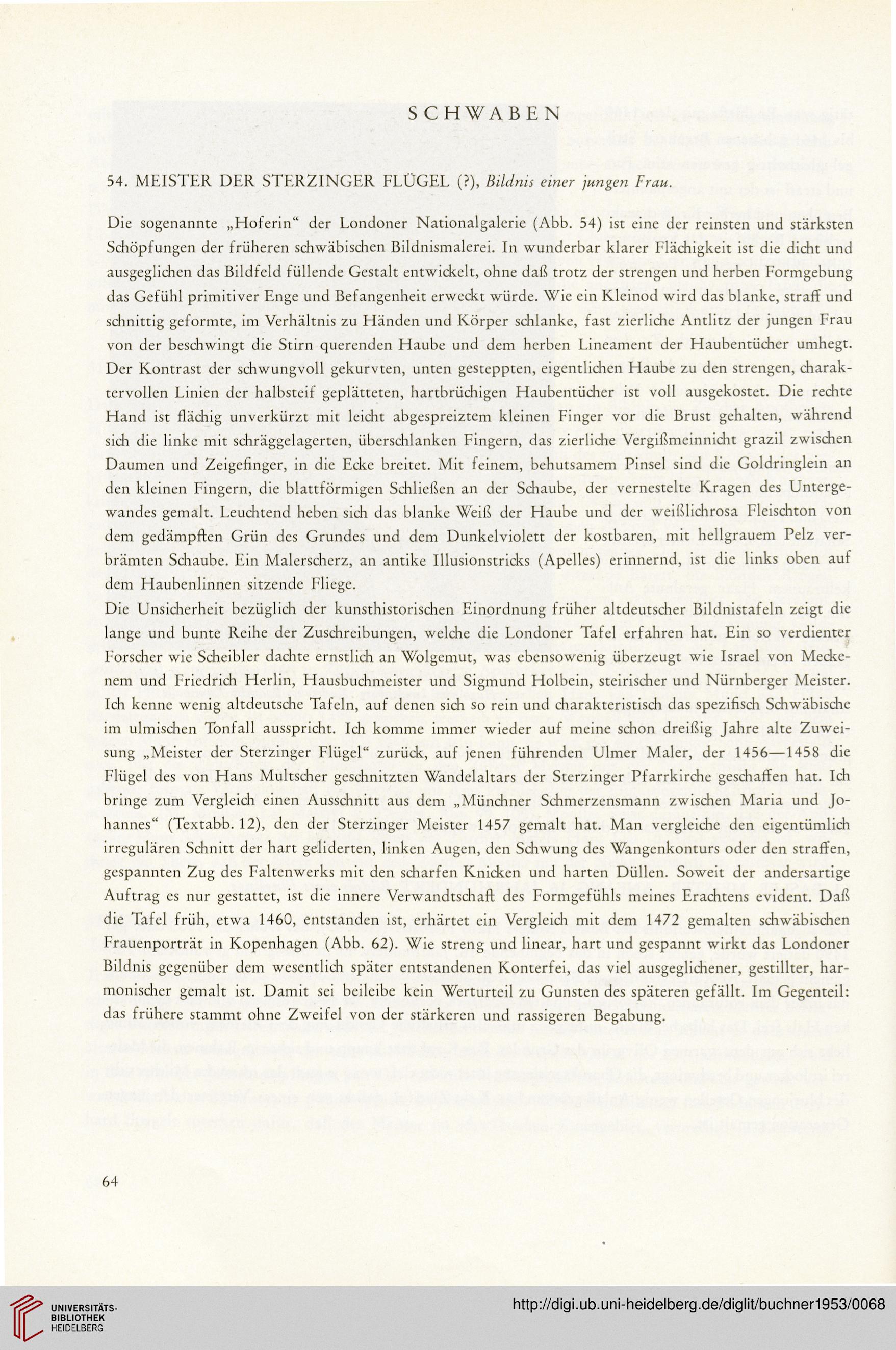SCHWABEN
54. MEISTER DER STERZINGER FLÜGEL (?), Bildnis einer jungen Frau.
Die sogenannte „Hoferin“ der Londoner Nationalgalerie (Abb. 54) ist eine der reinsten und stärksten
Schöpfungen der früheren schwäbischen Bildnismalerei. In wunderbar klarer Flächigkeit ist die dicht und
ausgeglichen das Bildfeld füllende Gestalt entwickelt, ohne daß trotz der strengen und herben Formgebung
das Gefühl primitiver Enge und Befangenheit erweckt würde. Wie ein Kleinod wird das blanke, straff und
schnittig geformte, im Verhältnis zu Händen und Körper schlanke, fast zierliche Antlitz der jungen Frau
von der beschwingt die Stirn querenden Haube und dem herben Lineament der Haubentücher umhegt.
Der Kontrast der schwungvoll gekurvten, unten gesteppten, eigentlichen Haube zu den strengen, charak-
tervollen Linien der halbsteif geplätteten, hartbrüchigen Haubentücher ist voll ausgekostet. Die rechte
Hand ist flächig unverkürzt mit leicht abgespreiztem kleinen Finger vor die Brust gehalten, während
sich die linke mit schräggelagerten, überschlanken Fingern, das zierliche Vergißmeinnicht grazil zwischen
Daumen und Zeigefinger, in die Ecke breitet. Mit feinem, behutsamem Pinsel sind die Goldringlein an
den kleinen Fingern, die blattförmigen Schließen an der Schaube, der vernestelte Kragen des Unterge-
wandes gemalt. Leuchtend heben sich das blanke Weiß der Haube und der weißlichrosa Fleischton von
dem gedämpften Grün des Grundes und dem Dunkelviolett der kostbaren, mit hellgrauem Pelz ver-
brämten Schaube. Ein Malerscherz, an antike Illusionstricks (Apelles) erinnernd, ist die links oben auf
dem Haubenlinnen sitzende Fliege.
Die Unsicherheit bezüglich der kunsthistorischen Einordnung früher altdeutscher Bildnistafeln zeigt die
lange und bunte Reihe der Zuschreibungen, welche die Londoner Tafel erfahren hat. Ein so verdienter
Forscher wie Scheibler dachte ernstlich an Wolgemut, was ebensowenig überzeugt wie Israel von Mecke-
nem und Friedrich Herlin, Hausbuchmeister und Sigmund Holbein, steirischer und Nürnberger Meister.
Ich kenne wenig altdeutsche Tafeln, auf denen sich so rein und charakteristisch das spezifisch Schwäbische
im ulmischen Tonfall ausspricht. Ich komme immer wieder auf meine schon dreißig Jahre alte Zuwei-
sung „Meister der Sterzinger Flügel“ zurück, auf jenen führenden Ulmer Maler, der 1456—1458 die
Flügel des von Hans Multscher geschnitzten Wandelaltars der Sterzinger Pfarrkirche geschaffen hat. Ich
bringe zum Vergleich einen Ausschnitt aus dem „Münchner Schmerzensmann zwischen Maria und Jo-
hannes“ (Textabb. 12), den der Sterzinger Meister 1457 gemalt hat. Man vergleiche den eigentümlich
irregulären Schnitt der hart geliderten, linken Augen, den Schwung des Wangenkonturs oder den straffen,
gespannten Zug des Faltenwerks mit den scharfen Knicken und harten Düllen. Soweit der andersartige
Auftrag es nur gestattet, ist die innere Verwandtschafl des Formgefühls meines Erachtens evident. Daß
die Tafel früh, etwa 1460, entstanden ist, erhärtet ein Vergleich mit dem 1472 gemalten schwäbischen
Frauenporträt in Kopenhagen (Abb. 62). Wie streng und linear, hart und gespannt wirkt das Londoner
Bildnis gegenüber dem wesentlich später entstandenen Konterfei, das viel ausgeglichener, gestillter, har-
monischer gemalt ist. Damit sei beileibe kein Werturteil zu Gunsten des späteren gefällt. Im Gegenteil:
das frühere stammt ohne Zweifel von der stärkeren und rassigeren Begabung.
64
54. MEISTER DER STERZINGER FLÜGEL (?), Bildnis einer jungen Frau.
Die sogenannte „Hoferin“ der Londoner Nationalgalerie (Abb. 54) ist eine der reinsten und stärksten
Schöpfungen der früheren schwäbischen Bildnismalerei. In wunderbar klarer Flächigkeit ist die dicht und
ausgeglichen das Bildfeld füllende Gestalt entwickelt, ohne daß trotz der strengen und herben Formgebung
das Gefühl primitiver Enge und Befangenheit erweckt würde. Wie ein Kleinod wird das blanke, straff und
schnittig geformte, im Verhältnis zu Händen und Körper schlanke, fast zierliche Antlitz der jungen Frau
von der beschwingt die Stirn querenden Haube und dem herben Lineament der Haubentücher umhegt.
Der Kontrast der schwungvoll gekurvten, unten gesteppten, eigentlichen Haube zu den strengen, charak-
tervollen Linien der halbsteif geplätteten, hartbrüchigen Haubentücher ist voll ausgekostet. Die rechte
Hand ist flächig unverkürzt mit leicht abgespreiztem kleinen Finger vor die Brust gehalten, während
sich die linke mit schräggelagerten, überschlanken Fingern, das zierliche Vergißmeinnicht grazil zwischen
Daumen und Zeigefinger, in die Ecke breitet. Mit feinem, behutsamem Pinsel sind die Goldringlein an
den kleinen Fingern, die blattförmigen Schließen an der Schaube, der vernestelte Kragen des Unterge-
wandes gemalt. Leuchtend heben sich das blanke Weiß der Haube und der weißlichrosa Fleischton von
dem gedämpften Grün des Grundes und dem Dunkelviolett der kostbaren, mit hellgrauem Pelz ver-
brämten Schaube. Ein Malerscherz, an antike Illusionstricks (Apelles) erinnernd, ist die links oben auf
dem Haubenlinnen sitzende Fliege.
Die Unsicherheit bezüglich der kunsthistorischen Einordnung früher altdeutscher Bildnistafeln zeigt die
lange und bunte Reihe der Zuschreibungen, welche die Londoner Tafel erfahren hat. Ein so verdienter
Forscher wie Scheibler dachte ernstlich an Wolgemut, was ebensowenig überzeugt wie Israel von Mecke-
nem und Friedrich Herlin, Hausbuchmeister und Sigmund Holbein, steirischer und Nürnberger Meister.
Ich kenne wenig altdeutsche Tafeln, auf denen sich so rein und charakteristisch das spezifisch Schwäbische
im ulmischen Tonfall ausspricht. Ich komme immer wieder auf meine schon dreißig Jahre alte Zuwei-
sung „Meister der Sterzinger Flügel“ zurück, auf jenen führenden Ulmer Maler, der 1456—1458 die
Flügel des von Hans Multscher geschnitzten Wandelaltars der Sterzinger Pfarrkirche geschaffen hat. Ich
bringe zum Vergleich einen Ausschnitt aus dem „Münchner Schmerzensmann zwischen Maria und Jo-
hannes“ (Textabb. 12), den der Sterzinger Meister 1457 gemalt hat. Man vergleiche den eigentümlich
irregulären Schnitt der hart geliderten, linken Augen, den Schwung des Wangenkonturs oder den straffen,
gespannten Zug des Faltenwerks mit den scharfen Knicken und harten Düllen. Soweit der andersartige
Auftrag es nur gestattet, ist die innere Verwandtschafl des Formgefühls meines Erachtens evident. Daß
die Tafel früh, etwa 1460, entstanden ist, erhärtet ein Vergleich mit dem 1472 gemalten schwäbischen
Frauenporträt in Kopenhagen (Abb. 62). Wie streng und linear, hart und gespannt wirkt das Londoner
Bildnis gegenüber dem wesentlich später entstandenen Konterfei, das viel ausgeglichener, gestillter, har-
monischer gemalt ist. Damit sei beileibe kein Werturteil zu Gunsten des späteren gefällt. Im Gegenteil:
das frühere stammt ohne Zweifel von der stärkeren und rassigeren Begabung.
64