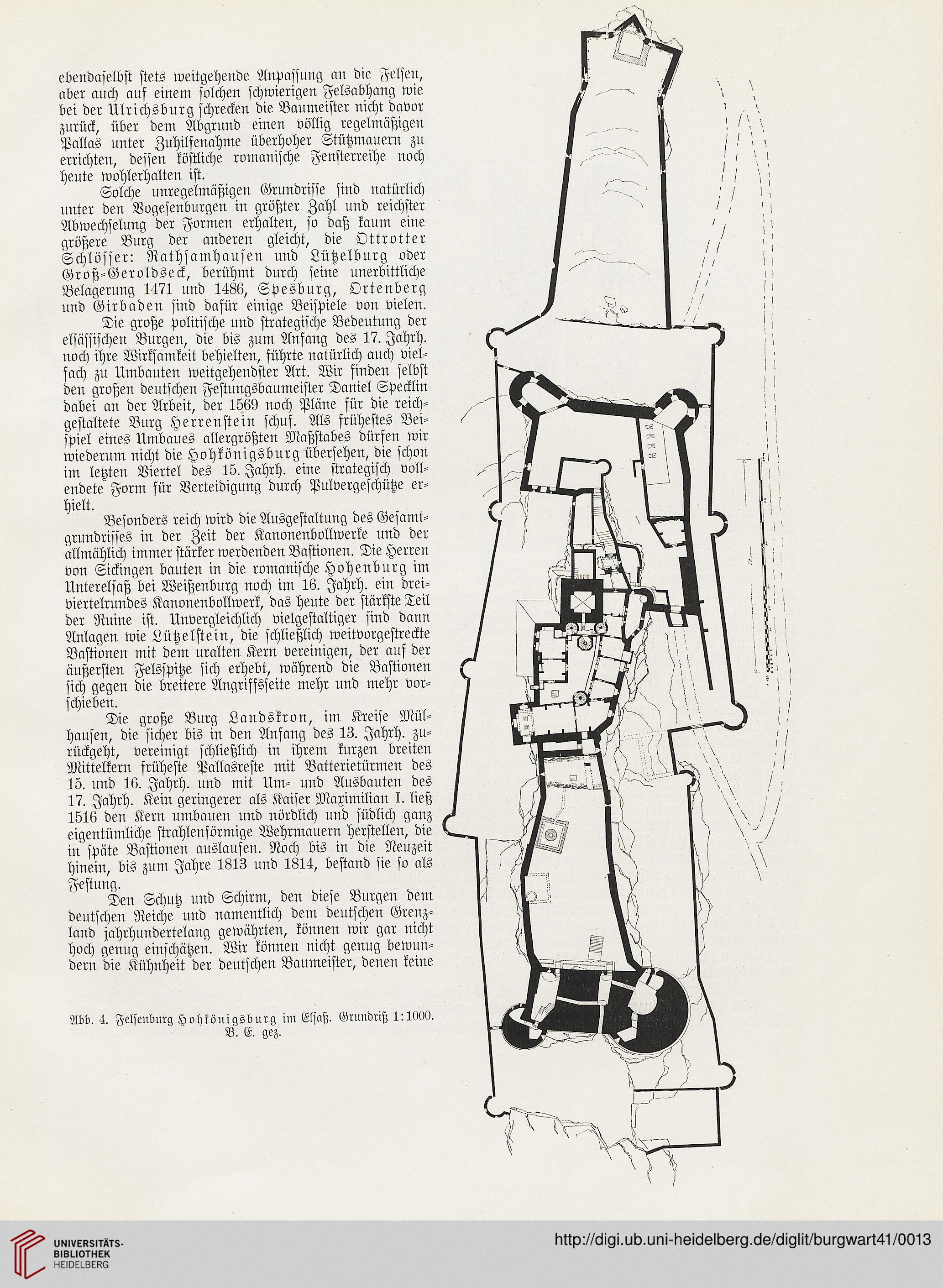ebendaselbst stets weitgehende Anpassung an die Felsen,
aber auch auf einem solchen schwierigen Felsabhang wie
bei der Ulrichsburg schrecken die Baumeister nicht davor
zurück, über dem Abgrund einen völlig regelmäßigen
Pallas unter Zuhilfenahme überhoher Stützmauern zu
errichten, dessen köstliche romanische Fensterreihe noch
heute wohlerhalten ist.
Solche unregelmäßigen Grundrisse sind natürlich
unter den Vogesenburgen in größter Zahl und reichster
Abwechselung der Formen erhalten, so daß kaum eine
größere Burg der anderen gleicht, die Ottrotter
Schlösser: Rathsamhausen und Lützelburg oder
Groß-Geroldseck, berühmt durch seine unerbittliche
Belagerung 1471 und 1486, Spesburg, Ortenberg
und Girbaden sind dafür einige Beispiele von vielen.
Die große politische und strategische Bedeutung der
elsässischen Burgen, die bis zum Anfang des 17. Jahrh.
noch ihre Wirksamkeit behielten, führte natürlich auch viel-
fach zu Umbauten weitgehendster Art. Wir finden selbst
den großen deutschen Festungsbaumeister Daniel Specklin
dabei an der Arbeit, der 1569 noch Pläne für die reich-
gestaltete Burg Herrenstein schuf. Als frühestes Bei-
spiel eines Umbaues allergrößten Maßstabes dürfen wir
wiederum nicht die Hohkönigsburg übersehen, die schon
im letzten Viertel des 15. Jahrh. eine strategisch voll-
endete Form für Verteidigung durch Pulvergeschütze er-
hielt.
Besonders reich wird die Ausgestaltung des Gesamt-
grundrisses in der Zeit der Kanonenbollwerke und der
allmählich immer stärker werdenden Basüonen. Die Herren
von Sickingen bauten in die romanische Hohenburg im
Unterelsaß bei Weißenburg noch im 16. Jahrh. ein drei-
viertelrundes Kanonenbollwerk, das heute der stärkste Teil
der Ruine ist. Unvergleichlich vielgestaltiger sind dann
Anlagen wie Lützelstein, die schließlich weitvorgestreckte
Bastionen mit dem uralten Kern vereinigen, der aus der
äußersten Felsspitze sich erhebt, während die Basüonen
sich gegen die breitere Angriffsseite mehr und mehr vor-
schieben.
Die große Burg Landskron, im Kreise Mül-
hausen, die sicher bis in den Anfang des 13. Jahrh. zu-
rückgeht, vereinigt schließlich in ihrem kurzen breiten
Büttelkern früheste Pallasreste mit Batterietürinen des
15. und 16. Jahrh. und mit Um- und Ausbauten des
17. Jahrh. Kein geringerer als Kaiser Maximilian I. ließ
1516 den Kern umbauen und nördlich und südlich ganz
eigentümliche strahlenförmige Wehrmauern Herstellen, die
in späte Basüonen auslaufen. Noch bis in die Neuzeit
hinein, bis zum Jahre 1813 und 1814, bestand sie so als
Festung.
Den Schutz und Schirm, den diese Burgen den:
deutschen Reiche und namentlich dem deutschen Grenz-
land jahrhundertelang gewährten, können wir gar nicht
hoch genug einschätzen. Wir können nicht genug bewun-
dern die Kühnheit der deutschen Baumeister, denen keine
Abb. 4. Felsenburg Hohkönigsburg im Elsaß. Grundriß 1:1000.
B. E. gez.
aber auch auf einem solchen schwierigen Felsabhang wie
bei der Ulrichsburg schrecken die Baumeister nicht davor
zurück, über dem Abgrund einen völlig regelmäßigen
Pallas unter Zuhilfenahme überhoher Stützmauern zu
errichten, dessen köstliche romanische Fensterreihe noch
heute wohlerhalten ist.
Solche unregelmäßigen Grundrisse sind natürlich
unter den Vogesenburgen in größter Zahl und reichster
Abwechselung der Formen erhalten, so daß kaum eine
größere Burg der anderen gleicht, die Ottrotter
Schlösser: Rathsamhausen und Lützelburg oder
Groß-Geroldseck, berühmt durch seine unerbittliche
Belagerung 1471 und 1486, Spesburg, Ortenberg
und Girbaden sind dafür einige Beispiele von vielen.
Die große politische und strategische Bedeutung der
elsässischen Burgen, die bis zum Anfang des 17. Jahrh.
noch ihre Wirksamkeit behielten, führte natürlich auch viel-
fach zu Umbauten weitgehendster Art. Wir finden selbst
den großen deutschen Festungsbaumeister Daniel Specklin
dabei an der Arbeit, der 1569 noch Pläne für die reich-
gestaltete Burg Herrenstein schuf. Als frühestes Bei-
spiel eines Umbaues allergrößten Maßstabes dürfen wir
wiederum nicht die Hohkönigsburg übersehen, die schon
im letzten Viertel des 15. Jahrh. eine strategisch voll-
endete Form für Verteidigung durch Pulvergeschütze er-
hielt.
Besonders reich wird die Ausgestaltung des Gesamt-
grundrisses in der Zeit der Kanonenbollwerke und der
allmählich immer stärker werdenden Basüonen. Die Herren
von Sickingen bauten in die romanische Hohenburg im
Unterelsaß bei Weißenburg noch im 16. Jahrh. ein drei-
viertelrundes Kanonenbollwerk, das heute der stärkste Teil
der Ruine ist. Unvergleichlich vielgestaltiger sind dann
Anlagen wie Lützelstein, die schließlich weitvorgestreckte
Bastionen mit dem uralten Kern vereinigen, der aus der
äußersten Felsspitze sich erhebt, während die Basüonen
sich gegen die breitere Angriffsseite mehr und mehr vor-
schieben.
Die große Burg Landskron, im Kreise Mül-
hausen, die sicher bis in den Anfang des 13. Jahrh. zu-
rückgeht, vereinigt schließlich in ihrem kurzen breiten
Büttelkern früheste Pallasreste mit Batterietürinen des
15. und 16. Jahrh. und mit Um- und Ausbauten des
17. Jahrh. Kein geringerer als Kaiser Maximilian I. ließ
1516 den Kern umbauen und nördlich und südlich ganz
eigentümliche strahlenförmige Wehrmauern Herstellen, die
in späte Basüonen auslaufen. Noch bis in die Neuzeit
hinein, bis zum Jahre 1813 und 1814, bestand sie so als
Festung.
Den Schutz und Schirm, den diese Burgen den:
deutschen Reiche und namentlich dem deutschen Grenz-
land jahrhundertelang gewährten, können wir gar nicht
hoch genug einschätzen. Wir können nicht genug bewun-
dern die Kühnheit der deutschen Baumeister, denen keine
Abb. 4. Felsenburg Hohkönigsburg im Elsaß. Grundriß 1:1000.
B. E. gez.