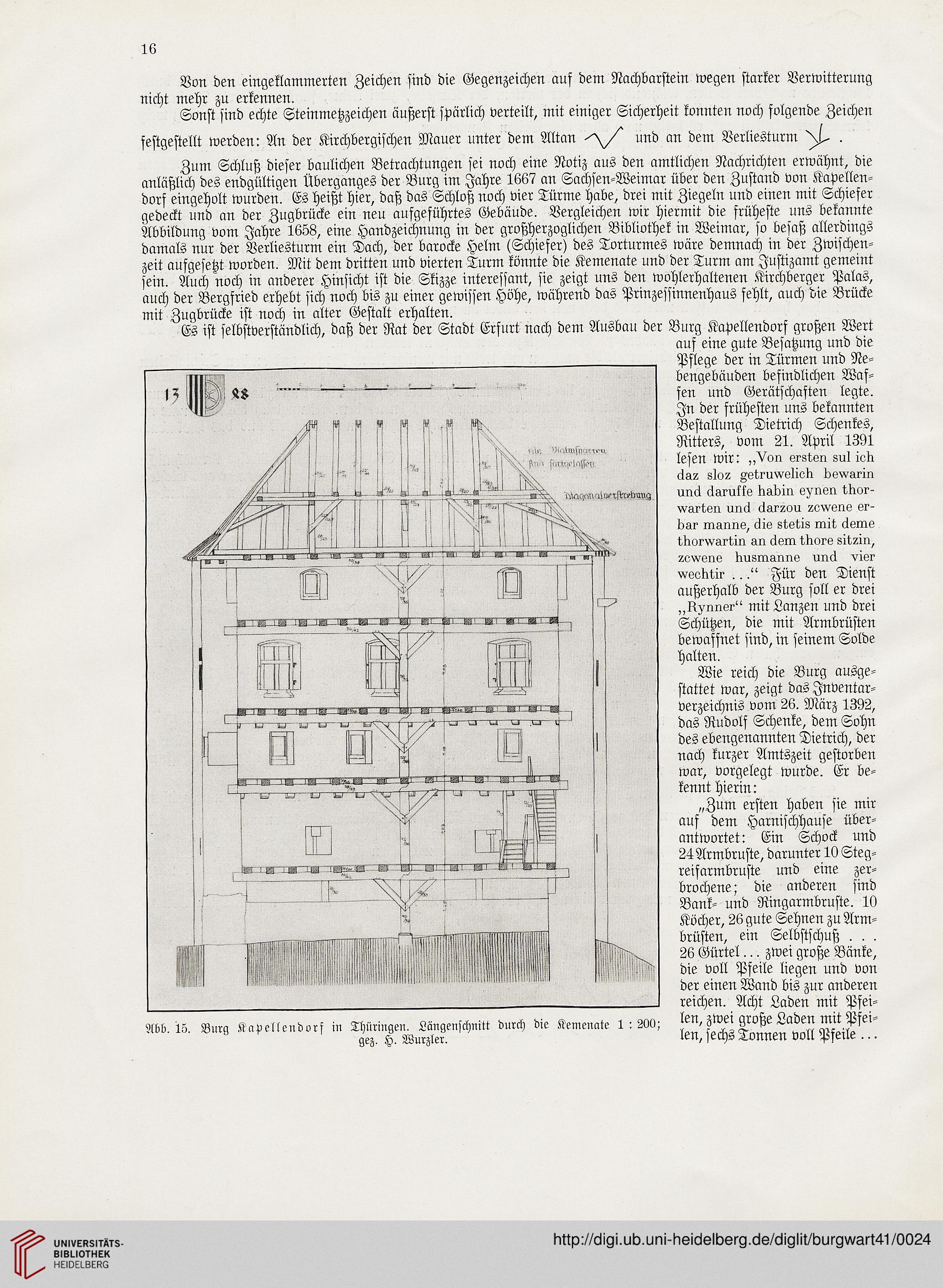16
Von den eingeklammerten Zeichen sind die Gegenzeichen auf dem Nachbarstein wegen starker Verwitterung
nicht mehr zu erkennen.
Sonst sind echte Steinmetzzeichen äußerst spärlich verteilt, mit einiger Sicherheit konnten noch folgende Zeichen
festgestellt werden: An der Kirchbergischen Mauer unter dem Altan und an dem Verliesturm .
Zum Schluß dieser baulichen Betrachtungen sei noch eine Notiz aus den amtlichen Nachrichten erwähnt, die
anläßlich des endgültigen Überganges der Burg im Jahre 1667 an Sachsen-Weimar über den Zustand von Kapellen-
dorf eingeholt wurden. Es heißt hier, daß das Schloß noch vier Türme habe, drei mit Ziegeln und einen mit Schiefer
gedeckt und an der Zugbrücke ein neu aufgeführtes Gebäude. Vergleichen wir hiermit die früheste uns bekannte
Abbildung vom Jahre 1658, eine Handzeichnung in der großherzoglichen Bibliothek in Weimar, so besaß allerdings
damals nur der Verliesturm ein Dach, der barocke Helm (Schiefer) des Torturmes wäre demnach in der Zwischen-
zeit aufgesetzt worden. Mit dem dritten und vierten Turm könnte die Kemenate und der Turm am Justizamt gemeint
sein. Auch noch in anderer Hinsicht ist die Skizze interessant, sie zeigt uns den wohlerhaltenen Kirchberger Palas,
auch der Bergfried erhebt sich noch bis zu einer gewissen Höhe, während das Prinzessinnenhaus fehlt, auch die Brücke
mit Zugbrücke ist noch in alter Gestalt erhalten.
Es ist selbstverständlich, daß der Rat der Stadt Erfurt nach dein Ausball der Burg Kapellendorf großen Wert
auf eine gute Besatzung und die
Pflege der in Türmen und Ne-
bengebäuden befindlichen Waf-
fen und Gerätschaften legte.
In der frühesten uns bekannten
Bestallung Dietrich Schenkes,
Ritters, von: 21. April 1391
lesen wir: „Von ersten sul ieü
dar: slor Mtruvvelioü dewnrin
uncl clarnkke Imkin ezmen tbor-
vvartsn nncl dar^ou Mvvene er-
bar rnanne, clie stetis init deine
tüorvvsrtin an dein tüore sitrin,
Mvvsns Inislnanne und vier
vveoktir ..." Für den Dienst
außerhalb der Burg soll er drei
„Kenner" mit Lanzen und drei
Schützen, die mit Armbrüsten
bewaffnet sind, in seinem Solde
halten.
Wie reich die Burg ausge-
stattet war, zeigt das Inventar-
verzeichnis vom 26. März 1392,
das Rudolf Schenke, dem Sohn
des ebengenannten Dietrich, der
nach kurzer Amtszeit gestorben
war, vorgelegt wurde. Er be-
kennt hierin:
„Zum ersten haben sie mir
auf dem Harnischhause über-
antwortet: Ein Schock und
24 Armbruste, darunter 10 Steg-
reifarmbruste und eine zer-
brochene; die anderen sind
Bank- und Ringarmbruste. 10
Köcher, 26 gute Sehnen zu Arm-
brüsten, ein Selbstschuß . . .
26 Gürtel... zwei große Bänke,
die voll Pfeile liegen und von
der einen Wand bis zur anderen
reichen. Acht Laden mit Pfei-
Abb. 15. Burg Kapellendorf in Thüringen. Längenschnitt durch die Kemenate 1:200; len, zwei große Laden mit Pfei-
gez. H. Wurzler. len, sechs Tonnen voll Pfeile ...
Von den eingeklammerten Zeichen sind die Gegenzeichen auf dem Nachbarstein wegen starker Verwitterung
nicht mehr zu erkennen.
Sonst sind echte Steinmetzzeichen äußerst spärlich verteilt, mit einiger Sicherheit konnten noch folgende Zeichen
festgestellt werden: An der Kirchbergischen Mauer unter dem Altan und an dem Verliesturm .
Zum Schluß dieser baulichen Betrachtungen sei noch eine Notiz aus den amtlichen Nachrichten erwähnt, die
anläßlich des endgültigen Überganges der Burg im Jahre 1667 an Sachsen-Weimar über den Zustand von Kapellen-
dorf eingeholt wurden. Es heißt hier, daß das Schloß noch vier Türme habe, drei mit Ziegeln und einen mit Schiefer
gedeckt und an der Zugbrücke ein neu aufgeführtes Gebäude. Vergleichen wir hiermit die früheste uns bekannte
Abbildung vom Jahre 1658, eine Handzeichnung in der großherzoglichen Bibliothek in Weimar, so besaß allerdings
damals nur der Verliesturm ein Dach, der barocke Helm (Schiefer) des Torturmes wäre demnach in der Zwischen-
zeit aufgesetzt worden. Mit dem dritten und vierten Turm könnte die Kemenate und der Turm am Justizamt gemeint
sein. Auch noch in anderer Hinsicht ist die Skizze interessant, sie zeigt uns den wohlerhaltenen Kirchberger Palas,
auch der Bergfried erhebt sich noch bis zu einer gewissen Höhe, während das Prinzessinnenhaus fehlt, auch die Brücke
mit Zugbrücke ist noch in alter Gestalt erhalten.
Es ist selbstverständlich, daß der Rat der Stadt Erfurt nach dein Ausball der Burg Kapellendorf großen Wert
auf eine gute Besatzung und die
Pflege der in Türmen und Ne-
bengebäuden befindlichen Waf-
fen und Gerätschaften legte.
In der frühesten uns bekannten
Bestallung Dietrich Schenkes,
Ritters, von: 21. April 1391
lesen wir: „Von ersten sul ieü
dar: slor Mtruvvelioü dewnrin
uncl clarnkke Imkin ezmen tbor-
vvartsn nncl dar^ou Mvvene er-
bar rnanne, clie stetis init deine
tüorvvsrtin an dein tüore sitrin,
Mvvsns Inislnanne und vier
vveoktir ..." Für den Dienst
außerhalb der Burg soll er drei
„Kenner" mit Lanzen und drei
Schützen, die mit Armbrüsten
bewaffnet sind, in seinem Solde
halten.
Wie reich die Burg ausge-
stattet war, zeigt das Inventar-
verzeichnis vom 26. März 1392,
das Rudolf Schenke, dem Sohn
des ebengenannten Dietrich, der
nach kurzer Amtszeit gestorben
war, vorgelegt wurde. Er be-
kennt hierin:
„Zum ersten haben sie mir
auf dem Harnischhause über-
antwortet: Ein Schock und
24 Armbruste, darunter 10 Steg-
reifarmbruste und eine zer-
brochene; die anderen sind
Bank- und Ringarmbruste. 10
Köcher, 26 gute Sehnen zu Arm-
brüsten, ein Selbstschuß . . .
26 Gürtel... zwei große Bänke,
die voll Pfeile liegen und von
der einen Wand bis zur anderen
reichen. Acht Laden mit Pfei-
Abb. 15. Burg Kapellendorf in Thüringen. Längenschnitt durch die Kemenate 1:200; len, zwei große Laden mit Pfei-
gez. H. Wurzler. len, sechs Tonnen voll Pfeile ...