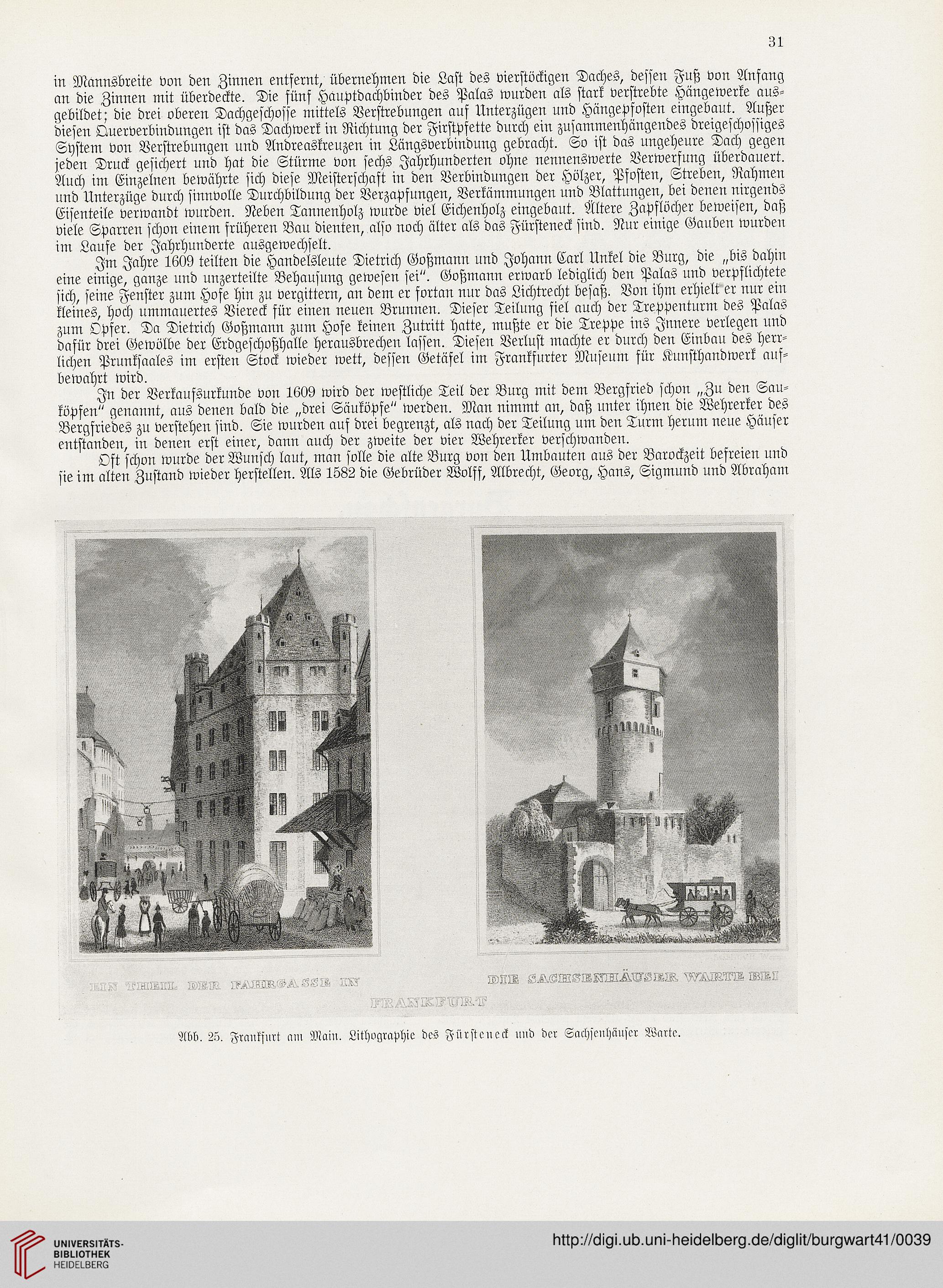in Mannsbreite von den Zinnen entfernt, übernehmen die Last des vierstöckigen Daches, dessen Fuß von Anfang
an die Zinnen mit überdeckte. Die fünf Hauptdachbinder des Palas wurden als stark verstrebte Hängewerke aus-
gebildet; die drei oberen Dachgeschosse mittels Verstrebungen auf Unterzügen und Hängepfosten eingebaut. Außer
diesen Querverbindungen ist das Dachwerk in Richtung der Firstpfette durch ein zusammenhängendes dreigeschossiges
System von Verstrebungen und Andreaskreuzen in Längsverbindung gebracht. So ist das ungeheure Dach gegen
jeden Druck gesichert und hat die Stürme von sechs Jahrhunderten ohne nennenswerte Verwerfung überdauert.
Auch im Einzelnen bewährte sich diese Meisterschaft in den Verbindungen der Hölzer, Pfosten, Streben, Rahmen
und Unterzüge durch sinnvolle Durchbildung der Verzapfungen, Verkämmungen und Blattungen, bei denen nirgends
Eisenteile verwandt wurden. Neben Tannenholz wurde viel Eichenholz eingebaut. Ältere Zapflöcher beweisen, daß
viele Sparren schon einem früheren Bau dienten, also noch älter als das Fürsteneck sind. Nur einige Gauben wurden
im Laufe der Jahrhunderte ausgewechselt.
Im Jahre 1609 teilten die Handelsleute Dietrich Goßmann und Johann Carl Unkel die Burg, die „bis dahin
eine einige, ganze und unzerteilte Behausung gewesen sei". Goßmann erwarb lediglich den Palas und verpflichtete
sich, seine Fenster zum Hofe hin zu vergittern, an dem er fortan nur das Lichtrecht besaß. Bon ihm erhielt er nur ein
kleines, hoch ummauertes Viereck für einen neuen Brunnen. Dieser Teilung fiel auch der Treppenturm des Palas
zum Opfer. Da Dietrich Goßmann zum Hofe keinen Zutritt hatte, mußte er die Treppe ins Innere verlegen und
dafür drei Gewölbe der Erdgeschoßhalle Herausbrechen lassen. Diesen Verlust machte er durch den Einbau des herr-
lichen Prunksaales im ersten Stock wieder wett, dessen Getäfel im Frankfurter Museum für Kunsthandwerk auf-
bewahrt wird.
In der Berkaufsurkunde von 1609 wird der westliche Teil der Burg mit dem Bergfried schon „Zu den Sau-
köpfen" genannt, aus denen bald die „drei Säuköpfe" werden. Man nimmt an, daß unter ihnen die Wehrerker des
Bergfriedes zu verstehen sind. Sie wurden auf drei begrenzt, als nach der Teilung um den Turm herum neue Häuser
entstanden, in denen erst einer, dann auch der zweite der vier Wehrerker verschwanden.
Oft schon wurde der Wunsch laut, man solle die alte Burg von den Umbauten aus der Barockzeit befreien und
sie im alten Zustand wieder Herstellen. Als 1582 die Gebrüder Wolfs, Albrecht, Georg, Hans, Sigmund und Abraham
Mb. 25. Frankfurt am Main. Lithographie des Fürsten eck und der Sachsenhäuser Warte.
an die Zinnen mit überdeckte. Die fünf Hauptdachbinder des Palas wurden als stark verstrebte Hängewerke aus-
gebildet; die drei oberen Dachgeschosse mittels Verstrebungen auf Unterzügen und Hängepfosten eingebaut. Außer
diesen Querverbindungen ist das Dachwerk in Richtung der Firstpfette durch ein zusammenhängendes dreigeschossiges
System von Verstrebungen und Andreaskreuzen in Längsverbindung gebracht. So ist das ungeheure Dach gegen
jeden Druck gesichert und hat die Stürme von sechs Jahrhunderten ohne nennenswerte Verwerfung überdauert.
Auch im Einzelnen bewährte sich diese Meisterschaft in den Verbindungen der Hölzer, Pfosten, Streben, Rahmen
und Unterzüge durch sinnvolle Durchbildung der Verzapfungen, Verkämmungen und Blattungen, bei denen nirgends
Eisenteile verwandt wurden. Neben Tannenholz wurde viel Eichenholz eingebaut. Ältere Zapflöcher beweisen, daß
viele Sparren schon einem früheren Bau dienten, also noch älter als das Fürsteneck sind. Nur einige Gauben wurden
im Laufe der Jahrhunderte ausgewechselt.
Im Jahre 1609 teilten die Handelsleute Dietrich Goßmann und Johann Carl Unkel die Burg, die „bis dahin
eine einige, ganze und unzerteilte Behausung gewesen sei". Goßmann erwarb lediglich den Palas und verpflichtete
sich, seine Fenster zum Hofe hin zu vergittern, an dem er fortan nur das Lichtrecht besaß. Bon ihm erhielt er nur ein
kleines, hoch ummauertes Viereck für einen neuen Brunnen. Dieser Teilung fiel auch der Treppenturm des Palas
zum Opfer. Da Dietrich Goßmann zum Hofe keinen Zutritt hatte, mußte er die Treppe ins Innere verlegen und
dafür drei Gewölbe der Erdgeschoßhalle Herausbrechen lassen. Diesen Verlust machte er durch den Einbau des herr-
lichen Prunksaales im ersten Stock wieder wett, dessen Getäfel im Frankfurter Museum für Kunsthandwerk auf-
bewahrt wird.
In der Berkaufsurkunde von 1609 wird der westliche Teil der Burg mit dem Bergfried schon „Zu den Sau-
köpfen" genannt, aus denen bald die „drei Säuköpfe" werden. Man nimmt an, daß unter ihnen die Wehrerker des
Bergfriedes zu verstehen sind. Sie wurden auf drei begrenzt, als nach der Teilung um den Turm herum neue Häuser
entstanden, in denen erst einer, dann auch der zweite der vier Wehrerker verschwanden.
Oft schon wurde der Wunsch laut, man solle die alte Burg von den Umbauten aus der Barockzeit befreien und
sie im alten Zustand wieder Herstellen. Als 1582 die Gebrüder Wolfs, Albrecht, Georg, Hans, Sigmund und Abraham
Mb. 25. Frankfurt am Main. Lithographie des Fürsten eck und der Sachsenhäuser Warte.