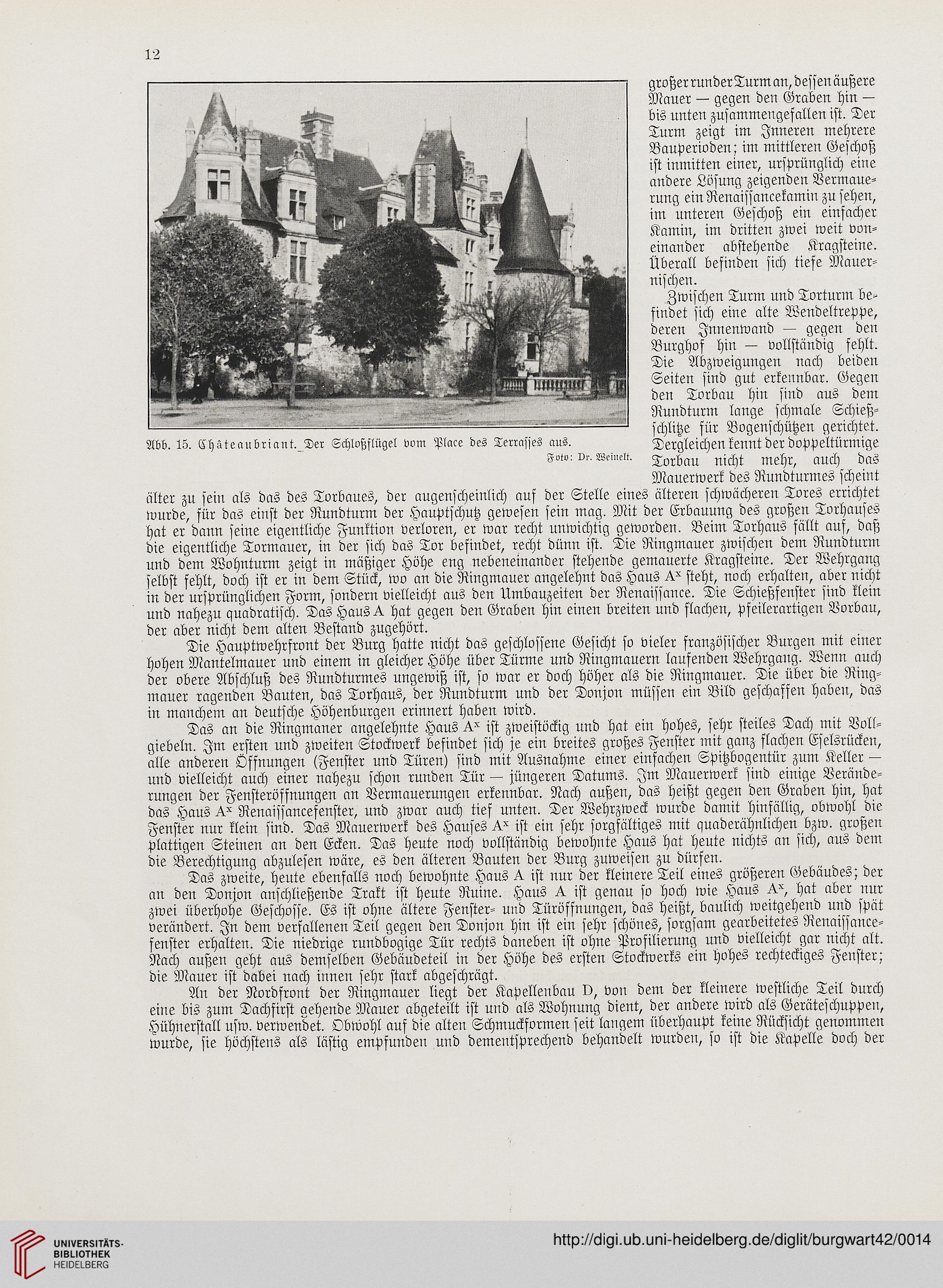großer runder Turm an, dessen äußere
Mauer — gegen den Graben hin —
bis unten zusammengefallen ist. Der
Turm zeigt im Inneren mehrere
Bauperioden; im mittleren Geschoß
ist inmitten einer, ursprünglich eine
andere Lösung zeigenden Vermaue-
rung ein Renaissancekamin zu sehen,
im unteren Geschoß ein einfacher
Kamin, im dritten zwei weit von-
einander abstehende Kragsteine.
Überall befinden sich tiefe Mauer-
nischen.
Zwischen Turm und Torturm be-
findet sich eine alte Wendeltreppe,
deren Innenwand — gegen den
Burghof hin — vollständig fehlt.
Die Abzweigungen nach beiden
Seiten sind gut erkennbar. Gegen
den Torbau hin sind aus dem
Rundturm lange schmale Schieß-
schlitze für Bogenschützen gerichtet.
Abb. 15. Chäteaubriant. Der Schloßflügel vom Place des Terrasjes aus. Dergleichen kennt der doppeltürmige
Foto: Ni. Wcmeit. Torlnm nicht mehr, auch das
Mauerwerk des Rundturmes scheint
älter zu sein als das des Torbaues, der augenscheinlich auf der Stelle eines älteren schwächeren Tores errichtet
wurde, für das einst der Rundturm der Hauptschutz gewesen sein mag. Mit der Erbauung des großen Torhauses
hat er dann seine eigentliche Funktion verloren, er war recht unwichtig geworden. Beim Torhaus fällt auf, daß
die eigentliche Tormauer, in der sich das Tor befindet, recht dünn ist. Die Ringmauer zwischen dem Rundturm
und dem Wohnturm zeigt in mäßiger Höhe eng nebeneinander stehende gemauerte Kragsteine. Der Wehrgang
selbst fehlt, doch ist er in dem Stück, wo an die Ringmauer angelehnt das Haus ^ steht, noch erhalten, aber nicht
in der ursprünglichen Form, sondern vielleicht aus den Umbauzeiten der Renaissance. Die Schießfenster sind klein
und nahezu quadratisch. Das Hallst hat gegen den Graben hin einen breiten und flachen, Pfeilerartigen Vorbau,
der aber nicht dem alten Bestand zugehört.
Die Hauptwehrfront der Burg hatte nicht das geschlossene Gesicht so vieler französischer Burgen mit einer
hohen Mantelmauer und einen: in gleicher Höhe über Türme und Ringmauern lausenden Wehrgang. Wenn auch
der obere Abschluß des Rundturmes ungewiß ist, so war er doch höher als die Ringmauer. Die über die Ring-
mauer ragenden Bauten, das Torhaus, der Rundturm und der Donjon müssen ein Bild geschaffen haben, das
in manchem an deutsche Höhenburgen erinnert haben wird.
Das an die Ringmauer angelehnte Haus ^ ist zweistöckig und hat ein hohes, sehr steiles Dach mit Voll-
giebeln. Im ersten und zweiten Stockwerk befindet sich je ein breites großes Fenster mit ganz flachen Eselsrücken,
alle anderen Öffnungen (Fenster und Türen) sind mit Ausnahme einer einfachen Spitzbogentür zum Keller —
und vielleicht auch einer nahezu schon runden Tür — jüngeren Datums. Im Mauerwerk sind einige Verände-
rungen der Fensteröffnungen an Vermauerungen erkennbar. Nach außen, das heißt gegen den Graben hin, hat
das Haus ^ Renaissancefenster, und zwar auch tief unten. Der Wehrzweck wurde damit hinfällig, obwohl die
Fenster nur klein sind. Das Mauerwerk des Hauses ^ ist ein sehr sorgfältiges mit quaderähnlichen bzw. großen
plattigen Steinen an den Ecken. Das heute noch vollständig bewohnte Haus hat heute nichts an sich, aus dem
die Berechtigung abzulesen wäre, es den älteren Bauten der Burg zuweisen zu dürfen.
Das zweite, heute ebenfalls noch bewohnte Haus ^ ist nur der kleinere Teil eines größeren Gebäudes; der
an den Donjon anschließende Trakt ist heute Ruine. Haus ^ ist genau so hoch wie Haus hat aber nur
zwei überhohe Geschosse. Es ist ohne ältere Fenster- und Türöffnungen, das heißt, baulich weitgehend und spät
verändert. In dem verfallenen Teil gegen den Donjon hin ist ein sehr schönes, sorgsam gearbeitetes Renaissance-
fenster erhalten. Die niedrige rundbogige Tür rechts daneben ist ohne Profilierung und vielleicht gar nicht alt.
Nach außen geht aus demselben Gebäudeteil in der Höhe des ersten Stockwerks ein hohes rechteckiges Fenster;
die Mauer ist dabei nach innen sehr stark abgeschrägt.
An der Nordfront der Ringmauer liegt der Kapellenbau v, von dem der kleinere westliche Teil durch
eine bis zum Dachfirst gehende Mauer abgeteilt ist und als Wohnung dient, der andere wird als Geräteschuppen,
Hühnerstall usw. verwendet. Obwohl auf die alten Schmuckformen seit langem überhaupt keine Rücksicht genommen
wurde, sie höchstens als lästig empfunden und dementsprechend behandelt wurden, so ist die Kapelle doch der
Mauer — gegen den Graben hin —
bis unten zusammengefallen ist. Der
Turm zeigt im Inneren mehrere
Bauperioden; im mittleren Geschoß
ist inmitten einer, ursprünglich eine
andere Lösung zeigenden Vermaue-
rung ein Renaissancekamin zu sehen,
im unteren Geschoß ein einfacher
Kamin, im dritten zwei weit von-
einander abstehende Kragsteine.
Überall befinden sich tiefe Mauer-
nischen.
Zwischen Turm und Torturm be-
findet sich eine alte Wendeltreppe,
deren Innenwand — gegen den
Burghof hin — vollständig fehlt.
Die Abzweigungen nach beiden
Seiten sind gut erkennbar. Gegen
den Torbau hin sind aus dem
Rundturm lange schmale Schieß-
schlitze für Bogenschützen gerichtet.
Abb. 15. Chäteaubriant. Der Schloßflügel vom Place des Terrasjes aus. Dergleichen kennt der doppeltürmige
Foto: Ni. Wcmeit. Torlnm nicht mehr, auch das
Mauerwerk des Rundturmes scheint
älter zu sein als das des Torbaues, der augenscheinlich auf der Stelle eines älteren schwächeren Tores errichtet
wurde, für das einst der Rundturm der Hauptschutz gewesen sein mag. Mit der Erbauung des großen Torhauses
hat er dann seine eigentliche Funktion verloren, er war recht unwichtig geworden. Beim Torhaus fällt auf, daß
die eigentliche Tormauer, in der sich das Tor befindet, recht dünn ist. Die Ringmauer zwischen dem Rundturm
und dem Wohnturm zeigt in mäßiger Höhe eng nebeneinander stehende gemauerte Kragsteine. Der Wehrgang
selbst fehlt, doch ist er in dem Stück, wo an die Ringmauer angelehnt das Haus ^ steht, noch erhalten, aber nicht
in der ursprünglichen Form, sondern vielleicht aus den Umbauzeiten der Renaissance. Die Schießfenster sind klein
und nahezu quadratisch. Das Hallst hat gegen den Graben hin einen breiten und flachen, Pfeilerartigen Vorbau,
der aber nicht dem alten Bestand zugehört.
Die Hauptwehrfront der Burg hatte nicht das geschlossene Gesicht so vieler französischer Burgen mit einer
hohen Mantelmauer und einen: in gleicher Höhe über Türme und Ringmauern lausenden Wehrgang. Wenn auch
der obere Abschluß des Rundturmes ungewiß ist, so war er doch höher als die Ringmauer. Die über die Ring-
mauer ragenden Bauten, das Torhaus, der Rundturm und der Donjon müssen ein Bild geschaffen haben, das
in manchem an deutsche Höhenburgen erinnert haben wird.
Das an die Ringmauer angelehnte Haus ^ ist zweistöckig und hat ein hohes, sehr steiles Dach mit Voll-
giebeln. Im ersten und zweiten Stockwerk befindet sich je ein breites großes Fenster mit ganz flachen Eselsrücken,
alle anderen Öffnungen (Fenster und Türen) sind mit Ausnahme einer einfachen Spitzbogentür zum Keller —
und vielleicht auch einer nahezu schon runden Tür — jüngeren Datums. Im Mauerwerk sind einige Verände-
rungen der Fensteröffnungen an Vermauerungen erkennbar. Nach außen, das heißt gegen den Graben hin, hat
das Haus ^ Renaissancefenster, und zwar auch tief unten. Der Wehrzweck wurde damit hinfällig, obwohl die
Fenster nur klein sind. Das Mauerwerk des Hauses ^ ist ein sehr sorgfältiges mit quaderähnlichen bzw. großen
plattigen Steinen an den Ecken. Das heute noch vollständig bewohnte Haus hat heute nichts an sich, aus dem
die Berechtigung abzulesen wäre, es den älteren Bauten der Burg zuweisen zu dürfen.
Das zweite, heute ebenfalls noch bewohnte Haus ^ ist nur der kleinere Teil eines größeren Gebäudes; der
an den Donjon anschließende Trakt ist heute Ruine. Haus ^ ist genau so hoch wie Haus hat aber nur
zwei überhohe Geschosse. Es ist ohne ältere Fenster- und Türöffnungen, das heißt, baulich weitgehend und spät
verändert. In dem verfallenen Teil gegen den Donjon hin ist ein sehr schönes, sorgsam gearbeitetes Renaissance-
fenster erhalten. Die niedrige rundbogige Tür rechts daneben ist ohne Profilierung und vielleicht gar nicht alt.
Nach außen geht aus demselben Gebäudeteil in der Höhe des ersten Stockwerks ein hohes rechteckiges Fenster;
die Mauer ist dabei nach innen sehr stark abgeschrägt.
An der Nordfront der Ringmauer liegt der Kapellenbau v, von dem der kleinere westliche Teil durch
eine bis zum Dachfirst gehende Mauer abgeteilt ist und als Wohnung dient, der andere wird als Geräteschuppen,
Hühnerstall usw. verwendet. Obwohl auf die alten Schmuckformen seit langem überhaupt keine Rücksicht genommen
wurde, sie höchstens als lästig empfunden und dementsprechend behandelt wurden, so ist die Kapelle doch der