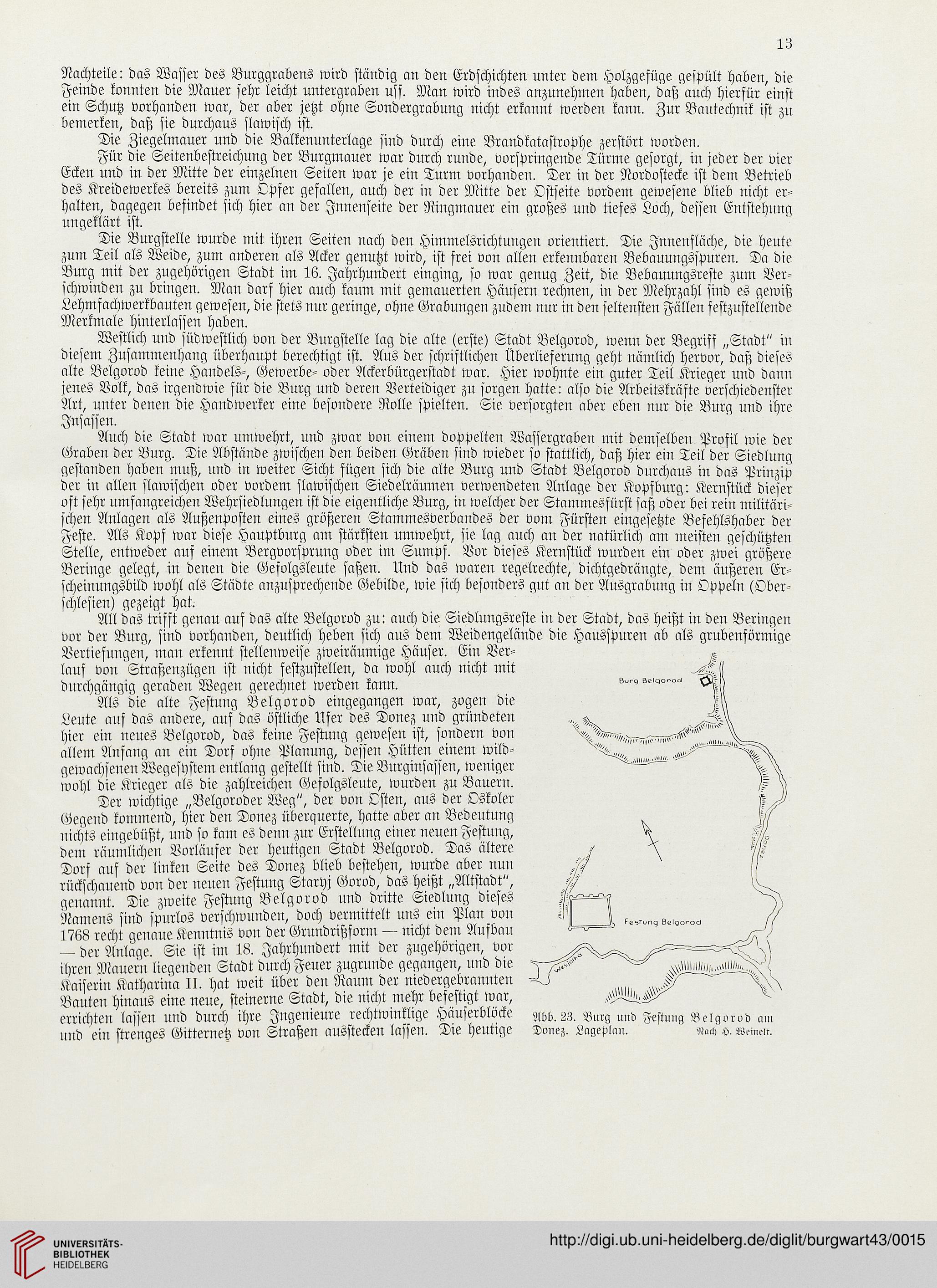13
Nachteile: das Wasser des Burggrabens wird ständig an den Erdschichten unter dem Holzgefüge gespült haben, die
Feinde konnten die Mauer sehr leicht untergraben usf. Man wird indes anzunehmen haben, daß auch hierfür einst
ein Schutz vorhanden war, der aber jetzt ohne Sondergrabung nicht erkannt werden kann. Zur Bauteckmik ist zu
bemerken, daß sie durchaus slawisch ist.
Die Ziegelmauer und die Balkenunterlage sind durch eine Brandkatastrophe zerstört worden.
Für die Seitenbestreichung der Burgmauer war durch runde, vorspringende Türme gesorgt, in jeder der vier
Ecken und in der Mitte der einzelnen Seiten war je ein Turm vorhanden. Der in der Nordostecke ist dem Betrieb
des Kreidewerkes bereits zum Opfer gefallen, auch der in der Mitte der Ostseite vordem gewesene blieb nicht er-
halten, dagegen befindet sich hier an der Innenseite der Ringmauer ein großes und tiefes Loch, dessen Entstehuna
ungeklärt ist.
Die Burgstelle wurde mit ihren Seiten nach den Himmelsrichtungen orientiert. Die Innenfläche, die heute
zum Teil als Weide, zum anderen als Acker genutzt wird, ist frei von allen erkennbaren Bebauungsspuren. Da die
Burg mit der zugehörigen Stadt im 16. Jahrhundert einging, so war genug Zeit, die Bebauungsreste zum Ver-
schwinden zu bringen. Man darf hier auch kaum mit gemauerten Häusern rechnen, in der Mehrzahl sind es gewiß
Lehmfachwerkbauten gewesen, die stets nur geringe, ohne Grabungen zudem nur in den seltensten Fällen festzustellende
Merkmale hinterlassen haben.
Westlich und südwestlich von der Burgstelle lag die alte (erste) Stadt Belgorod, wenn der Begriff „Stadt" in
diesen: Zusammenhang überhaupt berechtigt ist. Aus der schriftlichen Überlieferung geht nämlich hervor, daß dieses
alte Belgorod keine Handels-, Gewerbe- oder Ackerbürgerstadt war. Hier wohnte ein guter Teil Krieger und dann
jenes Volk, das irgendwie für die Burg und deren Verteidiger zu sorgen hatte: also die Arbeitskräfte verschiedenster
Art, unter denen die Handwerker eine besondere Rolle spielten. Sie versorgten aber eben nur die Burg und ihre
Insassen.
Auch die Stadt war umwehrt, und zwar von einem doppelten Wassergraben mit demselben Profil wie der
Graben der Burg. Die Abstände zwischen den beiden Gräben sind wieder so stattlich, daß hier ein Teil der Siedlung
gestanden haben muß, und in weiter Sicht fügen sich die alte Burg und Stadt Belgorod durchaus in das Prinzip
der in allen slawischen oder vordem slawischen Siedelräumen verwendeten Anlage der Kopfburg: Kernstück dieser
oft sehr umfangreichen Wehrsiedlungeu ist die eigentliche Burg, in welcher der Stammesfürst saß oder bei rein militäri-
schen Anlagen als Außenposten eines größeren Stammesverbandes der von: Fürsten eingesetzte Befehlshaber der
Feste. Als Kopf war diese Hauptburg am stärksten umwehrt, sie lag auch an der natürlich am meisten geschützten
Stelle, entweder auf einem Bergvorsprung oder im Sumpf. Vor dieses Kernstück wurden ein oder zwei größere
Beringe gelegt, in denen die Gefolgsleute saßen. Und das waren regelrechte, dichtgedrängte, dem äußeren Er-
scheinungsbild wohl als Städte anzusprechende Gebilde, wie sich besonders gut au der Ausgrabung in Oppeln (Ober-
schlesien) gezeigt hat.
All das trifft genau auf das alte Belgorod zu: auch die Siedlungsreste in der Stadt, das heißt in den Beringen
vor der Burg, sind vorhanden, deutlich heben sich aus dem Weidengelände die Hausspuren ab als grubenförmige
Vertiefungen, man erkennt stellenweise zweiräumige Häuser. Ein Ver-
lauf von Straßenzügen ist nicht festzustellen, da wohl auch nicht mit
durchgängig geraden Wegen gerechnet werden kann.
Als die alte Festung Belgorod eingegangen war, zogen die
Leute auf das andere, auf das östliche Ufer des Donez und gründeten
hier ein neues Belgorod, das keine Festung gewesen ist, sondern von
allem Anfang an ein Dorf ohne Planung, dessen Hütten einem wild-
gewachsenen Wegesystem entlang gestellt sind. Die Burginsassen, weniger
wohl die Krieger als die zahlreichen Gefolgsleute, wurden zu Bauern.
Der wichtige „Belgoroder Weg", der von Osten, aus der Oskoler
Gegend kommend, hier den Donez überquerte, hatte aber an Bedeutung
nichts eingebüßt, und so kam es denn zur Erstellung einer neuen Festung,
dem räumlichen Vorläufer der heutigen Stadt Belgorod. Das ältere
Dorf auf der linken Seite des Donez blieb bestehen, wurde aber nun
rückschauend von der neuen Festung Staryj Gorod, das heißt „Altstadt ,
genannt. Die zweite Festung Belgorod und dritte Siedlung dieses
Namens sind spurlos verschwunden, doch vermittelt uns ein Plan von
1768 recht genaue Kenntnis von der Grundrißform — nicht dem Aufbai:
— der Anlage. Sie ist im 18. Jahrhundert mit der zugehörigen, vor
ihren Mauern liegenden Stadt durch Feuer zugrunde gegangen, und die
Kaiserin Katharina II. hat weit über den Raun: der niedergebrannten
Bauten hinaus eine neue, steinerne Stadt, die nicht mehr befestigt war,
errichten lassen und durch ihre Ingenieure rechtwinklige Häuserblöcke
und ein strenges Gitternetz von Straßen ausstecken lassen. Die heutige
Aüb. 2.3. Burg und Festung Belgorod uni
Donez. Lageplan. «ans H. Weinen.
Nachteile: das Wasser des Burggrabens wird ständig an den Erdschichten unter dem Holzgefüge gespült haben, die
Feinde konnten die Mauer sehr leicht untergraben usf. Man wird indes anzunehmen haben, daß auch hierfür einst
ein Schutz vorhanden war, der aber jetzt ohne Sondergrabung nicht erkannt werden kann. Zur Bauteckmik ist zu
bemerken, daß sie durchaus slawisch ist.
Die Ziegelmauer und die Balkenunterlage sind durch eine Brandkatastrophe zerstört worden.
Für die Seitenbestreichung der Burgmauer war durch runde, vorspringende Türme gesorgt, in jeder der vier
Ecken und in der Mitte der einzelnen Seiten war je ein Turm vorhanden. Der in der Nordostecke ist dem Betrieb
des Kreidewerkes bereits zum Opfer gefallen, auch der in der Mitte der Ostseite vordem gewesene blieb nicht er-
halten, dagegen befindet sich hier an der Innenseite der Ringmauer ein großes und tiefes Loch, dessen Entstehuna
ungeklärt ist.
Die Burgstelle wurde mit ihren Seiten nach den Himmelsrichtungen orientiert. Die Innenfläche, die heute
zum Teil als Weide, zum anderen als Acker genutzt wird, ist frei von allen erkennbaren Bebauungsspuren. Da die
Burg mit der zugehörigen Stadt im 16. Jahrhundert einging, so war genug Zeit, die Bebauungsreste zum Ver-
schwinden zu bringen. Man darf hier auch kaum mit gemauerten Häusern rechnen, in der Mehrzahl sind es gewiß
Lehmfachwerkbauten gewesen, die stets nur geringe, ohne Grabungen zudem nur in den seltensten Fällen festzustellende
Merkmale hinterlassen haben.
Westlich und südwestlich von der Burgstelle lag die alte (erste) Stadt Belgorod, wenn der Begriff „Stadt" in
diesen: Zusammenhang überhaupt berechtigt ist. Aus der schriftlichen Überlieferung geht nämlich hervor, daß dieses
alte Belgorod keine Handels-, Gewerbe- oder Ackerbürgerstadt war. Hier wohnte ein guter Teil Krieger und dann
jenes Volk, das irgendwie für die Burg und deren Verteidiger zu sorgen hatte: also die Arbeitskräfte verschiedenster
Art, unter denen die Handwerker eine besondere Rolle spielten. Sie versorgten aber eben nur die Burg und ihre
Insassen.
Auch die Stadt war umwehrt, und zwar von einem doppelten Wassergraben mit demselben Profil wie der
Graben der Burg. Die Abstände zwischen den beiden Gräben sind wieder so stattlich, daß hier ein Teil der Siedlung
gestanden haben muß, und in weiter Sicht fügen sich die alte Burg und Stadt Belgorod durchaus in das Prinzip
der in allen slawischen oder vordem slawischen Siedelräumen verwendeten Anlage der Kopfburg: Kernstück dieser
oft sehr umfangreichen Wehrsiedlungeu ist die eigentliche Burg, in welcher der Stammesfürst saß oder bei rein militäri-
schen Anlagen als Außenposten eines größeren Stammesverbandes der von: Fürsten eingesetzte Befehlshaber der
Feste. Als Kopf war diese Hauptburg am stärksten umwehrt, sie lag auch an der natürlich am meisten geschützten
Stelle, entweder auf einem Bergvorsprung oder im Sumpf. Vor dieses Kernstück wurden ein oder zwei größere
Beringe gelegt, in denen die Gefolgsleute saßen. Und das waren regelrechte, dichtgedrängte, dem äußeren Er-
scheinungsbild wohl als Städte anzusprechende Gebilde, wie sich besonders gut au der Ausgrabung in Oppeln (Ober-
schlesien) gezeigt hat.
All das trifft genau auf das alte Belgorod zu: auch die Siedlungsreste in der Stadt, das heißt in den Beringen
vor der Burg, sind vorhanden, deutlich heben sich aus dem Weidengelände die Hausspuren ab als grubenförmige
Vertiefungen, man erkennt stellenweise zweiräumige Häuser. Ein Ver-
lauf von Straßenzügen ist nicht festzustellen, da wohl auch nicht mit
durchgängig geraden Wegen gerechnet werden kann.
Als die alte Festung Belgorod eingegangen war, zogen die
Leute auf das andere, auf das östliche Ufer des Donez und gründeten
hier ein neues Belgorod, das keine Festung gewesen ist, sondern von
allem Anfang an ein Dorf ohne Planung, dessen Hütten einem wild-
gewachsenen Wegesystem entlang gestellt sind. Die Burginsassen, weniger
wohl die Krieger als die zahlreichen Gefolgsleute, wurden zu Bauern.
Der wichtige „Belgoroder Weg", der von Osten, aus der Oskoler
Gegend kommend, hier den Donez überquerte, hatte aber an Bedeutung
nichts eingebüßt, und so kam es denn zur Erstellung einer neuen Festung,
dem räumlichen Vorläufer der heutigen Stadt Belgorod. Das ältere
Dorf auf der linken Seite des Donez blieb bestehen, wurde aber nun
rückschauend von der neuen Festung Staryj Gorod, das heißt „Altstadt ,
genannt. Die zweite Festung Belgorod und dritte Siedlung dieses
Namens sind spurlos verschwunden, doch vermittelt uns ein Plan von
1768 recht genaue Kenntnis von der Grundrißform — nicht dem Aufbai:
— der Anlage. Sie ist im 18. Jahrhundert mit der zugehörigen, vor
ihren Mauern liegenden Stadt durch Feuer zugrunde gegangen, und die
Kaiserin Katharina II. hat weit über den Raun: der niedergebrannten
Bauten hinaus eine neue, steinerne Stadt, die nicht mehr befestigt war,
errichten lassen und durch ihre Ingenieure rechtwinklige Häuserblöcke
und ein strenges Gitternetz von Straßen ausstecken lassen. Die heutige
Aüb. 2.3. Burg und Festung Belgorod uni
Donez. Lageplan. «ans H. Weinen.