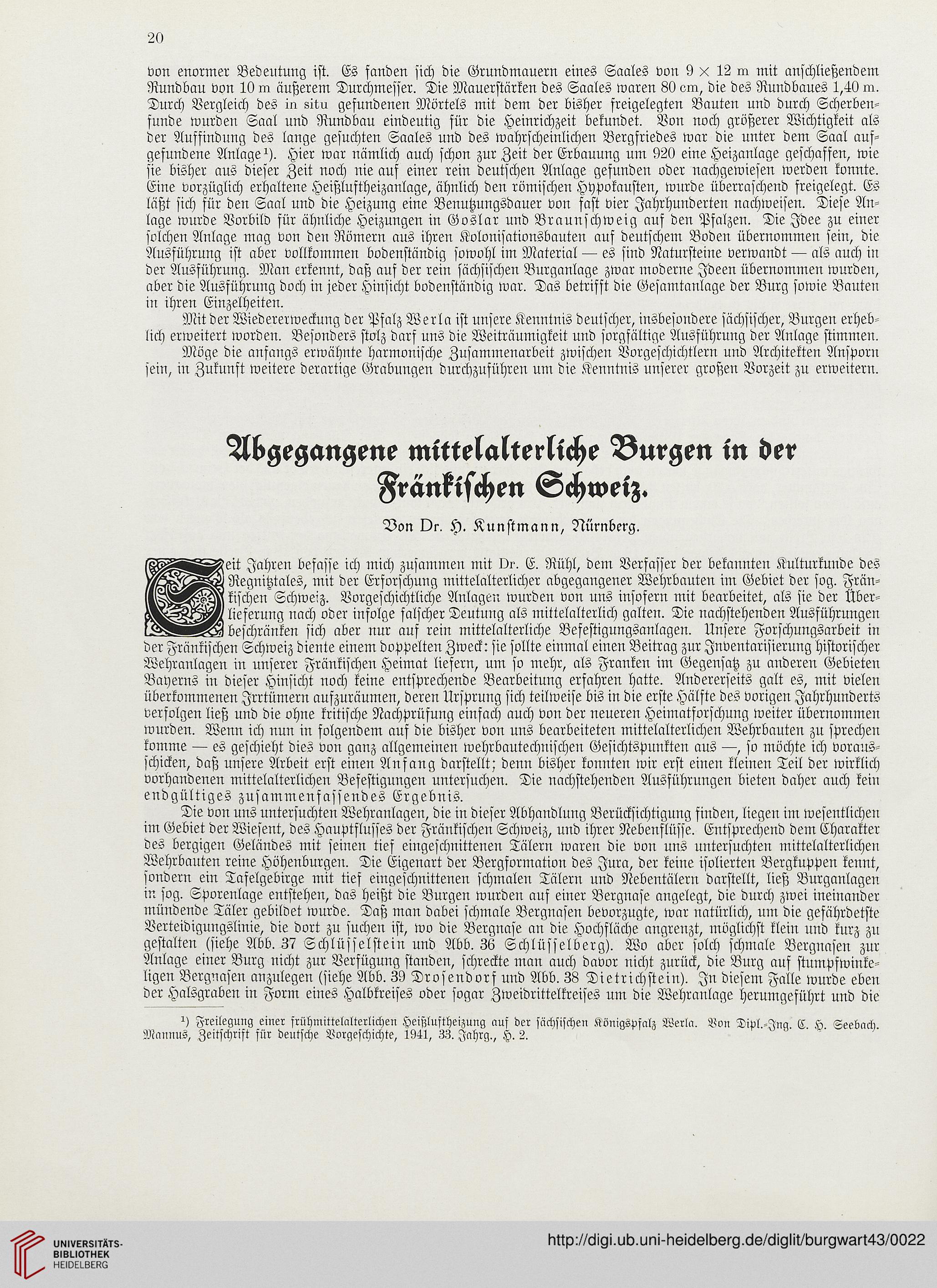20
von enormer Bedeutung ist. Es fanden sich die Grundmauern eines Saales von 9 x 12 rn mit anschließendem
Rundbau von 10 m äußerem Durchmesser. Die Mauerstärken des Saales waren 80 ein, die des Rundbaues 1,40 in.
Durch Vergleich des in situ gefundenen Mörtels mit dem der bisher freigelegten Bauten und durch Scherben-
sunde wurden Saal und Rundbau eindeutig für die Heinrichzeit bekundet. Bon noch größerer Wichtigkeit als
der Auffindung des lange gesuchten Saales und des wahrscheinlichen Bergfriedes war die unter dem Saal auf-
gefundene Anlage i). Hier war nämlich auch schon zur Zeit der Erbauung um 920 eine Heizanlage geschaffen, wie
sie bisher aus dieser Zeit noch nie auf einer rein deutschen Anlage gefunden oder nachgewiesen werden konnte.
Eine vorzüglich erhaltene Heißluftheizanlage, ähnlich den römischen Hypoknusten, wurde überraschend freigelegt. Es
läßt sich für den Saal und die Heizung eine Benutzungsdauer von fast vier Jahrhunderten Nachweisen. Diese An-
lage wurde Vorbild für ähnliche Heizungen in Goslar und Braunschweig auf den Pfalzen. Die Idee zu einer
solchen Anlage mag von den Römern aus ihren Kolonisationsbauten auf deutschem Boden übernommen sein, die
Ausführung ist aber vollkommen bodenständig sowohl im Material — es sind Natursteine verwandt — als auch in
der Ausführung. Man erkennt, daß auf der rein sächsischen Burganlage zwar moderne Ideen übernommen wurden,
aber die Ausführung doch in jeder Hinsicht bodenständig war. Das betrifft die Gesamtanlage der Burg sowie Bauten
in ihren Einzelheiten.
Mit der Wiedererweckung der Pfalz Werla ist unsere Kenntnis deutscher, insbesondere sächsischer, Burgen erheb-
lich erweitert worden. Besonders stolz darf uns die Weiträumigkeit und sorgfältige Ausführung der Anlage stimmen.
Möge die anfangs erwähnte harmonische Zusammenarbeit zwischen Vorgeschichtlern und Architekten Ansporn
sein, in Zukunft weitere derartige Grabungen durchzuführen um die Kenntnis unserer großen Vorzeit zu erweitern.
Abgegangene mittelalterliche Burgen in der
Fränkischen
Von Or. H. Kunstmann, Nürnberg.
Jahren befasse ich mich zusammen mit vr. E. Rühl, dem Verfasser der bekannten Kulturkunde des
Regnitztales, mit der Erforschung mittelalterlicher abgegangener Wehrbauten im Gebiet der sog. Frän-
kischen Schweiz. Vorgeschichtliche Anlagen wurden von uns insofern mit bearbeitet, als sie der Über-
lieferung nach oder infolge falscher Deutung als mittelalterlich galten. Die nachstehenden Ausführungen
beschränken sich aber nur auf rein mittelalterliche Befestigungsanlagen. Unsere Forschungsarbeit in
der Fränkischen Schweiz diente einem doppelten Zweck: sie sollte einmal einen Beitrag zur Inventarisierung historischer
Wehranlagen in unserer Fränkischen Heimat liefern, um so mehr, als Franken im Gegensatz zu anderen Gebieten
Bayerns in dieser Hinsicht noch keine entsprechende Bearbeitung erfahren hatte. Andererseits galt es, mit vielen
überkommenen Jrrtümern aufzuräumen, deren Ursprung sich teilweise bis in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts
verfolgen ließ und die ohne kritische Nachprüfung einfach auch von der neueren Heimatforschung weiter übernommen
wurden. Wenn ich nun in folgendem aus die bisher von uns bearbeiteten mittelalterlichen Wehrbauten zu sprechen
komme — es geschieht dies von ganz allgemeinen wehrbautechnischen Gesichtspunkten aus —, so möchte ich voraus-
schicken, daß unsere Arbeit erst einen Anfang darstellt; denn bisher konnten wir erst einen kleinen Teil der wirklich
vorhandenen mittelalterlichen Befestigungen untersuchen. Die nachstehenden Ausführungen bieten daher auch kein
endgültiges zusammenfassendes Ergebnis.
Die von uns untersuchten Wehranlagen, die in dieser Abhandlung Berücksichtigung finden, liegen im wesentlichen
im Gebiet der Wiesent, des Hauptflusses der Fränkischen Schweiz, und ihrer Nebenflüsse. Entsprechend dem Charakter
des bergigen Geländes mit seinen tief eingeschnittenen Tälern waren die von uns untersuchten mittelalterlichen
Wehrbauten reine Höhenburgeu. Die Eigenart der Bergformation des Jura, der keine isolierten Bergkuppen kennt,
sondern ein Tafelgebirge mit tief eingeschnittenen schmalen Tälern und Nebentälern darstellt, ließ Burganlagen
in sog. Sporenlage entstehen, das heißt die Burgen wurden auf einer Bergnase angelegt, die durch zwei ineinander
mündende Täler gebildet wurde. Daß man dabei schmale Bergnasen bevorzugte, war natürlich, um die gefährdetste
Verteidigungslinie, die dort zu suchen ist, wo die Bergnase an die Hochfläche angrenzt, möglichst klein und kurz zu
gestalten (siehe Abb. 37 Schlüsselstein und Abb. 36 Schlüsselberg). Wo aber solch schmale Bergnasen zur
Anlage einer Burg nicht zur Verfügung standen, schreckte man auch davor nicht zurück, die Burg auf stumpfwinke-
ligen Bergnasen anzulegen (siehe Abb. 39 Drosendorf und Abb. 38 Dietrichstein). In diesem Falle wurde eben
der Halsgraben in Form eines Halbkreises oder sogar Zweidrittelkreises um die Wehranlage herumgeführt und die
0 Freilegung einer frühmittelalterlichen Heißluftheizung auf der sächsischen Königspfalz Werla. Bon Dipl.-Ina. C. L. Seeback,.
Mannus, Zeitschrift für deutsche Vorgeschichte, 1841, 33. Jahrg., H- 2.
von enormer Bedeutung ist. Es fanden sich die Grundmauern eines Saales von 9 x 12 rn mit anschließendem
Rundbau von 10 m äußerem Durchmesser. Die Mauerstärken des Saales waren 80 ein, die des Rundbaues 1,40 in.
Durch Vergleich des in situ gefundenen Mörtels mit dem der bisher freigelegten Bauten und durch Scherben-
sunde wurden Saal und Rundbau eindeutig für die Heinrichzeit bekundet. Bon noch größerer Wichtigkeit als
der Auffindung des lange gesuchten Saales und des wahrscheinlichen Bergfriedes war die unter dem Saal auf-
gefundene Anlage i). Hier war nämlich auch schon zur Zeit der Erbauung um 920 eine Heizanlage geschaffen, wie
sie bisher aus dieser Zeit noch nie auf einer rein deutschen Anlage gefunden oder nachgewiesen werden konnte.
Eine vorzüglich erhaltene Heißluftheizanlage, ähnlich den römischen Hypoknusten, wurde überraschend freigelegt. Es
läßt sich für den Saal und die Heizung eine Benutzungsdauer von fast vier Jahrhunderten Nachweisen. Diese An-
lage wurde Vorbild für ähnliche Heizungen in Goslar und Braunschweig auf den Pfalzen. Die Idee zu einer
solchen Anlage mag von den Römern aus ihren Kolonisationsbauten auf deutschem Boden übernommen sein, die
Ausführung ist aber vollkommen bodenständig sowohl im Material — es sind Natursteine verwandt — als auch in
der Ausführung. Man erkennt, daß auf der rein sächsischen Burganlage zwar moderne Ideen übernommen wurden,
aber die Ausführung doch in jeder Hinsicht bodenständig war. Das betrifft die Gesamtanlage der Burg sowie Bauten
in ihren Einzelheiten.
Mit der Wiedererweckung der Pfalz Werla ist unsere Kenntnis deutscher, insbesondere sächsischer, Burgen erheb-
lich erweitert worden. Besonders stolz darf uns die Weiträumigkeit und sorgfältige Ausführung der Anlage stimmen.
Möge die anfangs erwähnte harmonische Zusammenarbeit zwischen Vorgeschichtlern und Architekten Ansporn
sein, in Zukunft weitere derartige Grabungen durchzuführen um die Kenntnis unserer großen Vorzeit zu erweitern.
Abgegangene mittelalterliche Burgen in der
Fränkischen
Von Or. H. Kunstmann, Nürnberg.
Jahren befasse ich mich zusammen mit vr. E. Rühl, dem Verfasser der bekannten Kulturkunde des
Regnitztales, mit der Erforschung mittelalterlicher abgegangener Wehrbauten im Gebiet der sog. Frän-
kischen Schweiz. Vorgeschichtliche Anlagen wurden von uns insofern mit bearbeitet, als sie der Über-
lieferung nach oder infolge falscher Deutung als mittelalterlich galten. Die nachstehenden Ausführungen
beschränken sich aber nur auf rein mittelalterliche Befestigungsanlagen. Unsere Forschungsarbeit in
der Fränkischen Schweiz diente einem doppelten Zweck: sie sollte einmal einen Beitrag zur Inventarisierung historischer
Wehranlagen in unserer Fränkischen Heimat liefern, um so mehr, als Franken im Gegensatz zu anderen Gebieten
Bayerns in dieser Hinsicht noch keine entsprechende Bearbeitung erfahren hatte. Andererseits galt es, mit vielen
überkommenen Jrrtümern aufzuräumen, deren Ursprung sich teilweise bis in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts
verfolgen ließ und die ohne kritische Nachprüfung einfach auch von der neueren Heimatforschung weiter übernommen
wurden. Wenn ich nun in folgendem aus die bisher von uns bearbeiteten mittelalterlichen Wehrbauten zu sprechen
komme — es geschieht dies von ganz allgemeinen wehrbautechnischen Gesichtspunkten aus —, so möchte ich voraus-
schicken, daß unsere Arbeit erst einen Anfang darstellt; denn bisher konnten wir erst einen kleinen Teil der wirklich
vorhandenen mittelalterlichen Befestigungen untersuchen. Die nachstehenden Ausführungen bieten daher auch kein
endgültiges zusammenfassendes Ergebnis.
Die von uns untersuchten Wehranlagen, die in dieser Abhandlung Berücksichtigung finden, liegen im wesentlichen
im Gebiet der Wiesent, des Hauptflusses der Fränkischen Schweiz, und ihrer Nebenflüsse. Entsprechend dem Charakter
des bergigen Geländes mit seinen tief eingeschnittenen Tälern waren die von uns untersuchten mittelalterlichen
Wehrbauten reine Höhenburgeu. Die Eigenart der Bergformation des Jura, der keine isolierten Bergkuppen kennt,
sondern ein Tafelgebirge mit tief eingeschnittenen schmalen Tälern und Nebentälern darstellt, ließ Burganlagen
in sog. Sporenlage entstehen, das heißt die Burgen wurden auf einer Bergnase angelegt, die durch zwei ineinander
mündende Täler gebildet wurde. Daß man dabei schmale Bergnasen bevorzugte, war natürlich, um die gefährdetste
Verteidigungslinie, die dort zu suchen ist, wo die Bergnase an die Hochfläche angrenzt, möglichst klein und kurz zu
gestalten (siehe Abb. 37 Schlüsselstein und Abb. 36 Schlüsselberg). Wo aber solch schmale Bergnasen zur
Anlage einer Burg nicht zur Verfügung standen, schreckte man auch davor nicht zurück, die Burg auf stumpfwinke-
ligen Bergnasen anzulegen (siehe Abb. 39 Drosendorf und Abb. 38 Dietrichstein). In diesem Falle wurde eben
der Halsgraben in Form eines Halbkreises oder sogar Zweidrittelkreises um die Wehranlage herumgeführt und die
0 Freilegung einer frühmittelalterlichen Heißluftheizung auf der sächsischen Königspfalz Werla. Bon Dipl.-Ina. C. L. Seeback,.
Mannus, Zeitschrift für deutsche Vorgeschichte, 1841, 33. Jahrg., H- 2.