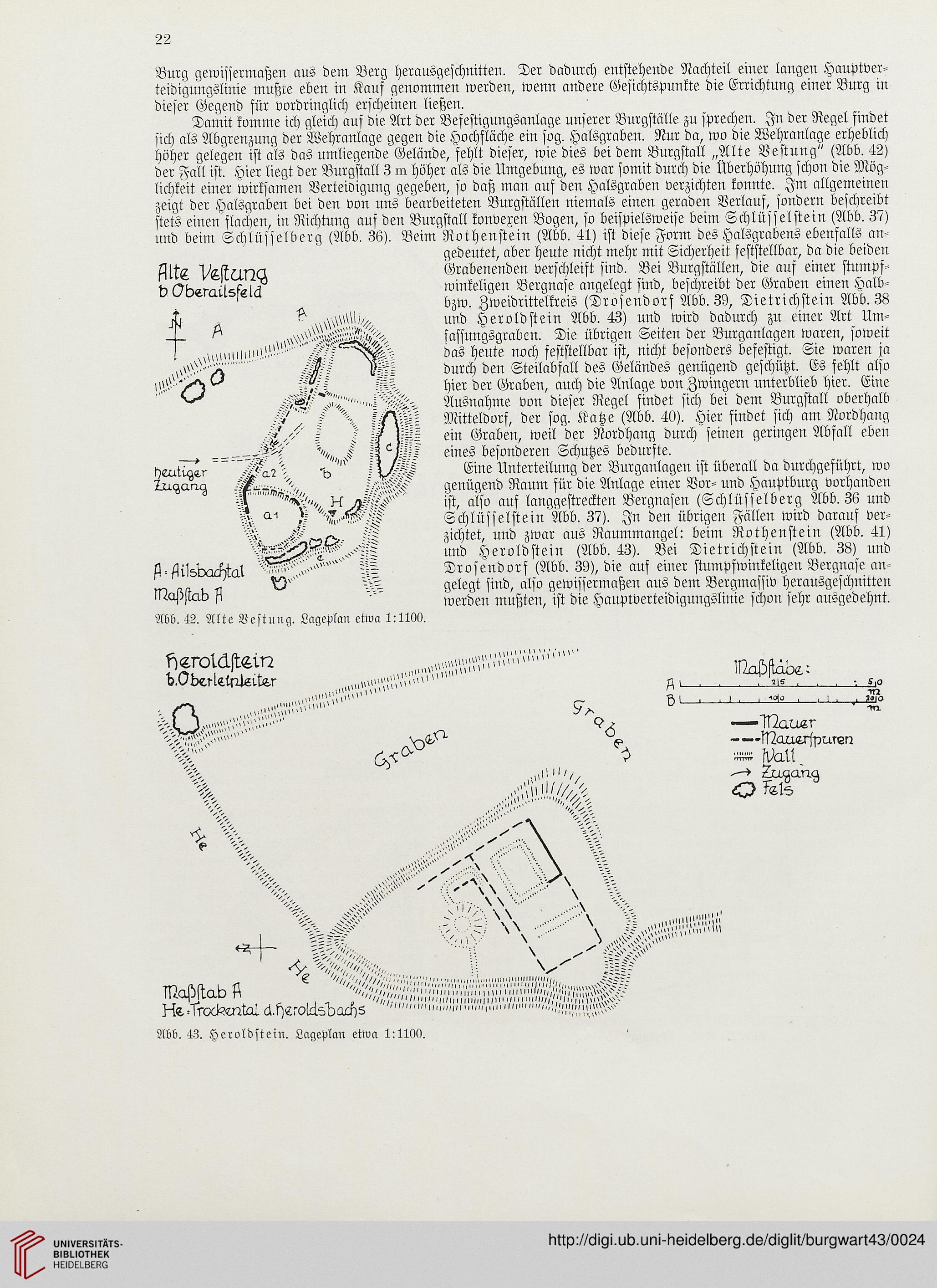d Obrrcrifsfeick
Burg gewissermaßen aus dem Berg herausgeschnitten. Der dadurch entstehende Nachteil einer langen Hauptver-
teidigungslinie mußte eben in Kauf genommen werden, wenn andere Gesichtspunkte die Errichtung einer Burg in
dieser Gegend für vordringlich erscheinen ließen.
Damit komme ich gleich auf die Art der Befestigungsanlage unserer Burgställe zu sprechen. In der Regel findet
sich als Abgrenzung der Wehranlage gegen die Hochfläche ein sog. Halsgraben. Nur da, wo die Wehranlage erheblich
höher gelegen ist als das umliegende Gelände, fehlt dieser, wie dies bei dem Burgstall „Alte Vestung" (Abb. 42)
der Fall ist. Hier liegt der Burgstall 3 m höher als die Umgebung, es war somit durch die Überhöhung schon die Mög-
lichkeit einer wirksamen Verteioiguug gegeben, so daß man auf den Halsgraben verzichten konnte. Im allgemeinen
zeigt der Halsgraben bei den von uns bearbeiteten Burgställen niemals einen geraden Verlauf, sondern beschreibt
stets einen flachen, in Richtung auf den Burgstall konvexen Bogen, so beispielsweise beim Schlüsselstein (Abb. 37)
nnd beim Schlüsselberg (Abb. 36). Beim Rothenstein (Abb. 41) ist diese Form des Halsgrabens ebenfalls an-
gedeutet, aber heute nicht mehr mit Sicherheit feststellbar, da die beiden
Grabenenden verschleift sind. Bei Burgställen, die auf einer stumpf-
winkeligen Bergnase angelegt sind, beschreibt der Graben einen Halb-
bzw. Zweidrittelkreis (Drosendorf Abb. 39, Dietrichstein Abb. 38
und Heroldstein Abb. 43) und wird dadurch zu einer Art Um-
sassungsgcabcu. Die übrigen Seiten der Burganlagen waren, soweit
das heute noch feststellbar ist, nicht besonders befestigt. Sie waren ja
durch den Steilabfall des Geländes genügend geschützt. Es fehlt also
hier der Graben, auch die Anlage von Zwingern unterblieb hier. Eine
Ausnahme von dieser Regel findet sich bei dem Burgstall oberhalb
Mitteldorf, der sog. Katze (Abb. 40). Hier findet sich am Nordhang
ein Graben, weil der Nordhang durch seinen geringen Abfall eben
eines besonderen Schutzes bedurfte.
Eine Unterteilung der Burganlageu ist überall da durchgeführt, wo
genügend Raum für die Anlage einer Vor- und Hauptburg vorhanden
ist, also auf langgestreckten Bergnasen (Schlüsselberg Abb. 36 und
Schlüsselstein Äbb. 37). In den übrigen Fällen wird darauf ver-
zichtet, und zwar aus Raummangel: beim Rothensteiu (Abb. 41)
und Herold stein (Abb. 43). Bei Dietrich st ein (Abb. 38) und
Drosendorf (Abb. 39), die auf einer stumpfwinkeligen Bergnase an-
gelegt sind, also gewissermaßen aus dem Bergmassiv herausgeschuitten
werden mußten, ist die Hauptverteidigungslinie schon sehr ausgedehnt.
fsLUOlMLilD
K.Ok)Li-iLlsULclLr
---1. .
..
.
V)^
'6
^ ,
5,0
—1H.ULN
..
^ l > > >> >, ii 77z'l ö 6 (>! ä) lu >!
Ncrftstlcrb
Abb. 43. Heroldstein. Lageplan etwa 1:1100.
Burg gewissermaßen aus dem Berg herausgeschnitten. Der dadurch entstehende Nachteil einer langen Hauptver-
teidigungslinie mußte eben in Kauf genommen werden, wenn andere Gesichtspunkte die Errichtung einer Burg in
dieser Gegend für vordringlich erscheinen ließen.
Damit komme ich gleich auf die Art der Befestigungsanlage unserer Burgställe zu sprechen. In der Regel findet
sich als Abgrenzung der Wehranlage gegen die Hochfläche ein sog. Halsgraben. Nur da, wo die Wehranlage erheblich
höher gelegen ist als das umliegende Gelände, fehlt dieser, wie dies bei dem Burgstall „Alte Vestung" (Abb. 42)
der Fall ist. Hier liegt der Burgstall 3 m höher als die Umgebung, es war somit durch die Überhöhung schon die Mög-
lichkeit einer wirksamen Verteioiguug gegeben, so daß man auf den Halsgraben verzichten konnte. Im allgemeinen
zeigt der Halsgraben bei den von uns bearbeiteten Burgställen niemals einen geraden Verlauf, sondern beschreibt
stets einen flachen, in Richtung auf den Burgstall konvexen Bogen, so beispielsweise beim Schlüsselstein (Abb. 37)
nnd beim Schlüsselberg (Abb. 36). Beim Rothenstein (Abb. 41) ist diese Form des Halsgrabens ebenfalls an-
gedeutet, aber heute nicht mehr mit Sicherheit feststellbar, da die beiden
Grabenenden verschleift sind. Bei Burgställen, die auf einer stumpf-
winkeligen Bergnase angelegt sind, beschreibt der Graben einen Halb-
bzw. Zweidrittelkreis (Drosendorf Abb. 39, Dietrichstein Abb. 38
und Heroldstein Abb. 43) und wird dadurch zu einer Art Um-
sassungsgcabcu. Die übrigen Seiten der Burganlagen waren, soweit
das heute noch feststellbar ist, nicht besonders befestigt. Sie waren ja
durch den Steilabfall des Geländes genügend geschützt. Es fehlt also
hier der Graben, auch die Anlage von Zwingern unterblieb hier. Eine
Ausnahme von dieser Regel findet sich bei dem Burgstall oberhalb
Mitteldorf, der sog. Katze (Abb. 40). Hier findet sich am Nordhang
ein Graben, weil der Nordhang durch seinen geringen Abfall eben
eines besonderen Schutzes bedurfte.
Eine Unterteilung der Burganlageu ist überall da durchgeführt, wo
genügend Raum für die Anlage einer Vor- und Hauptburg vorhanden
ist, also auf langgestreckten Bergnasen (Schlüsselberg Abb. 36 und
Schlüsselstein Äbb. 37). In den übrigen Fällen wird darauf ver-
zichtet, und zwar aus Raummangel: beim Rothensteiu (Abb. 41)
und Herold stein (Abb. 43). Bei Dietrich st ein (Abb. 38) und
Drosendorf (Abb. 39), die auf einer stumpfwinkeligen Bergnase an-
gelegt sind, also gewissermaßen aus dem Bergmassiv herausgeschuitten
werden mußten, ist die Hauptverteidigungslinie schon sehr ausgedehnt.
fsLUOlMLilD
K.Ok)Li-iLlsULclLr
---1. .
..
.
V)^
'6
^ ,
5,0
—1H.ULN
..
^ l > > >> >, ii 77z'l ö 6 (>! ä) lu >!
Ncrftstlcrb
Abb. 43. Heroldstein. Lageplan etwa 1:1100.