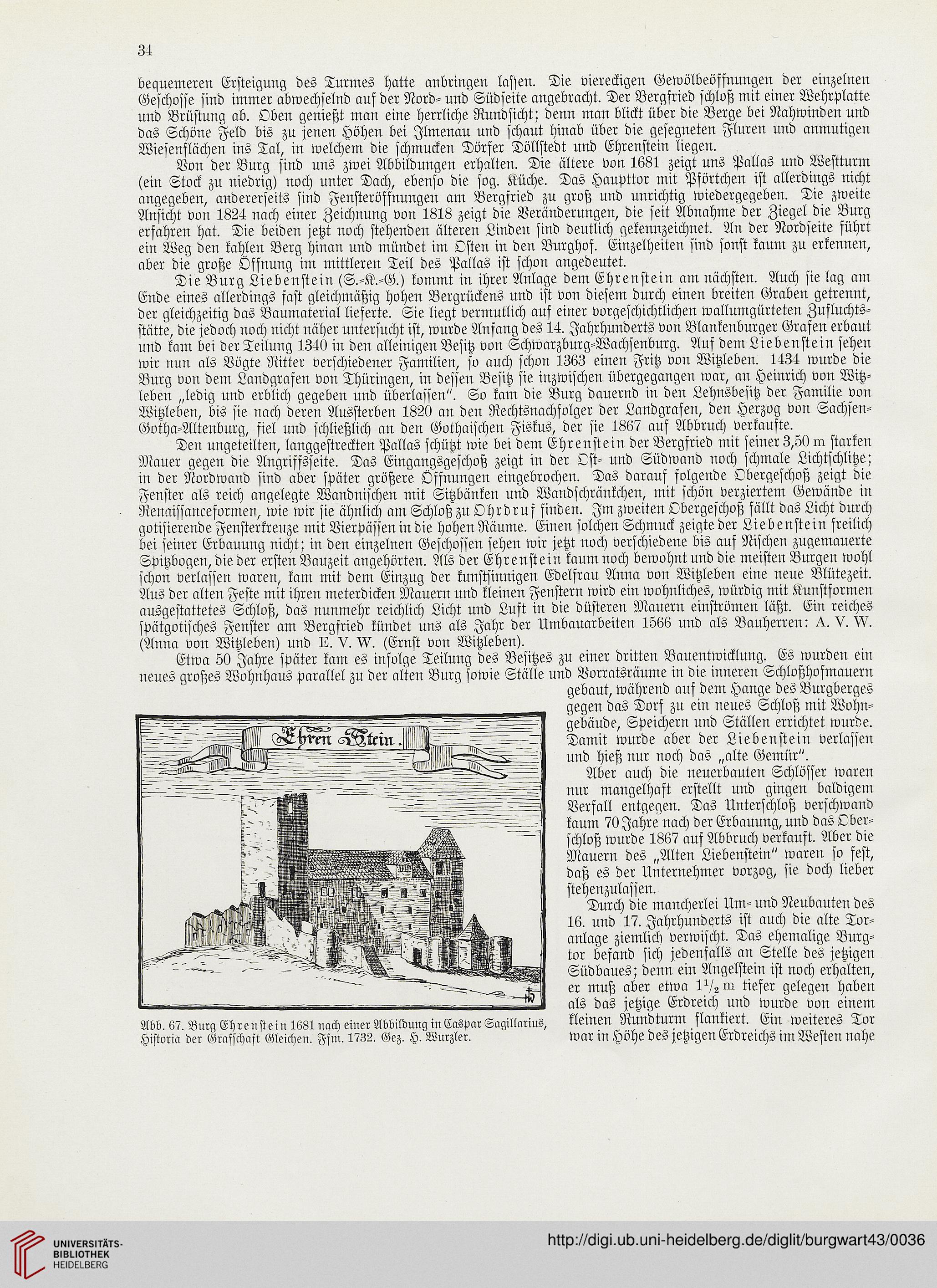34
bequemeren Ersteigung des Turmes hatte anbringen lasten. Die viereckigen Gewölbeöffnungen der einzelnen
Geschosse sind immer abwechselnd auf der Nord- und Südseite angebracht. Der Bergfried schloß mit einer Wehrplatte
und Brüstung ab. Oben genießt man eine herrliche Rundsicht; denn man blickt über die Berge bei Nahwinden und
das Schöne Feld bis zu jenen Höhen bei Ilmenau und schaut hinab über die gesegneten Fluren und anmutigen
Wiesenflächen ins Tal, in welchem die schmucken Dörfer Döllstedt und Ehrenstein liegen.
Bon der Burg sind uns zwei Abbildungen erhalten. Die ältere von 1681 zeigt uns Pallas und Westturm
(ein Stock zu niedrig) noch unter Dach, ebenso die sog. Küche. Das Haupttor mit Pförtchen ist allerdings nicht
angegeben, andererseits sind Fensteröffnungen am Bergfried zu groß und unrichtig wiedergegeben. Die zweite
Ansicht von 1824 nach einer Zeichnung von 1818 zeigt die Veränderungen, die seit Abnahme der Ziegel die Burg
erfahren hat. Die beiden jetzt noch stehenden älteren Linden sind deutlich gekennzeichnet. An der Nordseite führt
ein Weg den kahlen Berg hinan und mündet im Osten in den Burghof. Einzelheiten sind sonst kaum zu erkennen,
aber die große Öffnung im mittleren Teil des Pallas ist schon angedeutet.
Die Burg Liebenstein (S.-K.-G.) kommt in ihrer Anlage dem Ehrenstein am nächsten. Auch sie lag am
Ende eines allerdings fast gleichmäßig hohen Bergrückens und ist von diesem durch einen breiten Graben getrennt,
der gleichzeitig das Baumaterial lieferte. Sie liegt vermutlich auf einer vorgeschichtlichen wallumgürteten Zufluchts-
stätte, die jedoch noch nicht näher untersucht ist, wurde Anfang des 14. Jahrhunderts von Blankenburger Grafen erbaut
und kam bei der Teilung 1340 in den alleinigen Besitz von Schwarzburg-Wachsenburg. Auf dem Lieb eustein sehen
wir nun als Vögte Ritter verschiedener Familien, so auch schon 1363 einen Fritz von Witzleben. 1434 wurde die
Burg von dem Landgrafen von Thüringen, in dessen Besitz sie inzwischen übergegangen war, an Heinrich von Witz-
leben „ledig und erblich gegeben und überlassen". So kam die Burg dauernd in den Lehnsbesitz der Familie von
Witzlebeu, bis sie nach deren Aussterbeu 1820 an den Rechtsnachfolger der Landgrafen, den Herzog von Sachsen-
Gotha-Altenburg, fiel und schließlich an den Gothaischen Fiskus, der sie 1867 auf Abbruch verkaufte.
Den ungeteilten, langgestreckten Pallas schützt wie bei dem Ehrenstein der Bergfried mit seiner 3,50 m starken
Mauer gegen die Angriffsseite. Das Eingangsgeschoß zeigt in der Ost- und Südwand noch schmale Lichtschlitze;
in der Nordwand sind aber später größere Öffnungen eingebrochen. Das darauf folgende Obergeschoß zeigt die
Fenster als reich angelegte Wandnischen mit Sitzbänken und Wandschränkchen, mit schön verziertem Gewände in
Renaissanceformen, wie wir sie ähnlich am Schloß zu Ohrdruf finden. Im zweiten Obergeschoß fällt das Licht durch
gotisierende Fensterkreuze mit Vierpässen in die hohen Räume. Einen solchen Schmuck zeigte der Liebenstein freilich
bei seiner Erbauung nicht; in den einzelnen Geschossen sehen wir jetzt noch verschiedene bis auf Nischen zugemauerte
Spitzbogen, bieder ersten Bauzeit angehörten. Als der Ehrenstein kaum noch bewohnt und die meisten Burgen wohl
schon verlassen waren, kam mit dem Einzug der kunstsinnigen Edelfrau Anna von Witzlebeu eine neue Blütezeit.
Aus der alten Feste mit ihren meterdicken Mauern und kleinen Fenstern wird ein wohnliches, würdig mit Kunstsormen
ausgestattetes Schloß, das nunmehr reichlich Licht und Luft in die düsteren Mauern einströmen läßt. Ein reiches
spätgotisches Fenster am Bergfried kündet uns als Jahr der llmbauarbeiten 1566 und als Bauherren: /c. V. W.
(Anna von Witzleben) und bl. V. IV. (Ernst von Witzleben).
Etwa 50 Jahre später kam es infolge Teilung des Besitzes zu einer dritten Bauentwickluug. Es wurden ein
neues großes Wohnhaus parallel zu der alten Burg sowie Ställe und Vorratsräume in die inneren Schloßhofmauern
gebaut, während auf dem Hange des Burgberges
gegen das Dorf zu ein neues Schloß mit Wohn-
gebäude, Speichern und Ställen errichtet wurde.
Damit wurde aber der Liebenstein verlassen
und hieß nur noch das „alte Gemür".
Aber auch die ueuerbauten Schlösser waren
nur mangelhaft erstellt und gingen baldigem
Verfall entgegen. Das Unterschloß verschwand
kaum 70 Jahre nach der Erbauung, und das Ober-
schloß wurde 1867 auf Abbruch verkauft. Aber die
Mauern des „Alten Liebenstein" waren so fest,
daß es der Unternehmer vorzog, sie doch lieber
stehenzulasseu.
Durch die mancherlei Um- und Neubauten des
16. und 17. Jahrhunderts ist auch die alte Tor-
anlage ziemlicb verwischt. Das ehemalige Burg-
tor befand sich jedenfalls an Stelle des jetzigen
Südbaues; denn ein Augelstein ist noch erhalten,
er muß aber etwa IL/ziu tiefer gelegen haben
als das jetzige Erdreich und wurde von einem
Abb. 67. Burg Ehrensteiu 1681 nach einer Abbildung in Caspar Sagillarius, kleinen Rundturm flankiert. Ein weiteres Tor
Historia der Grafschaft Gleichen. Ffm. 1782. Gez. H. Wurzler. war in Höhe des jetzigen Erdreichs im Westen nahe
bequemeren Ersteigung des Turmes hatte anbringen lasten. Die viereckigen Gewölbeöffnungen der einzelnen
Geschosse sind immer abwechselnd auf der Nord- und Südseite angebracht. Der Bergfried schloß mit einer Wehrplatte
und Brüstung ab. Oben genießt man eine herrliche Rundsicht; denn man blickt über die Berge bei Nahwinden und
das Schöne Feld bis zu jenen Höhen bei Ilmenau und schaut hinab über die gesegneten Fluren und anmutigen
Wiesenflächen ins Tal, in welchem die schmucken Dörfer Döllstedt und Ehrenstein liegen.
Bon der Burg sind uns zwei Abbildungen erhalten. Die ältere von 1681 zeigt uns Pallas und Westturm
(ein Stock zu niedrig) noch unter Dach, ebenso die sog. Küche. Das Haupttor mit Pförtchen ist allerdings nicht
angegeben, andererseits sind Fensteröffnungen am Bergfried zu groß und unrichtig wiedergegeben. Die zweite
Ansicht von 1824 nach einer Zeichnung von 1818 zeigt die Veränderungen, die seit Abnahme der Ziegel die Burg
erfahren hat. Die beiden jetzt noch stehenden älteren Linden sind deutlich gekennzeichnet. An der Nordseite führt
ein Weg den kahlen Berg hinan und mündet im Osten in den Burghof. Einzelheiten sind sonst kaum zu erkennen,
aber die große Öffnung im mittleren Teil des Pallas ist schon angedeutet.
Die Burg Liebenstein (S.-K.-G.) kommt in ihrer Anlage dem Ehrenstein am nächsten. Auch sie lag am
Ende eines allerdings fast gleichmäßig hohen Bergrückens und ist von diesem durch einen breiten Graben getrennt,
der gleichzeitig das Baumaterial lieferte. Sie liegt vermutlich auf einer vorgeschichtlichen wallumgürteten Zufluchts-
stätte, die jedoch noch nicht näher untersucht ist, wurde Anfang des 14. Jahrhunderts von Blankenburger Grafen erbaut
und kam bei der Teilung 1340 in den alleinigen Besitz von Schwarzburg-Wachsenburg. Auf dem Lieb eustein sehen
wir nun als Vögte Ritter verschiedener Familien, so auch schon 1363 einen Fritz von Witzleben. 1434 wurde die
Burg von dem Landgrafen von Thüringen, in dessen Besitz sie inzwischen übergegangen war, an Heinrich von Witz-
leben „ledig und erblich gegeben und überlassen". So kam die Burg dauernd in den Lehnsbesitz der Familie von
Witzlebeu, bis sie nach deren Aussterbeu 1820 an den Rechtsnachfolger der Landgrafen, den Herzog von Sachsen-
Gotha-Altenburg, fiel und schließlich an den Gothaischen Fiskus, der sie 1867 auf Abbruch verkaufte.
Den ungeteilten, langgestreckten Pallas schützt wie bei dem Ehrenstein der Bergfried mit seiner 3,50 m starken
Mauer gegen die Angriffsseite. Das Eingangsgeschoß zeigt in der Ost- und Südwand noch schmale Lichtschlitze;
in der Nordwand sind aber später größere Öffnungen eingebrochen. Das darauf folgende Obergeschoß zeigt die
Fenster als reich angelegte Wandnischen mit Sitzbänken und Wandschränkchen, mit schön verziertem Gewände in
Renaissanceformen, wie wir sie ähnlich am Schloß zu Ohrdruf finden. Im zweiten Obergeschoß fällt das Licht durch
gotisierende Fensterkreuze mit Vierpässen in die hohen Räume. Einen solchen Schmuck zeigte der Liebenstein freilich
bei seiner Erbauung nicht; in den einzelnen Geschossen sehen wir jetzt noch verschiedene bis auf Nischen zugemauerte
Spitzbogen, bieder ersten Bauzeit angehörten. Als der Ehrenstein kaum noch bewohnt und die meisten Burgen wohl
schon verlassen waren, kam mit dem Einzug der kunstsinnigen Edelfrau Anna von Witzlebeu eine neue Blütezeit.
Aus der alten Feste mit ihren meterdicken Mauern und kleinen Fenstern wird ein wohnliches, würdig mit Kunstsormen
ausgestattetes Schloß, das nunmehr reichlich Licht und Luft in die düsteren Mauern einströmen läßt. Ein reiches
spätgotisches Fenster am Bergfried kündet uns als Jahr der llmbauarbeiten 1566 und als Bauherren: /c. V. W.
(Anna von Witzleben) und bl. V. IV. (Ernst von Witzleben).
Etwa 50 Jahre später kam es infolge Teilung des Besitzes zu einer dritten Bauentwickluug. Es wurden ein
neues großes Wohnhaus parallel zu der alten Burg sowie Ställe und Vorratsräume in die inneren Schloßhofmauern
gebaut, während auf dem Hange des Burgberges
gegen das Dorf zu ein neues Schloß mit Wohn-
gebäude, Speichern und Ställen errichtet wurde.
Damit wurde aber der Liebenstein verlassen
und hieß nur noch das „alte Gemür".
Aber auch die ueuerbauten Schlösser waren
nur mangelhaft erstellt und gingen baldigem
Verfall entgegen. Das Unterschloß verschwand
kaum 70 Jahre nach der Erbauung, und das Ober-
schloß wurde 1867 auf Abbruch verkauft. Aber die
Mauern des „Alten Liebenstein" waren so fest,
daß es der Unternehmer vorzog, sie doch lieber
stehenzulasseu.
Durch die mancherlei Um- und Neubauten des
16. und 17. Jahrhunderts ist auch die alte Tor-
anlage ziemlicb verwischt. Das ehemalige Burg-
tor befand sich jedenfalls an Stelle des jetzigen
Südbaues; denn ein Augelstein ist noch erhalten,
er muß aber etwa IL/ziu tiefer gelegen haben
als das jetzige Erdreich und wurde von einem
Abb. 67. Burg Ehrensteiu 1681 nach einer Abbildung in Caspar Sagillarius, kleinen Rundturm flankiert. Ein weiteres Tor
Historia der Grafschaft Gleichen. Ffm. 1782. Gez. H. Wurzler. war in Höhe des jetzigen Erdreichs im Westen nahe