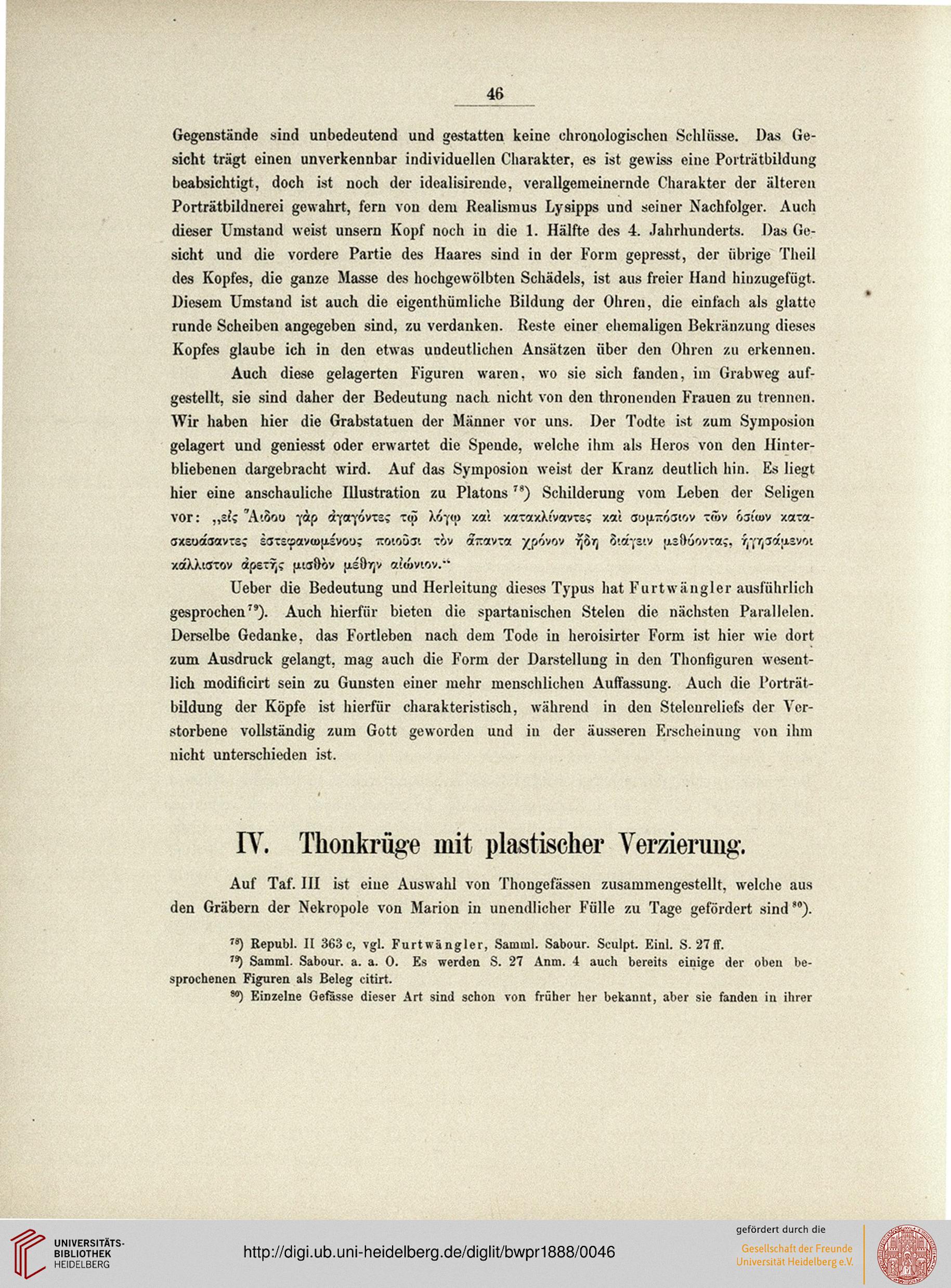46
Gegenstände sind unbedeutend und gestatten keine chronologischen Schlüsse. Das Ge-
sicht trägt einen unverkennbar individuellen Charakter, es ist gewiss eine Purträtbildung
beabsichtigt, doch ist noch der idealisirende, verallgemeinernde Charakter der älteren
Porträtbildnerei gewahrt, fern von dem Realismus Lysipps und seiner Nachfolger. Auch
dieser Umstand weist unsern Kopf noch in die 1. Hälfte des 4. Jahrhundert«. Das Ge-
sicht und die vordere Partie des Haares sind in der Form gepresst, der übrige Theil
des Kopfes, die ganze Masse des hochgewölbten Schädels, ist aus freier Hand hinzugefügt.
Diesem Umstand ist auch die eigenthümüche Bildung der Ohren, die einfach als glatte
runde Scheiben angegeben sind, zu verdanken. Reste einer ehemaliges Betoränznng dieses
Kopfes glaube ich in den etwas undeutlichen Ansätzen über den Ohren zu erkennen.
Auch diese gelagerten Figuren waren, wo sie sich fanden, im Grabweg auf-
gestellt, sie sind daher der Bedeutung nach nicht von den thronenden Frauen zu trennen.
Wir haben hier die Grabstatuen der Männer vor uns. Der Todte ist zum Symposion
gelagert und geniesst oder erwartet die Spende, welche ihm als Heros von den Hinter-
bliebenen dargebracht wird. Auf das Symposion weist der Kranz deutlich hin. Es liegt
hier eine anschauliche Illustration zu Platous78) Schilderung vom Leben der Seligen
vor: „sEj "AtSoo -fäp dfayövnii Tili Xvrm xi\ xaTaxXrVavrec xai sufiirociov rffiv &3«uv xctta-
<jx=oäa«ra; £3t*»av(u|isuo'j; muoüsi -ov firaxvta yjjv/w ffa Stifstv [»s&uovTaj, f.-pjjajisvot
%äU.ia~ov ipstSp fws&öv fieftjjv m'umov."
Ueber die Bedeutung und Herleitung dieses Typus hat Furtwänglcr ausführlich
gesprochen"). Auch hierfür bieten die spartanischen Stelen die nächsten Parallelen.
Derselbe Gedanke, das Fortleben nach dem Tode iu heroisirter Form ist hier wie dort
zum Ausdruck gelangt, mag auch die Form der Darstellung in den Thoangoren wesent-
lich modificirt sein zu Gunsten einer mehr menschlichen Auffassung. Auch die Porträt-
bildung der Köpfe ist hierfür charakteristisch, während in den Steleureliefs der Ver-
storbene vollständig zum Gott geworden und in der äusseren Erscheinung von ihm
nicht unterschieden ist.
IV. Thonkrüge mit plastischer Verzierung.
Auf Taf. III ist eine Auswahl von Thouge fassen zusammengestellt, welche aus
den Gräbern der Nekropole von Marion in unendlicher Fülle zu Tage gefordert sind").
") Republ. II 363c, vgl. Furtwängler, Samml. Sabour. Script. Einl. S. 21 ff.
") Samml. Sabour. a. a. 0. Es werden S. 27 Anm. i auch bereits einige der oben be-
sprochenen Figuren als Beleg citirt.
**) Einzelne Gefässe dieser Art sind schon von früher her bekannt, ab« *ie fanden in ihrer
Gegenstände sind unbedeutend und gestatten keine chronologischen Schlüsse. Das Ge-
sicht trägt einen unverkennbar individuellen Charakter, es ist gewiss eine Purträtbildung
beabsichtigt, doch ist noch der idealisirende, verallgemeinernde Charakter der älteren
Porträtbildnerei gewahrt, fern von dem Realismus Lysipps und seiner Nachfolger. Auch
dieser Umstand weist unsern Kopf noch in die 1. Hälfte des 4. Jahrhundert«. Das Ge-
sicht und die vordere Partie des Haares sind in der Form gepresst, der übrige Theil
des Kopfes, die ganze Masse des hochgewölbten Schädels, ist aus freier Hand hinzugefügt.
Diesem Umstand ist auch die eigenthümüche Bildung der Ohren, die einfach als glatte
runde Scheiben angegeben sind, zu verdanken. Reste einer ehemaliges Betoränznng dieses
Kopfes glaube ich in den etwas undeutlichen Ansätzen über den Ohren zu erkennen.
Auch diese gelagerten Figuren waren, wo sie sich fanden, im Grabweg auf-
gestellt, sie sind daher der Bedeutung nach nicht von den thronenden Frauen zu trennen.
Wir haben hier die Grabstatuen der Männer vor uns. Der Todte ist zum Symposion
gelagert und geniesst oder erwartet die Spende, welche ihm als Heros von den Hinter-
bliebenen dargebracht wird. Auf das Symposion weist der Kranz deutlich hin. Es liegt
hier eine anschauliche Illustration zu Platous78) Schilderung vom Leben der Seligen
vor: „sEj "AtSoo -fäp dfayövnii Tili Xvrm xi\ xaTaxXrVavrec xai sufiirociov rffiv &3«uv xctta-
<jx=oäa«ra; £3t*»av(u|isuo'j; muoüsi -ov firaxvta yjjv/w ffa Stifstv [»s&uovTaj, f.-pjjajisvot
%äU.ia~ov ipstSp fws&öv fieftjjv m'umov."
Ueber die Bedeutung und Herleitung dieses Typus hat Furtwänglcr ausführlich
gesprochen"). Auch hierfür bieten die spartanischen Stelen die nächsten Parallelen.
Derselbe Gedanke, das Fortleben nach dem Tode iu heroisirter Form ist hier wie dort
zum Ausdruck gelangt, mag auch die Form der Darstellung in den Thoangoren wesent-
lich modificirt sein zu Gunsten einer mehr menschlichen Auffassung. Auch die Porträt-
bildung der Köpfe ist hierfür charakteristisch, während in den Steleureliefs der Ver-
storbene vollständig zum Gott geworden und in der äusseren Erscheinung von ihm
nicht unterschieden ist.
IV. Thonkrüge mit plastischer Verzierung.
Auf Taf. III ist eine Auswahl von Thouge fassen zusammengestellt, welche aus
den Gräbern der Nekropole von Marion in unendlicher Fülle zu Tage gefordert sind").
") Republ. II 363c, vgl. Furtwängler, Samml. Sabour. Script. Einl. S. 21 ff.
") Samml. Sabour. a. a. 0. Es werden S. 27 Anm. i auch bereits einige der oben be-
sprochenen Figuren als Beleg citirt.
**) Einzelne Gefässe dieser Art sind schon von früher her bekannt, ab« *ie fanden in ihrer