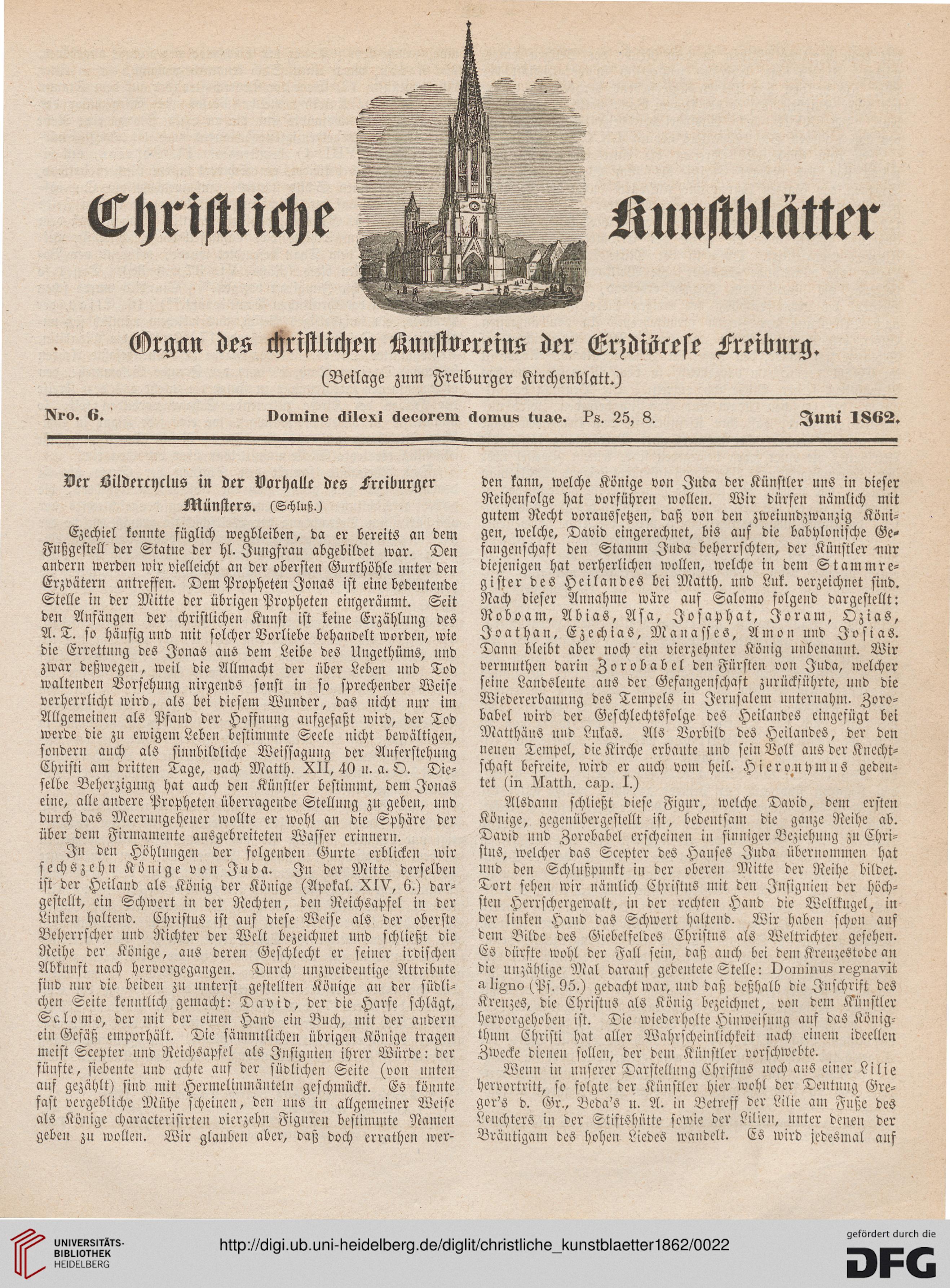enmu-
Organ des chriſtlichen Annſtvereins der Erzdiöreſe
GBeilage zum Freiburger Kirchenblatt.) ö
Aunſtblätter
Freiburg.
Nro. 6.
Domine dilexi decorem domus tuae. Psĩ. 25, 8.
„Juni 1862.
Ver Gildercyclus in der Vorhalle des Freiburger ö
Miünſters. (Schluß.)
Ezechiel konnte füglich wegbleiben, da er bereits an dem
Fußgeſtell der Statue der hl. Jungfrau abgebildet war. Den
andern werden wir vielleicht an der oberſten Gurthöhle unter den
Erzvätern antreffen. Dem Propheten Jonas iſt eine bedeutende
Stelle in der Mitte der übrigen Propheten eingeräumt. Seit
den Anfängen der chriſtlichen Kunſt iſt keine Erzählung des
A. T. ſo häufig und mit ſolcher Vorliebe behandelt worden, wie
die Errettung des Jonas aus dem Leibe des Ungethüms, und
zwar deßwegen, weil die Allmacht der über Leben und Tod
waltenden Vorſehung nirgends ſonſt in ſo ſprechender Weiſe
verherrlicht wird, als bei dieſem Wunder, vas nicht nur im
Allgemeinen als Pfand der Hoffnung aufgefaßt wird, der Tod
werde die zu ewigem Leben beſtimmte Seele nicht bewältigen,
ſondern auch als ſinnbildliche Weiſſagung der Auferſtehung
Chriſti am dritten Tage, nach Matth. XII, 40 u. a. O. Die-
ſelbe Beherzigung hat auch den Künſtler beſtimmt, dem Jonas
über dem Firmamente ausgebreiteten Waſſer erinnern.
In den Höhlungen der folgenden Gurte erblicken wir
ſechszehn Könige von Juda.
geſtellt, ein Schwert in der Rechten, den Reichsapfel in der
Linken haltend. Chriſtus iſt auf dieſe Weiſe als der oberſte
Beherrſcher und Richter der Welt bezeichnet und ſchließt die
Reihe der Könige, aus deren Geſchlecht er ſeiner irdiſchen
Abkunft nach hervorgegangen. Durch unzweideutige Attribute
ſind nur die beiden zu unterſt geſtellten Könige an der ſüdli-
chen Seite kenntlich gemacht: David, der die Harfe ſchlägt,
Salomo, der mit der einen Hand ein Buch, mit der andern
ein Gefäß emporhält. Die ſämmtlichen übrigen Könige tragen
meiſt Scepter und Reichsapfel als Inſignien ihrer Würde: der
fünfte, ſiebente und achte auf der ſüdlichen Seite (von unten
auf gezählt) ſind mit Hermelinmänteln geſchmückt. Es könnte
faſt vergebliche Mühe ſcheinen, den uns in allgemeiner Weiſe
als Könige characteriſirten vierzehn Figuren beſtimmte Namen
geben zu wollen. Wir glauben aber, daß doch errathen wer-
eine, alle andere Propheten überragende Stellung zu geben, und
durch das Meerungeheuer wollte er wohl an die Sphäre der.
da. In der Mitte derſelben
iſt der Heiland als König der Könige (Apokal. XIV, 6.) dar-
den kann, welche Könige von Juda der Künſtler uns in dieſer
Reihenfolge hat vorführen wollen. Wir dürfen nämlich mit
gutem Recht vorausſetzen, daß von den zweiundzwanzig Köni-
gen, welche, David eingerechnet, bis auf die babyloniſche Ge-
fangenſchaft den Stamm Juda beherrſchten, der Künſtler nur
diejenigen hat verherlichen wollen, welche in dem Stammre-
giſter des Heilandes bei Matth. und Luk. verzeichnet ſind.
Nach dieſer Annahme wäre auf Salomo folgend dargeſtellt:
Roboam, Abias, Aſa, Joſaphat, Joram, Ozias,
Joathan, Ezechias, Manaſſes, Amon und Joſias.
Dann bleibt aber noch ein vierzehnter König unbenannt. Wir
vermuthen darin Zorobabel den Fürſten von Juda, welcher
ſeine Landsleute aus der Gefangenſchaft zurückführte, und die
Wiedererbauung des Tempels in Jeruſalem unternahm. Zoro-
babel wird der Geſchlechtsfolge des Heilandes eingefügt bei
Matthäus und Lukas. Als Vorbild des Heilandes, der den
neuen Tempel, die Kirche erbaute und ſein Volk aus der Knecht-
ſchaft befreite, wird er auch vom heil. Hieronymus gedeu-
tet (in Matth. cap. I.)
Alsdann ſchließt dieſe Figur, welche David, dem erſten
Könige, gegenübergeſtellt iſt, bedentſam die ganze Reihe ab.
—David und Zorobabel erſcheinen in ſinniger Beziehung zu Chri-
ſtus, welcher das Scepter des Hauſes Juda übernommen hat
und den Schlußpunkt in der oberen Mitte der Reihe bildet.
Dort ſehen wir nämlich Chriſtus mit den Inſignien der höch-
ſten Herrſchergewalt, in der rechten Hand die Weltkugel, in-
der linken Hand das Schwert haltend. „Wir haben ſchon auf
dem Bilde des Giebelfeldes Chriſtns als Weltrichter geſehen.
Es dürfte wohl der Fall ſein, daß auch bei dem Kreuzestode an
die unzählige Mal darauf gedeutete Stelle: Dominus regnavit
a ligno (Pſ. 95.) gedacht war, und daß deßhalb die Inſchrift des
Kreuzes, die Chriſtus als König bezeichnet, von dem Künſtler
hervorgehoben iſt. Die wiederholte Hinweiſung auf das König-
thum Chriſti hat aller Wahrſcheinlichkeit nach einem ideellen
Zwecke dienen ſollen, der dem Künſtler vorſchwebte.
Wenn in unſerer Darſtellung Chriſtus noch aus einer Lilie
hervortritt, ſo folgte der Künſtler hier wohl der Deutung Gre-
gor's d. Gr., Beda's u. A. in Betreff der Lilie am Fuße des
Leuchters in der Stiftshütte ſowie der Lilien, unter denen der
Bräutigam des hohen Liedes wandelt. Es wird jedesmal auf
Organ des chriſtlichen Annſtvereins der Erzdiöreſe
GBeilage zum Freiburger Kirchenblatt.) ö
Aunſtblätter
Freiburg.
Nro. 6.
Domine dilexi decorem domus tuae. Psĩ. 25, 8.
„Juni 1862.
Ver Gildercyclus in der Vorhalle des Freiburger ö
Miünſters. (Schluß.)
Ezechiel konnte füglich wegbleiben, da er bereits an dem
Fußgeſtell der Statue der hl. Jungfrau abgebildet war. Den
andern werden wir vielleicht an der oberſten Gurthöhle unter den
Erzvätern antreffen. Dem Propheten Jonas iſt eine bedeutende
Stelle in der Mitte der übrigen Propheten eingeräumt. Seit
den Anfängen der chriſtlichen Kunſt iſt keine Erzählung des
A. T. ſo häufig und mit ſolcher Vorliebe behandelt worden, wie
die Errettung des Jonas aus dem Leibe des Ungethüms, und
zwar deßwegen, weil die Allmacht der über Leben und Tod
waltenden Vorſehung nirgends ſonſt in ſo ſprechender Weiſe
verherrlicht wird, als bei dieſem Wunder, vas nicht nur im
Allgemeinen als Pfand der Hoffnung aufgefaßt wird, der Tod
werde die zu ewigem Leben beſtimmte Seele nicht bewältigen,
ſondern auch als ſinnbildliche Weiſſagung der Auferſtehung
Chriſti am dritten Tage, nach Matth. XII, 40 u. a. O. Die-
ſelbe Beherzigung hat auch den Künſtler beſtimmt, dem Jonas
über dem Firmamente ausgebreiteten Waſſer erinnern.
In den Höhlungen der folgenden Gurte erblicken wir
ſechszehn Könige von Juda.
geſtellt, ein Schwert in der Rechten, den Reichsapfel in der
Linken haltend. Chriſtus iſt auf dieſe Weiſe als der oberſte
Beherrſcher und Richter der Welt bezeichnet und ſchließt die
Reihe der Könige, aus deren Geſchlecht er ſeiner irdiſchen
Abkunft nach hervorgegangen. Durch unzweideutige Attribute
ſind nur die beiden zu unterſt geſtellten Könige an der ſüdli-
chen Seite kenntlich gemacht: David, der die Harfe ſchlägt,
Salomo, der mit der einen Hand ein Buch, mit der andern
ein Gefäß emporhält. Die ſämmtlichen übrigen Könige tragen
meiſt Scepter und Reichsapfel als Inſignien ihrer Würde: der
fünfte, ſiebente und achte auf der ſüdlichen Seite (von unten
auf gezählt) ſind mit Hermelinmänteln geſchmückt. Es könnte
faſt vergebliche Mühe ſcheinen, den uns in allgemeiner Weiſe
als Könige characteriſirten vierzehn Figuren beſtimmte Namen
geben zu wollen. Wir glauben aber, daß doch errathen wer-
eine, alle andere Propheten überragende Stellung zu geben, und
durch das Meerungeheuer wollte er wohl an die Sphäre der.
da. In der Mitte derſelben
iſt der Heiland als König der Könige (Apokal. XIV, 6.) dar-
den kann, welche Könige von Juda der Künſtler uns in dieſer
Reihenfolge hat vorführen wollen. Wir dürfen nämlich mit
gutem Recht vorausſetzen, daß von den zweiundzwanzig Köni-
gen, welche, David eingerechnet, bis auf die babyloniſche Ge-
fangenſchaft den Stamm Juda beherrſchten, der Künſtler nur
diejenigen hat verherlichen wollen, welche in dem Stammre-
giſter des Heilandes bei Matth. und Luk. verzeichnet ſind.
Nach dieſer Annahme wäre auf Salomo folgend dargeſtellt:
Roboam, Abias, Aſa, Joſaphat, Joram, Ozias,
Joathan, Ezechias, Manaſſes, Amon und Joſias.
Dann bleibt aber noch ein vierzehnter König unbenannt. Wir
vermuthen darin Zorobabel den Fürſten von Juda, welcher
ſeine Landsleute aus der Gefangenſchaft zurückführte, und die
Wiedererbauung des Tempels in Jeruſalem unternahm. Zoro-
babel wird der Geſchlechtsfolge des Heilandes eingefügt bei
Matthäus und Lukas. Als Vorbild des Heilandes, der den
neuen Tempel, die Kirche erbaute und ſein Volk aus der Knecht-
ſchaft befreite, wird er auch vom heil. Hieronymus gedeu-
tet (in Matth. cap. I.)
Alsdann ſchließt dieſe Figur, welche David, dem erſten
Könige, gegenübergeſtellt iſt, bedentſam die ganze Reihe ab.
—David und Zorobabel erſcheinen in ſinniger Beziehung zu Chri-
ſtus, welcher das Scepter des Hauſes Juda übernommen hat
und den Schlußpunkt in der oberen Mitte der Reihe bildet.
Dort ſehen wir nämlich Chriſtus mit den Inſignien der höch-
ſten Herrſchergewalt, in der rechten Hand die Weltkugel, in-
der linken Hand das Schwert haltend. „Wir haben ſchon auf
dem Bilde des Giebelfeldes Chriſtns als Weltrichter geſehen.
Es dürfte wohl der Fall ſein, daß auch bei dem Kreuzestode an
die unzählige Mal darauf gedeutete Stelle: Dominus regnavit
a ligno (Pſ. 95.) gedacht war, und daß deßhalb die Inſchrift des
Kreuzes, die Chriſtus als König bezeichnet, von dem Künſtler
hervorgehoben iſt. Die wiederholte Hinweiſung auf das König-
thum Chriſti hat aller Wahrſcheinlichkeit nach einem ideellen
Zwecke dienen ſollen, der dem Künſtler vorſchwebte.
Wenn in unſerer Darſtellung Chriſtus noch aus einer Lilie
hervortritt, ſo folgte der Künſtler hier wohl der Deutung Gre-
gor's d. Gr., Beda's u. A. in Betreff der Lilie am Fuße des
Leuchters in der Stiftshütte ſowie der Lilien, unter denen der
Bräutigam des hohen Liedes wandelt. Es wird jedesmal auf