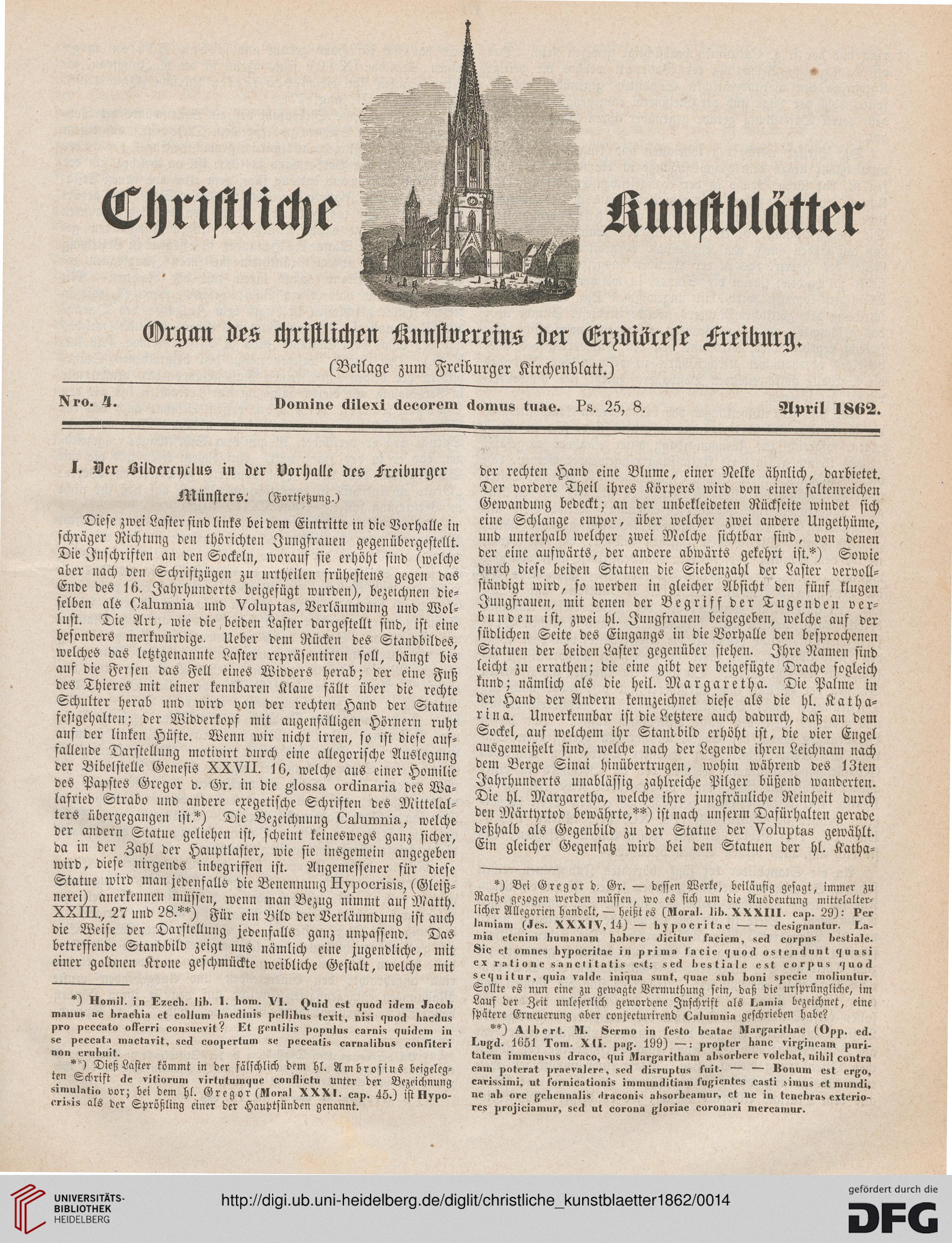Organ des chriſtlichen Aunſtvereins der Erddioteſe Ireiburg.
Aunſtblätter
(eilage zum Freiburger Kirchenblatt.)
NTo. A.
Domine dilexi decorem domus tuae. Ps. 25, S.
April 1862.
I. Der Sildercyclus in der Vorhalle des grriburger
Münſters. (Fortſetung.)
Dieſe zwei Laſter ſind links bei dem Eintritte in die Vorhalle in
ſchräger Richtung den thörichten Jungfrauen gegenübergeſtellt.
Die Inſchriften an den Sockeln, worauf ſie erhöht ſind (welche
aber nach den Schriftzügen zu urtheilen früheſtens gegen das
Ende des 16. Jahrhunderts beigefügt wurden), bezeichnen die-
ſelben als Calumnia und Voluptas, Verläumdung und Wol-
luſt. Die Art, wie die beiden Laſter dargeſtellt ſind, iſt eine
beſonders merkwürdige.
welches das letztgenannte Laſter repräſentiren ſoll, hängt bis
auf die Ferſen das Fell eines Widders herab; der eine Fuß
des Thieres mit einer kennbaren Klaue fällt über die rechte
Schulter herab und wird von der rechten Hand der Statue
feſtgehalten; der Widderkopf mit augenfälligen Hörnern ruht
auf der linken Hüfte. Wenn wir nicht irren, ſo iſt dieſe auf-
fallende Darſtellung motivirt durch eine allegoriſche Auslegung
der Bibelſtelle Geneſis XXVII. 16, welche aus einer Homilie
des Papſtes Gregor d. Gr. in die glossa ordinaria des Wa-
lafried Strabo und andere exegetiſche Schriften des Mittelal-
ters übergegangen iſt.“) Die Bezeichnung Calumnia, welche
der andern Statue geliehen iſt, ſcheint keineswegs ganz ſicher,
da in der Zahl der Hauptlaſter, wie ſie insgemein angegeben
wird, dieſe nirgends inbegriffen iſt. Angemeſſener für dieſe
Statue wird man jedenfalls die Benennung Hypocrisis, (Gleiß-
nerei) anerkennen müſſen, wenn man Bezug nimmt auf Matth.
XXIII., 27 und 28.9) Für ein Bild der Verläumdung iſt auch
die Weiſe der Darſtellung jevenfalls ganz unpaſſend. Das
betreffende Standbild zeigt uns nämlich eine jugendliche, mit
einer goldnen Krone geſchmückte weibliche Geſtalt, welche mit
*) Homil. in Ezech. lib. I. hom. VI. Ouid est quod idem Jacob
manus ac brachia et collum haedinis pellihus texit, nisi quod haedus
pro peccato offerri consuevit? Et gentilis populus carnis quidem in
se peceata mactavit, sed coopertum se peceatis carnalihus confiteri
von eruhuit.
*) Dieß Laſter kömmt in der faͤlſchlich dem hl. Ambroſius beigeleg-
ten Schrift de vitiorum virtutumque conflictu unter der Bezeichnung-
simulntio vor; bei dem hl. Gregor (Moral XXXI. cap. 45.) iſt Hypo-
crisis als der Sprößling einer der Hauptſünden genannt.
Ueber dem Rücken des Standbildes,
der rechten Hand eine Blume, einer Nelke ähnlich, darbietet. ö
Der vordere Theil ihres Körpers wird von einer faltenreichen
Gewandung bedeckt; an der unbekleideten Rückſeite windet ſich
eine Schlange empor, über welcher zwei andere Ungethüme,
und unterhalb welcher zwei Molche ſichtbar ſind, von denen
der eine aufwärts, der andere abwärts gekehrt iſt.“) Sowie
durch dieſe beiden Statuen die Siebenzahl der Laſter vervoll-
ſtändigt wird, ſo werden in gleicher Abſicht den fünf klugen
Jungfrauen, mit denen der Begriff der Tugenden ver-
bunden iſt, zwei hl. Jungfrauen beigegeben, welche auf der
ſüdlichen Seite des Eingangs in die Vorhalle den beſprochenen
Statuen der beiden Laſter gegenüber ſtehen. Ihre Namen ſind
leicht zu errathen; die eine gibt der beigefügte Drache ſogleich
kund; nämlich als die heil. Margaretha. Die Palme in
der Hand der Andern kennzeichnet dieſe als die hl. Katha-
rina. Unverkennbar iſt die Letztere auch dadurch, daß an dem
Sockel, auf welchem ihr Stanpbild erhöht iſt, die vier Engel
ausgemeißelt ſind, welche nach der Legende ihren Leichnam nach
dem Berge Sinai hinübertrugen, wohin während des 13ten
Jahrhunderts unabläſſig zahlreiche Pilger büßend wanderten.
Die hl. Margaretha, welche ihre jungfräuliche Reinheit durch
den Märtyrtod bewährte,“) iſt nach unſerm Dafürhalten gerade
deßhalb als Gegenbild zu der Statue der Voluptas gewählt.
Ein gleicher Gegenſatz wird bei den Statuen der hl. Katha-
) Bel Gregor d. Gr. — deſſen Werke, beiläufig geſagt, immer zu
Rathe gezogen werden müſſen, wo es ſich um die Ausdeutung mittelalter-
licher Allegorien handelt, — heißt es (Moral. lib. XXXIII. cap. 29): Per
lamiam (Jes. XXXIV, 14) — hypocritae — — designantur. La-
mia etenim humanam habere dicitur faciem, sed corpns bestiale.
Sic et omnes hypocritae in prime facie quod os tendunt quasi
ex ratione sanctitatis est; sed bestiale est corpus duod
sequitur, quia valde iniqua sunt, quae sub boni specie moliuntur-
Sollte es nun eine zu gewagte Vermuthung ſein, daß die urſprüngliche, im
Lauf der Zeit unleſerlich gewordene Inſchrift als Lamia bezeichnet, eine; —
ſpätere Erneuerung aber conjeeturirend Calumnia geſchrieben habe?
*) Albert. M. Sermo in festo beatae Martzarithae (O0pp. ed-
Lutzd. 1651 Tom. XII. pag. 199) —: propter hanc virgineam puri-
tatem immensus draco, qui Margaritham absorbere volebat, nihil eontra
eam poterat praevalere, sed disruptus ſuit.— — Bonum est ertzo,
enrissimi, ut fornicationis immunditiam fupientes casti dimus et mundi.
ne ab ore gebennalis draconis ahsorbeamur, et ne in tenebras exterio-
res projiciamur, sed ut corona gloriae coronari mereamur.
Aunſtblätter
(eilage zum Freiburger Kirchenblatt.)
NTo. A.
Domine dilexi decorem domus tuae. Ps. 25, S.
April 1862.
I. Der Sildercyclus in der Vorhalle des grriburger
Münſters. (Fortſetung.)
Dieſe zwei Laſter ſind links bei dem Eintritte in die Vorhalle in
ſchräger Richtung den thörichten Jungfrauen gegenübergeſtellt.
Die Inſchriften an den Sockeln, worauf ſie erhöht ſind (welche
aber nach den Schriftzügen zu urtheilen früheſtens gegen das
Ende des 16. Jahrhunderts beigefügt wurden), bezeichnen die-
ſelben als Calumnia und Voluptas, Verläumdung und Wol-
luſt. Die Art, wie die beiden Laſter dargeſtellt ſind, iſt eine
beſonders merkwürdige.
welches das letztgenannte Laſter repräſentiren ſoll, hängt bis
auf die Ferſen das Fell eines Widders herab; der eine Fuß
des Thieres mit einer kennbaren Klaue fällt über die rechte
Schulter herab und wird von der rechten Hand der Statue
feſtgehalten; der Widderkopf mit augenfälligen Hörnern ruht
auf der linken Hüfte. Wenn wir nicht irren, ſo iſt dieſe auf-
fallende Darſtellung motivirt durch eine allegoriſche Auslegung
der Bibelſtelle Geneſis XXVII. 16, welche aus einer Homilie
des Papſtes Gregor d. Gr. in die glossa ordinaria des Wa-
lafried Strabo und andere exegetiſche Schriften des Mittelal-
ters übergegangen iſt.“) Die Bezeichnung Calumnia, welche
der andern Statue geliehen iſt, ſcheint keineswegs ganz ſicher,
da in der Zahl der Hauptlaſter, wie ſie insgemein angegeben
wird, dieſe nirgends inbegriffen iſt. Angemeſſener für dieſe
Statue wird man jedenfalls die Benennung Hypocrisis, (Gleiß-
nerei) anerkennen müſſen, wenn man Bezug nimmt auf Matth.
XXIII., 27 und 28.9) Für ein Bild der Verläumdung iſt auch
die Weiſe der Darſtellung jevenfalls ganz unpaſſend. Das
betreffende Standbild zeigt uns nämlich eine jugendliche, mit
einer goldnen Krone geſchmückte weibliche Geſtalt, welche mit
*) Homil. in Ezech. lib. I. hom. VI. Ouid est quod idem Jacob
manus ac brachia et collum haedinis pellihus texit, nisi quod haedus
pro peccato offerri consuevit? Et gentilis populus carnis quidem in
se peceata mactavit, sed coopertum se peceatis carnalihus confiteri
von eruhuit.
*) Dieß Laſter kömmt in der faͤlſchlich dem hl. Ambroſius beigeleg-
ten Schrift de vitiorum virtutumque conflictu unter der Bezeichnung-
simulntio vor; bei dem hl. Gregor (Moral XXXI. cap. 45.) iſt Hypo-
crisis als der Sprößling einer der Hauptſünden genannt.
Ueber dem Rücken des Standbildes,
der rechten Hand eine Blume, einer Nelke ähnlich, darbietet. ö
Der vordere Theil ihres Körpers wird von einer faltenreichen
Gewandung bedeckt; an der unbekleideten Rückſeite windet ſich
eine Schlange empor, über welcher zwei andere Ungethüme,
und unterhalb welcher zwei Molche ſichtbar ſind, von denen
der eine aufwärts, der andere abwärts gekehrt iſt.“) Sowie
durch dieſe beiden Statuen die Siebenzahl der Laſter vervoll-
ſtändigt wird, ſo werden in gleicher Abſicht den fünf klugen
Jungfrauen, mit denen der Begriff der Tugenden ver-
bunden iſt, zwei hl. Jungfrauen beigegeben, welche auf der
ſüdlichen Seite des Eingangs in die Vorhalle den beſprochenen
Statuen der beiden Laſter gegenüber ſtehen. Ihre Namen ſind
leicht zu errathen; die eine gibt der beigefügte Drache ſogleich
kund; nämlich als die heil. Margaretha. Die Palme in
der Hand der Andern kennzeichnet dieſe als die hl. Katha-
rina. Unverkennbar iſt die Letztere auch dadurch, daß an dem
Sockel, auf welchem ihr Stanpbild erhöht iſt, die vier Engel
ausgemeißelt ſind, welche nach der Legende ihren Leichnam nach
dem Berge Sinai hinübertrugen, wohin während des 13ten
Jahrhunderts unabläſſig zahlreiche Pilger büßend wanderten.
Die hl. Margaretha, welche ihre jungfräuliche Reinheit durch
den Märtyrtod bewährte,“) iſt nach unſerm Dafürhalten gerade
deßhalb als Gegenbild zu der Statue der Voluptas gewählt.
Ein gleicher Gegenſatz wird bei den Statuen der hl. Katha-
) Bel Gregor d. Gr. — deſſen Werke, beiläufig geſagt, immer zu
Rathe gezogen werden müſſen, wo es ſich um die Ausdeutung mittelalter-
licher Allegorien handelt, — heißt es (Moral. lib. XXXIII. cap. 29): Per
lamiam (Jes. XXXIV, 14) — hypocritae — — designantur. La-
mia etenim humanam habere dicitur faciem, sed corpns bestiale.
Sic et omnes hypocritae in prime facie quod os tendunt quasi
ex ratione sanctitatis est; sed bestiale est corpus duod
sequitur, quia valde iniqua sunt, quae sub boni specie moliuntur-
Sollte es nun eine zu gewagte Vermuthung ſein, daß die urſprüngliche, im
Lauf der Zeit unleſerlich gewordene Inſchrift als Lamia bezeichnet, eine; —
ſpätere Erneuerung aber conjeeturirend Calumnia geſchrieben habe?
*) Albert. M. Sermo in festo beatae Martzarithae (O0pp. ed-
Lutzd. 1651 Tom. XII. pag. 199) —: propter hanc virgineam puri-
tatem immensus draco, qui Margaritham absorbere volebat, nihil eontra
eam poterat praevalere, sed disruptus ſuit.— — Bonum est ertzo,
enrissimi, ut fornicationis immunditiam fupientes casti dimus et mundi.
ne ab ore gebennalis draconis ahsorbeamur, et ne in tenebras exterio-
res projiciamur, sed ut corona gloriae coronari mereamur.