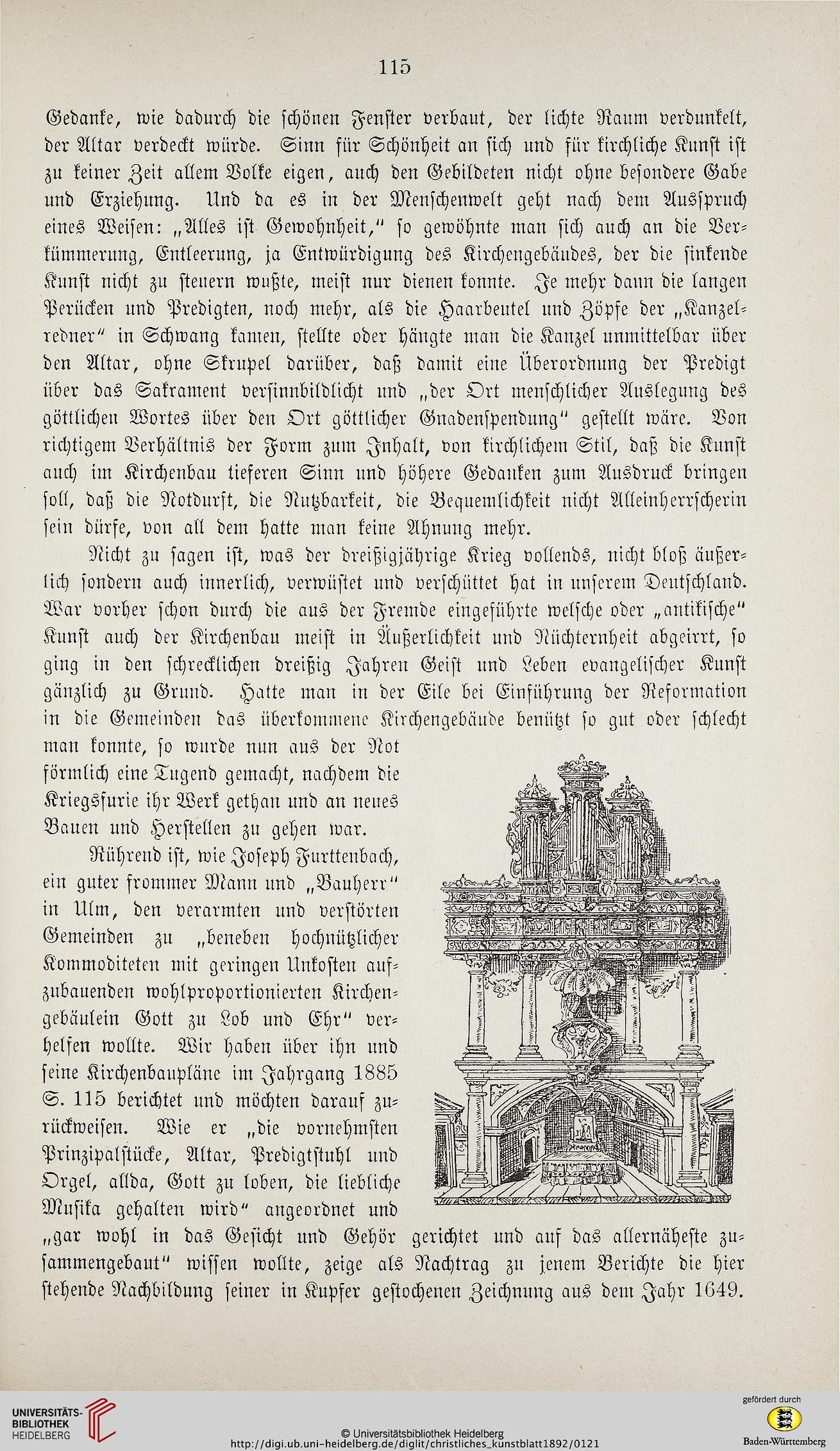115
Gedanke, wie dadurch die schönen Fenster verbaut, der lichte Raum verdunkelt,
der Altar verdeckt würde. Sinn für Schönheit an sich und für kirchliche Kunst ist
zu keiner Zeit allem Volke eigen, auch den Gebildeten nicht ohne besondere Gabe
und Erziehung. Und da es in der Menschenwelt geht nach dem Ausspruch
eines Weisen: „Alles ist Gewohnheit," so gewöhnte man sich auch an die Ver-
kümmerung, Entleerung, ja Entwürdigung des Kirchengebäudes, der die sinkende
Kunst nicht zu steuern wußte, meist nur dienen konnte. Je mehr daun die langen
Perücken und Predigten, noch mehr, als die Haarbeutel und Zöpfe der „Kanzel-
redner" in Schwang kamen, stellte oder hängte man die Kanzel unmittelbar über
den Altar, ohne Skrupel darüber, daß damit eine Überordnung der Predigt
über das Sakrament versinnbildlicht und „der Ort menschlicher Auslegung des
göttlichen Wortes über den Ort göttlicher Gnadenspendung" gestellt wäre. Von
richtigem Verhältnis der Form zum Inhalt, von kirchlichem Stil, daß die Kunst
auch im Kirchenbau tieferen Sinn und höhere Gedanken zum Ausdruck bringen
soll, daß die Notdurft, die Nutzbarkeit, die Bequemlichkeit nicht Alleinherrscherin
sein dürfe, von all dem hatte man keine Ahnung mehr.
Nicht zu sagen ist, was der dreißigjährige Krieg vollends, nicht bloß äußer-
lich sondern auch innerlich, verwüstet und verschüttet hat in unserem Deutschland.
War vorher schon durch die aus der Fremde eiugesührte welsche oder „antikische"
Kunst auch der Kirchenbau meist in Äußerlichkeit und Nüchternheit abgeirrt, so
ging in den schrecklichen dreißig Jahren Geist und Leben evangelischer Kunst
gänzlich zu Grund. Hatte man in der Eile bei Einführung der Reformation
in die Gemeinden das überkommene Kirchengebäude benützt so gut oder schlecht
man konnte, so wurde nun aus der Not
förmlich eine Tugend gemacht, nachdem die
Kriegsfurie ihr Werk gethan und an neues
Bauen und Herstellen zu gehen war.
Rührend ist, wie Joseph Furttenbach,
ein guter frommer Manu und „Bauherr"
in Ulm, den verarmten und verstörten
Gemeinden zu „beneben hochnützlicher
Koinmoditeten mit geringen Unkosten auf-
zubauenden wohlproportionierten Kirchen-
gebäulein Gott zu Lob und Ehr" ver-
helfen wollte. Wir haben über ihn und
seine Kirchenbaupläne im Jahrgang 1885
S. 115 berichtet und möchten darauf zu-
rückweisen. Wie er „die vornehmsten
Prinzipalstücke, Altar, Predigtstuhl und
Orgel, allda, Gott zu loben, die liebliche
Musika gehalten wird" angeordnet und
„gar wohl in das Gesicht und Gehör gerichtet und auf das allernäheste zu-
sammengebaut" wissen wollte, zeige als Nachtrag zu jenem Berichte die hier
stehende Nachbildung seiner in Kupfer gestochenen Zeichnung aus dem Jahr 1649.
Gedanke, wie dadurch die schönen Fenster verbaut, der lichte Raum verdunkelt,
der Altar verdeckt würde. Sinn für Schönheit an sich und für kirchliche Kunst ist
zu keiner Zeit allem Volke eigen, auch den Gebildeten nicht ohne besondere Gabe
und Erziehung. Und da es in der Menschenwelt geht nach dem Ausspruch
eines Weisen: „Alles ist Gewohnheit," so gewöhnte man sich auch an die Ver-
kümmerung, Entleerung, ja Entwürdigung des Kirchengebäudes, der die sinkende
Kunst nicht zu steuern wußte, meist nur dienen konnte. Je mehr daun die langen
Perücken und Predigten, noch mehr, als die Haarbeutel und Zöpfe der „Kanzel-
redner" in Schwang kamen, stellte oder hängte man die Kanzel unmittelbar über
den Altar, ohne Skrupel darüber, daß damit eine Überordnung der Predigt
über das Sakrament versinnbildlicht und „der Ort menschlicher Auslegung des
göttlichen Wortes über den Ort göttlicher Gnadenspendung" gestellt wäre. Von
richtigem Verhältnis der Form zum Inhalt, von kirchlichem Stil, daß die Kunst
auch im Kirchenbau tieferen Sinn und höhere Gedanken zum Ausdruck bringen
soll, daß die Notdurft, die Nutzbarkeit, die Bequemlichkeit nicht Alleinherrscherin
sein dürfe, von all dem hatte man keine Ahnung mehr.
Nicht zu sagen ist, was der dreißigjährige Krieg vollends, nicht bloß äußer-
lich sondern auch innerlich, verwüstet und verschüttet hat in unserem Deutschland.
War vorher schon durch die aus der Fremde eiugesührte welsche oder „antikische"
Kunst auch der Kirchenbau meist in Äußerlichkeit und Nüchternheit abgeirrt, so
ging in den schrecklichen dreißig Jahren Geist und Leben evangelischer Kunst
gänzlich zu Grund. Hatte man in der Eile bei Einführung der Reformation
in die Gemeinden das überkommene Kirchengebäude benützt so gut oder schlecht
man konnte, so wurde nun aus der Not
förmlich eine Tugend gemacht, nachdem die
Kriegsfurie ihr Werk gethan und an neues
Bauen und Herstellen zu gehen war.
Rührend ist, wie Joseph Furttenbach,
ein guter frommer Manu und „Bauherr"
in Ulm, den verarmten und verstörten
Gemeinden zu „beneben hochnützlicher
Koinmoditeten mit geringen Unkosten auf-
zubauenden wohlproportionierten Kirchen-
gebäulein Gott zu Lob und Ehr" ver-
helfen wollte. Wir haben über ihn und
seine Kirchenbaupläne im Jahrgang 1885
S. 115 berichtet und möchten darauf zu-
rückweisen. Wie er „die vornehmsten
Prinzipalstücke, Altar, Predigtstuhl und
Orgel, allda, Gott zu loben, die liebliche
Musika gehalten wird" angeordnet und
„gar wohl in das Gesicht und Gehör gerichtet und auf das allernäheste zu-
sammengebaut" wissen wollte, zeige als Nachtrag zu jenem Berichte die hier
stehende Nachbildung seiner in Kupfer gestochenen Zeichnung aus dem Jahr 1649.