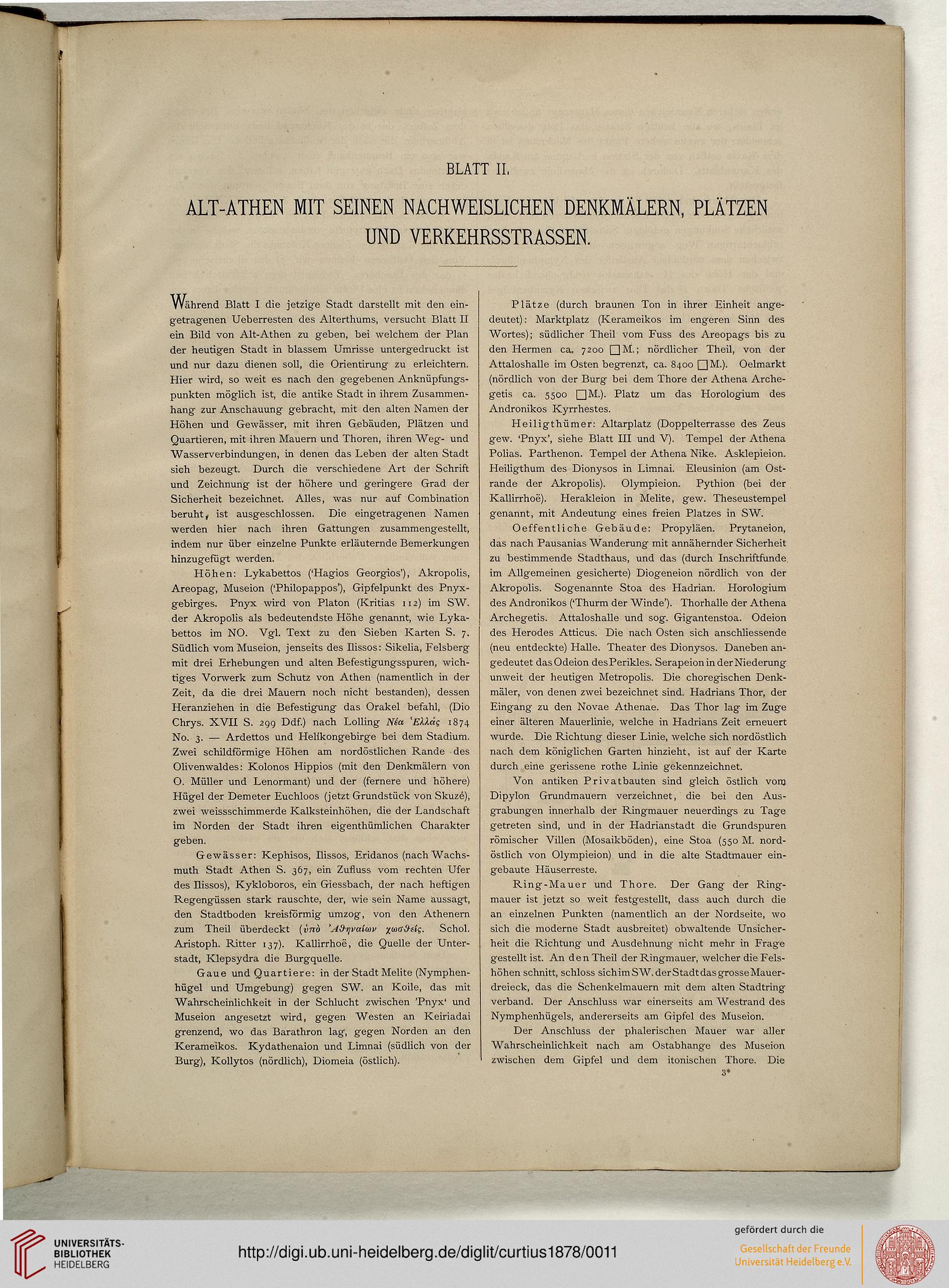BLATT II,
ALT-ATHEN MIT SEINEN NACHWEISLICHEN DENKMÄLERN, PLÄTZEN
UND VERKEHRSSTRASSEN.
Während Blatt I die jetzige Stadt darstellt mit den ein-
getragenen Ueberresten des Alterthums, versucht Blatt II
ein Bild von Alt-Athen zu geben, bei welchem der Plan
der heutigen Stadt in blassem Umrisse untergedruckt ist
und nur dazu dienen soll, die Orientirung" zu erleichtem.
Hier wird, so weit es nach den gegebenen Anknüpfungs-
punkten möglich ist, die antike Stadt in ihrem Zusammen-
hang zur Anschauung gebracht, mit den alten Namen der
Höhen und Gewässer, mit ihren Gebäuden, Plätzen und
Quartieren, mit ihren Mauern und Thoren, ihren Weg- und
Wasserverbindungen, in denen das Leben der alten Stadt
sich bezeugt. Durch die verschiedene Art der Schrift
und Zeichnung ist der höhere und geringere Grad der
Sicherheit bezeichnet. Alles, was nur auf Combination
beruht, ist ausgeschlossen. Die eingetragenen Namen
werden hier nach ihren Gattungen zusammengestellt,
indem nur über einzelne Punkte erläuternde Bemerkungen
hinzugefügt werden.
Hohen: Lykabettos ('Hagios Georgios'), Akropolis,
Areopag, Museion ('Philopappos*), Gipfelpunkt des Pnyx-
gebirges. Pnyx wird von Piaton (Kritias 112) im SW.
der Akropolis als bedeutendste Hohe genannt, wie Lyka-
bettos im NO. Vgl. Text zu den Sieben Karten S, 7.
Südlich vom Museion, jenseits des Ilissos: Sikelia, Felsberg
mit drei Erhebungen und alten Befestigungsspuren, wich-
tiges Vonverk zum Schutz von Athen (namentlich in der
Zeit, da die drei Mauern noch nicht bestanden), dessen
Heranziehen in die Befestigung das Orakel befahl, (Dio
Chrys. XVII S. 299 Ddf.) nach Lolling ]W« 'EUäg 1874
No. 3. — Ardettos und Hellkongebirge bei dem Stadium.
Zwei schildförmige Hohen am nordöstlichen Rande des
Olivenwaldes: Kolonos Hippios {mit den Denkmälern von
O. Müller und Lenormant) und der (fernere und höhere)
Hügel der Demeter Euchloos (jetzt Grundstück von Skuze),
zwei weissschimmerde Kalksteinhöhen, die der Landschaft
im Norden der Stadt ihren eigenthümlichen Charakter
geben.
Gewässer: Kephisos, Ilissos, Eridanos (nach Wachs-
muth Stadt Athen S. 367, ein Zufluss vom rechten Ufer
des Ilissos), Kykloboros, ein Giessbach, der nach heftigen
Regengüssen stark rauschte, der, wie sein Name aussagt,
den Stadtboden kreisförmig umzog, von den Athenern
zum Theil überdeckt (imo 'AO-ijvattov zwtf^ffg. Schol.
Aristoph. Ritter 137). Kallirrhoe, die Quelle der Unter-
stadt, Klepsydra die BurgqueUe.
Gaue und Quartiere: in der Stadt MeÜte (Nymphen-
hügel und Umgebung) gegen SW. an Koile, das mit
Wahrscheinlichkeit in der Schlucht zwischen 'Pnyx' und
Museion angesetzt wird, gegen Westen an Keiriadai
grenzend, wo das Barathron lag, gegen Norden an den
Kerameikos. Kydathenaion und Limnai (südlich von der
Burg), Kollytos (nördlich), Diomeia (östlich).
Plätze (durch braunen Ton in ihrer Einheit ange-
deutet): Marktplatz (Kerameikos im engeren Sinn des
Wortes); südlicher Theil vom Fuss des Areopags bis zu
den Hermen ca, 7200 DM.; nördlicher Theil, von der
Attaloshalle im Osten begrenzt, ca. 8400 QM,). Oelmarkt
(nördlich von der Burg bei dem Thore der Athena Arche-
getis ca. 5500 QM.). Platz um das Horologium des
Andronikos Kyrrhestes.
Heiligthümer: Altarplatz (Doppelterrasse des Zeus
gew. 'Pnyx', siehe Blatt III und V). Tempel der Athena
Polias. Parthenon. Tempel der Athena Nike. Asklepieion.
Jleiligthum des Dionysos in Limnai. Eleusinion (am Ost-
rande der Akropolis). Olympieion. Pythion (bei der
Kallirrhoe). Herakleion in Melite, gew. Theseustempel
genannt, mit Andeutung eines freien Platzes in SW.
Oeffentliche Gebäude: Propyläen. Prytaneion,
das nach Pausanias Wanderung mit annähernder Sicherheit
zu bestimmende Stadthaus, und das (durch Inschriftfunde.
im Allgemeinen gesicherte) Diogeneion nördlich von der
Akropolis. Sogenannte Stoa des Hadrian. Horologium
des Andronikos ('Thurm der Winde'). Thorhalle der Athena
Archegetis. Attaloshalle und sog. Gigantenstoa. Odeion
des Herodes Atticus. Die nach Osten sich anschliessende
(neu entdeckte) Halle. Theater des Dionysos. Daneben an-
gedeutet dasOdeion desPerikles. Serapeion in der Niederung
unweit der heutigen Metropolis. Die choregischen Denk-
mäler, von denen zwei bezeichnet sind. Hadrians Thor, der
Eingang zu den Novae Athenae. Das Thor lag im Zuge
einer älteren Mauerlinie, welche in Hadrians Zeit erneuert
wurde. Die Richtung dieser Linie, welche sich nordöstlich
nach dem königlichen Garten hinzieht, ist auf der Karte
durch eine gerissene rothe Linie gekennzeichnet.
Von antiken Privatbauten sind gleich Östlich vom
Dipylon Grundmauern verzeichnet, die bei den Aus-
grabungen innerhalb der Ringmauer neuerdings zu Tage
getreten sind, und in der Hadrianstadt die Grundspuren
römischer Villen (Mosaikböden), eine Stoa (550 M. nord-
östlich von Olympieion) und in die alte Stadtmauer ein-
gebaute Häuserreste.
Ring-Mauer und Thore. Der Gang der Ring-
mauer ist jetzt so weit festgestellt, dass auch durch die
an einzelnen Punkten (namentlich an der Nordseite, wo
sich die moderne Stadt ausbreitet) obwaltende Unsicher-
heit die Richtung und Ausdehnung nicht mehr in Frage
gestellt ist. An denTheil der Ringmauer, welcher die Fels-
hohen schnitt, sehloss sichim SW. der Stadt das grosseMauer-
dreieck, das die Schenkelmauern mit dem alten Stadtring
verband. Der Anschluss war einerseits am Westrand des
Nymphenhügels, andererseits am Gipfel des Museion.
Der Anschluss der phalerischen Mauer war aller
Wahrscheinlichkeit nach am Ostabhange des Museion
zwischen dem Gipfel und dem itonischen Thore. Die
ALT-ATHEN MIT SEINEN NACHWEISLICHEN DENKMÄLERN, PLÄTZEN
UND VERKEHRSSTRASSEN.
Während Blatt I die jetzige Stadt darstellt mit den ein-
getragenen Ueberresten des Alterthums, versucht Blatt II
ein Bild von Alt-Athen zu geben, bei welchem der Plan
der heutigen Stadt in blassem Umrisse untergedruckt ist
und nur dazu dienen soll, die Orientirung" zu erleichtem.
Hier wird, so weit es nach den gegebenen Anknüpfungs-
punkten möglich ist, die antike Stadt in ihrem Zusammen-
hang zur Anschauung gebracht, mit den alten Namen der
Höhen und Gewässer, mit ihren Gebäuden, Plätzen und
Quartieren, mit ihren Mauern und Thoren, ihren Weg- und
Wasserverbindungen, in denen das Leben der alten Stadt
sich bezeugt. Durch die verschiedene Art der Schrift
und Zeichnung ist der höhere und geringere Grad der
Sicherheit bezeichnet. Alles, was nur auf Combination
beruht, ist ausgeschlossen. Die eingetragenen Namen
werden hier nach ihren Gattungen zusammengestellt,
indem nur über einzelne Punkte erläuternde Bemerkungen
hinzugefügt werden.
Hohen: Lykabettos ('Hagios Georgios'), Akropolis,
Areopag, Museion ('Philopappos*), Gipfelpunkt des Pnyx-
gebirges. Pnyx wird von Piaton (Kritias 112) im SW.
der Akropolis als bedeutendste Hohe genannt, wie Lyka-
bettos im NO. Vgl. Text zu den Sieben Karten S, 7.
Südlich vom Museion, jenseits des Ilissos: Sikelia, Felsberg
mit drei Erhebungen und alten Befestigungsspuren, wich-
tiges Vonverk zum Schutz von Athen (namentlich in der
Zeit, da die drei Mauern noch nicht bestanden), dessen
Heranziehen in die Befestigung das Orakel befahl, (Dio
Chrys. XVII S. 299 Ddf.) nach Lolling ]W« 'EUäg 1874
No. 3. — Ardettos und Hellkongebirge bei dem Stadium.
Zwei schildförmige Hohen am nordöstlichen Rande des
Olivenwaldes: Kolonos Hippios {mit den Denkmälern von
O. Müller und Lenormant) und der (fernere und höhere)
Hügel der Demeter Euchloos (jetzt Grundstück von Skuze),
zwei weissschimmerde Kalksteinhöhen, die der Landschaft
im Norden der Stadt ihren eigenthümlichen Charakter
geben.
Gewässer: Kephisos, Ilissos, Eridanos (nach Wachs-
muth Stadt Athen S. 367, ein Zufluss vom rechten Ufer
des Ilissos), Kykloboros, ein Giessbach, der nach heftigen
Regengüssen stark rauschte, der, wie sein Name aussagt,
den Stadtboden kreisförmig umzog, von den Athenern
zum Theil überdeckt (imo 'AO-ijvattov zwtf^ffg. Schol.
Aristoph. Ritter 137). Kallirrhoe, die Quelle der Unter-
stadt, Klepsydra die BurgqueUe.
Gaue und Quartiere: in der Stadt MeÜte (Nymphen-
hügel und Umgebung) gegen SW. an Koile, das mit
Wahrscheinlichkeit in der Schlucht zwischen 'Pnyx' und
Museion angesetzt wird, gegen Westen an Keiriadai
grenzend, wo das Barathron lag, gegen Norden an den
Kerameikos. Kydathenaion und Limnai (südlich von der
Burg), Kollytos (nördlich), Diomeia (östlich).
Plätze (durch braunen Ton in ihrer Einheit ange-
deutet): Marktplatz (Kerameikos im engeren Sinn des
Wortes); südlicher Theil vom Fuss des Areopags bis zu
den Hermen ca, 7200 DM.; nördlicher Theil, von der
Attaloshalle im Osten begrenzt, ca. 8400 QM,). Oelmarkt
(nördlich von der Burg bei dem Thore der Athena Arche-
getis ca. 5500 QM.). Platz um das Horologium des
Andronikos Kyrrhestes.
Heiligthümer: Altarplatz (Doppelterrasse des Zeus
gew. 'Pnyx', siehe Blatt III und V). Tempel der Athena
Polias. Parthenon. Tempel der Athena Nike. Asklepieion.
Jleiligthum des Dionysos in Limnai. Eleusinion (am Ost-
rande der Akropolis). Olympieion. Pythion (bei der
Kallirrhoe). Herakleion in Melite, gew. Theseustempel
genannt, mit Andeutung eines freien Platzes in SW.
Oeffentliche Gebäude: Propyläen. Prytaneion,
das nach Pausanias Wanderung mit annähernder Sicherheit
zu bestimmende Stadthaus, und das (durch Inschriftfunde.
im Allgemeinen gesicherte) Diogeneion nördlich von der
Akropolis. Sogenannte Stoa des Hadrian. Horologium
des Andronikos ('Thurm der Winde'). Thorhalle der Athena
Archegetis. Attaloshalle und sog. Gigantenstoa. Odeion
des Herodes Atticus. Die nach Osten sich anschliessende
(neu entdeckte) Halle. Theater des Dionysos. Daneben an-
gedeutet dasOdeion desPerikles. Serapeion in der Niederung
unweit der heutigen Metropolis. Die choregischen Denk-
mäler, von denen zwei bezeichnet sind. Hadrians Thor, der
Eingang zu den Novae Athenae. Das Thor lag im Zuge
einer älteren Mauerlinie, welche in Hadrians Zeit erneuert
wurde. Die Richtung dieser Linie, welche sich nordöstlich
nach dem königlichen Garten hinzieht, ist auf der Karte
durch eine gerissene rothe Linie gekennzeichnet.
Von antiken Privatbauten sind gleich Östlich vom
Dipylon Grundmauern verzeichnet, die bei den Aus-
grabungen innerhalb der Ringmauer neuerdings zu Tage
getreten sind, und in der Hadrianstadt die Grundspuren
römischer Villen (Mosaikböden), eine Stoa (550 M. nord-
östlich von Olympieion) und in die alte Stadtmauer ein-
gebaute Häuserreste.
Ring-Mauer und Thore. Der Gang der Ring-
mauer ist jetzt so weit festgestellt, dass auch durch die
an einzelnen Punkten (namentlich an der Nordseite, wo
sich die moderne Stadt ausbreitet) obwaltende Unsicher-
heit die Richtung und Ausdehnung nicht mehr in Frage
gestellt ist. An denTheil der Ringmauer, welcher die Fels-
hohen schnitt, sehloss sichim SW. der Stadt das grosseMauer-
dreieck, das die Schenkelmauern mit dem alten Stadtring
verband. Der Anschluss war einerseits am Westrand des
Nymphenhügels, andererseits am Gipfel des Museion.
Der Anschluss der phalerischen Mauer war aller
Wahrscheinlichkeit nach am Ostabhange des Museion
zwischen dem Gipfel und dem itonischen Thore. Die