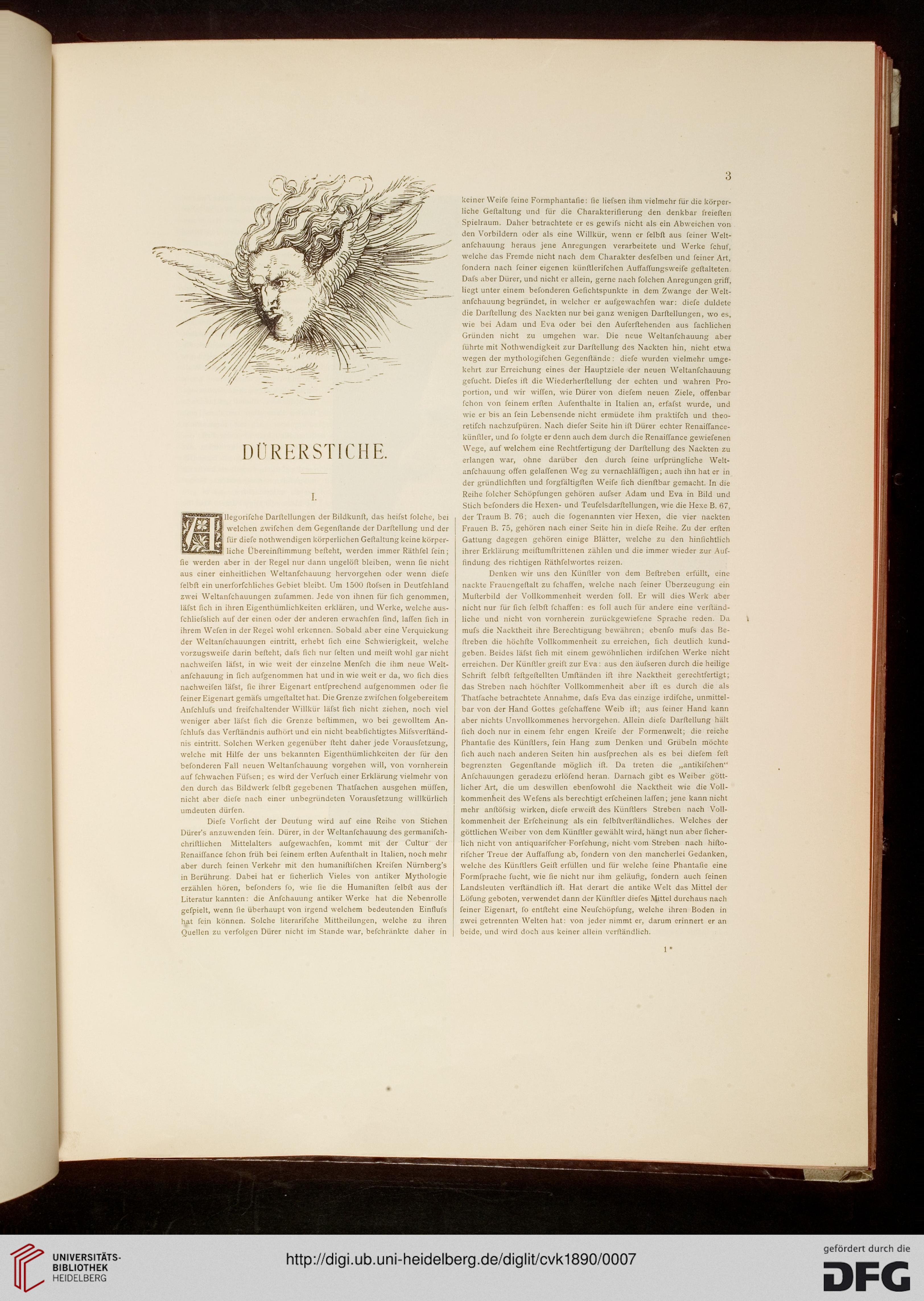f^r-:^ , /Me-
li M*'±
DÜRERSTICHE.
i.
lllegorische Darlteüungen der Bildkunst, das heisst solche, bei
! welchen zwischen dem Gegenwände der Darsteilung und der
: sür diese nothwendigen körperliehen Gestaltung keine körper-
! liehe Übercinstimmung besteht, werden immer Räthsel sein;
sie werden aber in der Regel nur dann ungelöst bleiben, wenn sie nicht
aus einer einheitlichen Weltanschauung hervorgehen oder wenn diese
selbst ein unersorschliches Gebiet bleibt. Um 1500 stossen in Deutschland
zwei Weltanschauungcn zusammen. Jede von ihnen für sich genommen,
lasst sich in ihren Eigentümlichkeiten erklären, und Werke, welche aus-
schliesslich auf der einen oder der anderen erwachsen sind, lassen sich in
ihrem Wesen in der Regel wohl erkennen. Sobald aber eine Verquickung
der Weltanschauungen eintritt, erhebt sich eine Schwierigkeit, welche
vorzugsweise darin besteht, dass sich nur seiten und meistwohl gar nicht
nachweisen lasst, in wie weit der einzelne Mensch die ihm neue Welt-
anschauung in sich ausgenommen hat und in wie weit er da, wo sich dies
nachweisen lässt, sie ihrer Eigenart entlprechend aufgenommen oder sie
seiner Eigenart gemäss umgestaltet hat. Die Grenze zwischen solgebereitem
Anschluss und freischaltender Willkür lasst sich nicht ziehen, noch viel
weniger aber lasst sich die Grenze bestimmen, wo bei gewolltem An-
schluss das Verständnis aushört und ein nicht beabsichtigtes Missverständ-
nis eintritt. Solchen Werken gegenüber sleht daher jede Voraussetzung,
welche mit Hilse der uns bekannten Eigentümlichkeiten der für den
besonderen Fall neuen Weltanschauung vorgehen will, von vornherein
aus schwachen Füssen; es wird der Versuch einer Erklärung vielmehr von
den durch das Bildwerk selbst gegebenen Thatsachen ausgehen mussen,
nicht aber diese nach einer unbegründeten Voraussetzung willkürlich
umdeuten dürsen.
Diese Vorsicht der Deutung wird auf eine Reihe von Stichen
Dürer's anzuwenden sein. Dürer, in der Weltanschauung des germanisch-
christlichen Mittelalters aufgewachten, kommt mit der Cultur der
Renaissance schon früh bei seinem erlten Aufenthalt in Italien, noch mehr
aber durch seinen Verkehr mit den humanistüchen Kreisen Nürnberg's
in Berührung. Dabei hat er Iicherhch Vieles von antiker Mythologie
erzählen hören, besonders so, wie sie die Humanisten selbst aus der
Literatur kannten: die Anschauung antiker Werke hat die Nebenrolle
gespielt, wenn sie überhaupt von irgend welchem bedeutenden Einfluss
hat sein können. Solche literarische Mittheilungen, welche zu ihren
Quellen zu versolgen Dürer nicht im Stande war, beschränkte daher in
keiner Weise seine Formphantasie: sie Hessen ihm vielmehr sür die körper-
liche Gestaltung und für die Charakterisierung den denkbar sreiesten
Spielraum. Daher betrachtete er es gewiss nicht als ein Abweichen von
den Vorbildern oder als eine Willkür, wenn er selbst aus seiner Welt-
anschauung heraus jene Anregungen verarbeitete und Werke schuf,
welche das Fremde nicht nach dem Charakter desselben und seiner Art,
sondern nach seiner eigenen künsllerischen Auff äsf ungs weise gestalteten
Dass aber Dürer, und nicht er allein, gerne nach solchen Anregungen griff,
liegt unter einem besonderen Gesichtspunkte in dem Zwange der Welt-
anschauung begründet, in welcher er ausgewachsen war: diese duldete
die Darstellung des Nackten nur bei ganz wenigen Darstellungen, wo es,
wie bei Adam und Eva oder bei den Auserstehenden aus sachlichen
Gründen nicht zu umgehen war. Die neue Weltanschauung aber
sührte mit Nothwendigkeit zur Darstellung des Nackten hin, nicht etwa
wegen der mythologischen Gegcnslände: diese wurden vielmehr umge-
kehrt zur Erreichung eines der Hauptziele der neuen Weltanschauung
gesucht. Dieses ist die Wiederherstellung der echten und wahren Pro-
portion, und wir wissen, wie Dürer von diesem neuen Ziele, offenbar
schon von seinem ersten Ausenthalte in Italien an, erfasst wurde, und
wie er bis an sein Lebensende nicht ermüdete ihm praktisch und theo-
retisch nachzuspüren. Nach dieser Seite hin ist Dürer echter Renaissance-
künsller, und so folgte er denn auch dem durch die Renaissance gewiesenen
Wege, aus welchem eine Rechtfertigung der Darstellung des Nackten zu
erlangen war, ohne darüber den durch seine ursprüngliche Welt-
anschauung ofsen gelassenen Weg zu vernachlässigen; auch ihn hat er in
der gründlichsten und sorgfältigslen Weise sich dienstbar gemacht. In die
Reihe solcher Schöpsungen gehören ausser Adam und Eva in Bild und
Stich besonders die Hexen- und Teufels dar fiel hingen, wie die Hexe B. 67,
der Traum B. 76; auch die sogenannten vier Hexen, die vier nackten
Frauen B. 75, gehören nach einer Seite hin in diere Reihe. Zu der ersten
Gattung dagegen gehören einige Blätter, welche zu den hinsichtlich
ihrer Erklärung meistumstrittenen zählen und die immer wieder zur Aus-
findung des richtigen Räthsehvortes reizen.
Denken wir uns dsn Künsller von dem Bestreben ersüllt, eine
nackte Frauengefialt zu schaffen, welche nach seiner Überzeugung ein
Musterbild der Vollkommenheit werden soll. Er will dies Werk aber
nicht nur sür sich selbst schasfen: es soll auch für andere eine verstand-
liche und nicht von vornherein zurückgewiesene Sprache reden. Da
muss die Nacktheit ihre Berechtigung bewähren; ebenso muss das Be-
fireben die höchste Vollkommenheit zu erreichen, sich deutlich kund-
geben. Beides lässt sich mit einem gewöhnlichen irdischen Werke nicht
erreichen. Der Künstler greift zur Eva: aus den äusseren durch die heilige
Schrift selbst festgestellten Umständen ist ihre Nacktheit gerechtfertigt;
das Streben nach höchster Vollkommenheit aber ist es durch die als
Thatsache betrachtete Annahme, dass Eva das einzige irdische, unmittel-
bar von der Hand Gottes geschafsene Weib ist; aus seiner Hand kann
aber nichts Unvollkommenes hervorgehen. Allein diese Darstellung hält
sich doch nur in einem sehr engen Kreise der Formenwelt; die reiche
Phantasie des Künstlers, sein Hang zum Denken und Grübeln möchte
sich auch nach anderen Seiten hin aussprechen als es bei diesem feit
begrenzten Gegenstande möglich ist. Da treten die „antikischen"
Ansehauungen geradezu erlösend heran. Darnach gibt es Weiber gött-
licher Art, die um deswillen ebensowohl die Nacktheit wie die Voll-
kommenheit des Wesens als berechtigt erscheinen lassen; jene kann nicht
mehr anstössig wirken, diese erweist des Künstlers Streben nach Voll-
kommenheit der Erschemung als ein selbstverltändliches. Welches der
göttlichen Weiber von dem Künstler gewählt wird, hangt nun aber sicher-
lich nicht von antiquarischer Forschung, nicht vom Streben nach histo-
rischer Treue der Aussasfung ab, sondern von den mancherlei Gedanken,
welche des Künstlers Geilt ersüllen und sür welche seine Phantasie eine
Formsprache sucht, wie sie nicht nur ihm geläufig, sondern auch seinen
Landsleuten verständlich ist. Hat derart die antike Welt das Mittel der
Lösung geboten, verwendet dann der Künstler dieses Mittel durchaus nach
seiner Eigenart, so entsteht eine Neuschöpfung, welche ihren Boden in
zwei getrennten Welten hat: von jeder nimmt er, darum erinnert er an
beide, und wird doch aus keiner allein verständlich.
1*
Wl
li M*'±
DÜRERSTICHE.
i.
lllegorische Darlteüungen der Bildkunst, das heisst solche, bei
! welchen zwischen dem Gegenwände der Darsteilung und der
: sür diese nothwendigen körperliehen Gestaltung keine körper-
! liehe Übercinstimmung besteht, werden immer Räthsel sein;
sie werden aber in der Regel nur dann ungelöst bleiben, wenn sie nicht
aus einer einheitlichen Weltanschauung hervorgehen oder wenn diese
selbst ein unersorschliches Gebiet bleibt. Um 1500 stossen in Deutschland
zwei Weltanschauungcn zusammen. Jede von ihnen für sich genommen,
lasst sich in ihren Eigentümlichkeiten erklären, und Werke, welche aus-
schliesslich auf der einen oder der anderen erwachsen sind, lassen sich in
ihrem Wesen in der Regel wohl erkennen. Sobald aber eine Verquickung
der Weltanschauungen eintritt, erhebt sich eine Schwierigkeit, welche
vorzugsweise darin besteht, dass sich nur seiten und meistwohl gar nicht
nachweisen lasst, in wie weit der einzelne Mensch die ihm neue Welt-
anschauung in sich ausgenommen hat und in wie weit er da, wo sich dies
nachweisen lässt, sie ihrer Eigenart entlprechend aufgenommen oder sie
seiner Eigenart gemäss umgestaltet hat. Die Grenze zwischen solgebereitem
Anschluss und freischaltender Willkür lasst sich nicht ziehen, noch viel
weniger aber lasst sich die Grenze bestimmen, wo bei gewolltem An-
schluss das Verständnis aushört und ein nicht beabsichtigtes Missverständ-
nis eintritt. Solchen Werken gegenüber sleht daher jede Voraussetzung,
welche mit Hilse der uns bekannten Eigentümlichkeiten der für den
besonderen Fall neuen Weltanschauung vorgehen will, von vornherein
aus schwachen Füssen; es wird der Versuch einer Erklärung vielmehr von
den durch das Bildwerk selbst gegebenen Thatsachen ausgehen mussen,
nicht aber diese nach einer unbegründeten Voraussetzung willkürlich
umdeuten dürsen.
Diese Vorsicht der Deutung wird auf eine Reihe von Stichen
Dürer's anzuwenden sein. Dürer, in der Weltanschauung des germanisch-
christlichen Mittelalters aufgewachten, kommt mit der Cultur der
Renaissance schon früh bei seinem erlten Aufenthalt in Italien, noch mehr
aber durch seinen Verkehr mit den humanistüchen Kreisen Nürnberg's
in Berührung. Dabei hat er Iicherhch Vieles von antiker Mythologie
erzählen hören, besonders so, wie sie die Humanisten selbst aus der
Literatur kannten: die Anschauung antiker Werke hat die Nebenrolle
gespielt, wenn sie überhaupt von irgend welchem bedeutenden Einfluss
hat sein können. Solche literarische Mittheilungen, welche zu ihren
Quellen zu versolgen Dürer nicht im Stande war, beschränkte daher in
keiner Weise seine Formphantasie: sie Hessen ihm vielmehr sür die körper-
liche Gestaltung und für die Charakterisierung den denkbar sreiesten
Spielraum. Daher betrachtete er es gewiss nicht als ein Abweichen von
den Vorbildern oder als eine Willkür, wenn er selbst aus seiner Welt-
anschauung heraus jene Anregungen verarbeitete und Werke schuf,
welche das Fremde nicht nach dem Charakter desselben und seiner Art,
sondern nach seiner eigenen künsllerischen Auff äsf ungs weise gestalteten
Dass aber Dürer, und nicht er allein, gerne nach solchen Anregungen griff,
liegt unter einem besonderen Gesichtspunkte in dem Zwange der Welt-
anschauung begründet, in welcher er ausgewachsen war: diese duldete
die Darstellung des Nackten nur bei ganz wenigen Darstellungen, wo es,
wie bei Adam und Eva oder bei den Auserstehenden aus sachlichen
Gründen nicht zu umgehen war. Die neue Weltanschauung aber
sührte mit Nothwendigkeit zur Darstellung des Nackten hin, nicht etwa
wegen der mythologischen Gegcnslände: diese wurden vielmehr umge-
kehrt zur Erreichung eines der Hauptziele der neuen Weltanschauung
gesucht. Dieses ist die Wiederherstellung der echten und wahren Pro-
portion, und wir wissen, wie Dürer von diesem neuen Ziele, offenbar
schon von seinem ersten Ausenthalte in Italien an, erfasst wurde, und
wie er bis an sein Lebensende nicht ermüdete ihm praktisch und theo-
retisch nachzuspüren. Nach dieser Seite hin ist Dürer echter Renaissance-
künsller, und so folgte er denn auch dem durch die Renaissance gewiesenen
Wege, aus welchem eine Rechtfertigung der Darstellung des Nackten zu
erlangen war, ohne darüber den durch seine ursprüngliche Welt-
anschauung ofsen gelassenen Weg zu vernachlässigen; auch ihn hat er in
der gründlichsten und sorgfältigslen Weise sich dienstbar gemacht. In die
Reihe solcher Schöpsungen gehören ausser Adam und Eva in Bild und
Stich besonders die Hexen- und Teufels dar fiel hingen, wie die Hexe B. 67,
der Traum B. 76; auch die sogenannten vier Hexen, die vier nackten
Frauen B. 75, gehören nach einer Seite hin in diere Reihe. Zu der ersten
Gattung dagegen gehören einige Blätter, welche zu den hinsichtlich
ihrer Erklärung meistumstrittenen zählen und die immer wieder zur Aus-
findung des richtigen Räthsehvortes reizen.
Denken wir uns dsn Künsller von dem Bestreben ersüllt, eine
nackte Frauengefialt zu schaffen, welche nach seiner Überzeugung ein
Musterbild der Vollkommenheit werden soll. Er will dies Werk aber
nicht nur sür sich selbst schasfen: es soll auch für andere eine verstand-
liche und nicht von vornherein zurückgewiesene Sprache reden. Da
muss die Nacktheit ihre Berechtigung bewähren; ebenso muss das Be-
fireben die höchste Vollkommenheit zu erreichen, sich deutlich kund-
geben. Beides lässt sich mit einem gewöhnlichen irdischen Werke nicht
erreichen. Der Künstler greift zur Eva: aus den äusseren durch die heilige
Schrift selbst festgestellten Umständen ist ihre Nacktheit gerechtfertigt;
das Streben nach höchster Vollkommenheit aber ist es durch die als
Thatsache betrachtete Annahme, dass Eva das einzige irdische, unmittel-
bar von der Hand Gottes geschafsene Weib ist; aus seiner Hand kann
aber nichts Unvollkommenes hervorgehen. Allein diese Darstellung hält
sich doch nur in einem sehr engen Kreise der Formenwelt; die reiche
Phantasie des Künstlers, sein Hang zum Denken und Grübeln möchte
sich auch nach anderen Seiten hin aussprechen als es bei diesem feit
begrenzten Gegenstande möglich ist. Da treten die „antikischen"
Ansehauungen geradezu erlösend heran. Darnach gibt es Weiber gött-
licher Art, die um deswillen ebensowohl die Nacktheit wie die Voll-
kommenheit des Wesens als berechtigt erscheinen lassen; jene kann nicht
mehr anstössig wirken, diese erweist des Künstlers Streben nach Voll-
kommenheit der Erschemung als ein selbstverltändliches. Welches der
göttlichen Weiber von dem Künstler gewählt wird, hangt nun aber sicher-
lich nicht von antiquarischer Forschung, nicht vom Streben nach histo-
rischer Treue der Aussasfung ab, sondern von den mancherlei Gedanken,
welche des Künstlers Geilt ersüllen und sür welche seine Phantasie eine
Formsprache sucht, wie sie nicht nur ihm geläufig, sondern auch seinen
Landsleuten verständlich ist. Hat derart die antike Welt das Mittel der
Lösung geboten, verwendet dann der Künstler dieses Mittel durchaus nach
seiner Eigenart, so entsteht eine Neuschöpfung, welche ihren Boden in
zwei getrennten Welten hat: von jeder nimmt er, darum erinnert er an
beide, und wird doch aus keiner allein verständlich.
1*
Wl