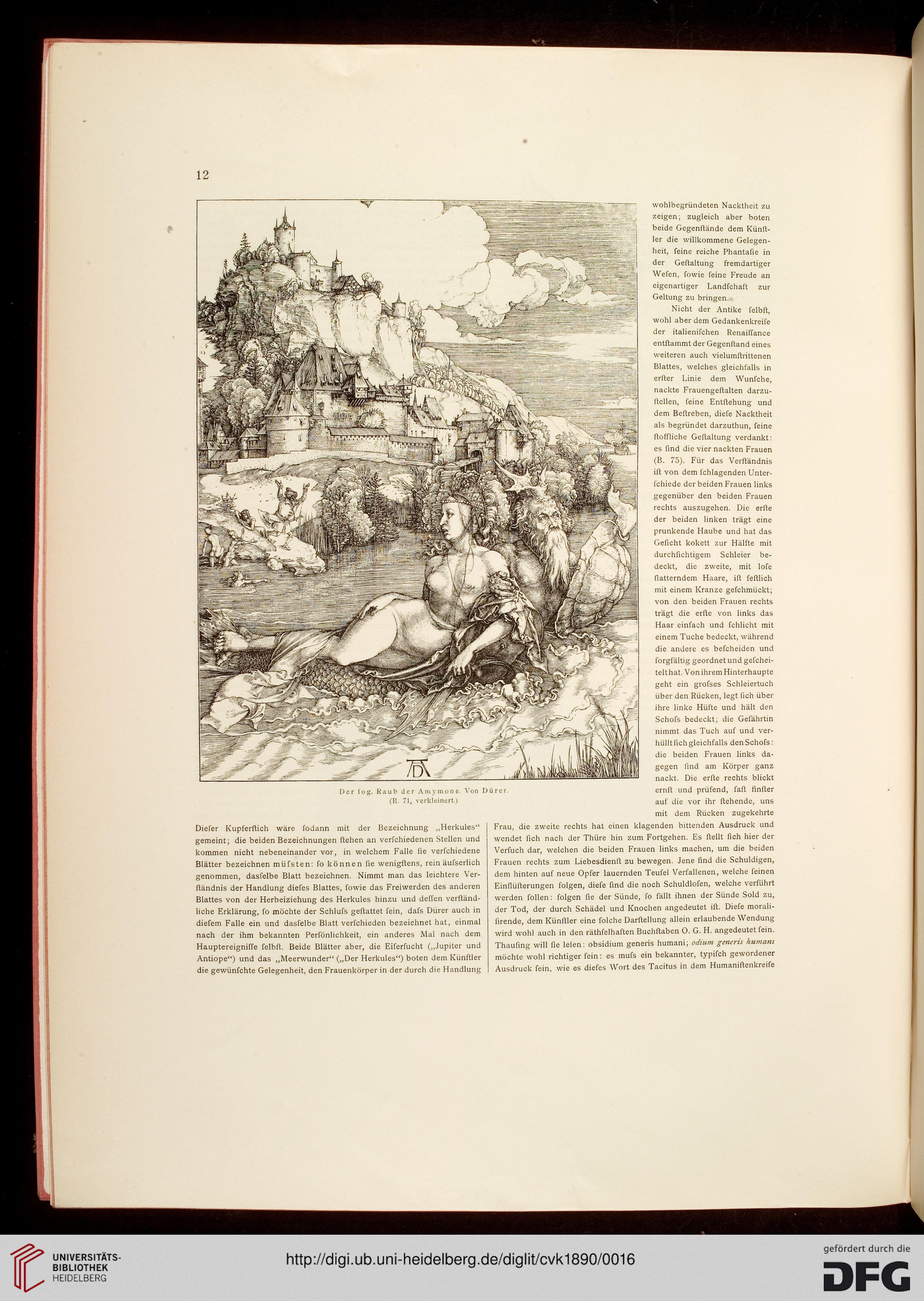12
Der fog. Raub der Amymone. Von '.
(B. 71, verkleinert.)
Dieser Kupserstich wäre sodann mit der Bezeichnung „Herkules"
gemeint; die beiden Bezeichnungen flehen an verfchiedenen Stellen und
kommen nicht nebeneinander vor, in welchem Falle fie verfchiedene
Blätter bezeichnen müfsten: so können fie wenigflens, rein äufserlich
genommen, dasfelbe Blatt bezeichnen. Nimmt man das leichtere Ver-
ftandnis der Handlung diefes Blattes, fowie das Freiwerden des anderen
Blattes von der Herbeiziehung des Herkules hinzu und defsen verftänd-
liche Erklärung, fo möchte der Schlufs geftattet fein, dafs Dürer auch in
diefem Falle ein und dasfelbe Blatt verfchieden bezeichnet hat, einmal
nach der ihm bekannten Perfönlichkeit, ein anderes Mal nach dem
Hauptereignifse felbft. Beide Blätter aber, die Eiferfucht („Jupiter und
Antiope") und das „Meerwunder" („Der Herkules") boten dem KÜnstler
die gewünfchte Gelegenheit, den Frauenkörper in der durch die Handlung
wohlbegründeten Nacktheit zu
zeigen; zugleich aber boten
beide Gegenftände dem KÜnft-
ler die willkommene Gelegen-
heit, seine reiche Phantasie in
der Gestaltung sremdartiger
Wefen, sowie feine Freude an
eigenartiger Landfchast zur
Geltung zu bringen.
Nicht der Antike selbft,
wohl aber dem Gedankenkreire
der italienischen Renaissance
entslammt der Gegenstand eines
weiteren auch vielumstrittenen
Blattes, welches gleichfalls in
erster Linie dem Wunsche,
nackte Frauengestalten darzu-
stellen, feine Entstehung und
dem Beftreben, diefe Nacktheit
als begründet darzuthun, seine
stossliche Geftaltung verdankt:
es sind die vier nackten Frauen
(B. 75). Für das Verftändnis
ist von dem Ichlagenden Unter-
fchiede der beiden Frauen links
gegenüber den beiden Frauen
rechts auszugehen. Die erfte
der beiden linken trägt eine
prunkende Haube und hat das
Gesicht kokett zur Hälste mit
durchfichtigem Schleier be-
deckt, die zweite, mit lose
flatterndem Haare, ist festlich
mit einem Kranze geschmückt;
von den beiden Frauen rechts
trägt die erste von links das
Haar einsach und fchlicht mit
einem Tuche bedeckt, während
die andere es bescheiden und
forgfältig geordnet und geschei-
telthat. VonihremHinterhaupte
geht ein grosses Schleiertuch
über den Rücken, legt sich über
ihre linke Hüste und hält den
Schoss bedeckt; die Gesährtin
nimmt das Tuch auf und ver-
hüllt fich gleichsalls den Schofs:
die beiden Frauen links da-
gegen lind am Körper ganz
nackt. Die erste rechts blickt
irer. ernft und prüsend, faft finster
auf die vor ihr flehende, uns
mit dem Rücken zugekehrte
Frau, die zweite rechts hat einen klagenden bittenden Ausdruck und
wendet fich nach der Thüre hin zum Fortgehen. Es ftellt fich hier der
Verfuch dar, welchen die beiden Frauen links machen, um die beiden
Frauen rechts zum Liebesdienft zu bewegen. Jene find die Schuldigen,
dem hinten auf neue Opfer lauernden Teufel Verfallenen, welche feinen
Einflüfterungen solgen, diefe find die noch Schuldlofen, welche verführt
werden füllen: solgen fie der Sünde, so fällt ihnen der Sünde Sold zu,
der Tod, der durch Schädel und Knochen angedeutet ift. Diefe morali-
sirende, dem KÜnftler eine folche Darfteilung allein erlaubende Wendung
wird wohl auch in den räthselhaften Buchftaben 0. G. H. angedeutet fein.
Thaufing will fie lelen: obsidium generis humani; odium generis humant
möchte wohl richtiger fein: es mufs ein bekannter, typifch gewordener
Ausdruck fein, wie es diefes Wort des Tacitus in dem Humaniftenkreife
Der fog. Raub der Amymone. Von '.
(B. 71, verkleinert.)
Dieser Kupserstich wäre sodann mit der Bezeichnung „Herkules"
gemeint; die beiden Bezeichnungen flehen an verfchiedenen Stellen und
kommen nicht nebeneinander vor, in welchem Falle fie verfchiedene
Blätter bezeichnen müfsten: so können fie wenigflens, rein äufserlich
genommen, dasfelbe Blatt bezeichnen. Nimmt man das leichtere Ver-
ftandnis der Handlung diefes Blattes, fowie das Freiwerden des anderen
Blattes von der Herbeiziehung des Herkules hinzu und defsen verftänd-
liche Erklärung, fo möchte der Schlufs geftattet fein, dafs Dürer auch in
diefem Falle ein und dasfelbe Blatt verfchieden bezeichnet hat, einmal
nach der ihm bekannten Perfönlichkeit, ein anderes Mal nach dem
Hauptereignifse felbft. Beide Blätter aber, die Eiferfucht („Jupiter und
Antiope") und das „Meerwunder" („Der Herkules") boten dem KÜnstler
die gewünfchte Gelegenheit, den Frauenkörper in der durch die Handlung
wohlbegründeten Nacktheit zu
zeigen; zugleich aber boten
beide Gegenftände dem KÜnft-
ler die willkommene Gelegen-
heit, seine reiche Phantasie in
der Gestaltung sremdartiger
Wefen, sowie feine Freude an
eigenartiger Landfchast zur
Geltung zu bringen.
Nicht der Antike selbft,
wohl aber dem Gedankenkreire
der italienischen Renaissance
entslammt der Gegenstand eines
weiteren auch vielumstrittenen
Blattes, welches gleichfalls in
erster Linie dem Wunsche,
nackte Frauengestalten darzu-
stellen, feine Entstehung und
dem Beftreben, diefe Nacktheit
als begründet darzuthun, seine
stossliche Geftaltung verdankt:
es sind die vier nackten Frauen
(B. 75). Für das Verftändnis
ist von dem Ichlagenden Unter-
fchiede der beiden Frauen links
gegenüber den beiden Frauen
rechts auszugehen. Die erfte
der beiden linken trägt eine
prunkende Haube und hat das
Gesicht kokett zur Hälste mit
durchfichtigem Schleier be-
deckt, die zweite, mit lose
flatterndem Haare, ist festlich
mit einem Kranze geschmückt;
von den beiden Frauen rechts
trägt die erste von links das
Haar einsach und fchlicht mit
einem Tuche bedeckt, während
die andere es bescheiden und
forgfältig geordnet und geschei-
telthat. VonihremHinterhaupte
geht ein grosses Schleiertuch
über den Rücken, legt sich über
ihre linke Hüste und hält den
Schoss bedeckt; die Gesährtin
nimmt das Tuch auf und ver-
hüllt fich gleichsalls den Schofs:
die beiden Frauen links da-
gegen lind am Körper ganz
nackt. Die erste rechts blickt
irer. ernft und prüsend, faft finster
auf die vor ihr flehende, uns
mit dem Rücken zugekehrte
Frau, die zweite rechts hat einen klagenden bittenden Ausdruck und
wendet fich nach der Thüre hin zum Fortgehen. Es ftellt fich hier der
Verfuch dar, welchen die beiden Frauen links machen, um die beiden
Frauen rechts zum Liebesdienft zu bewegen. Jene find die Schuldigen,
dem hinten auf neue Opfer lauernden Teufel Verfallenen, welche feinen
Einflüfterungen solgen, diefe find die noch Schuldlofen, welche verführt
werden füllen: solgen fie der Sünde, so fällt ihnen der Sünde Sold zu,
der Tod, der durch Schädel und Knochen angedeutet ift. Diefe morali-
sirende, dem KÜnftler eine folche Darfteilung allein erlaubende Wendung
wird wohl auch in den räthselhaften Buchftaben 0. G. H. angedeutet fein.
Thaufing will fie lelen: obsidium generis humani; odium generis humant
möchte wohl richtiger fein: es mufs ein bekannter, typifch gewordener
Ausdruck fein, wie es diefes Wort des Tacitus in dem Humaniftenkreife