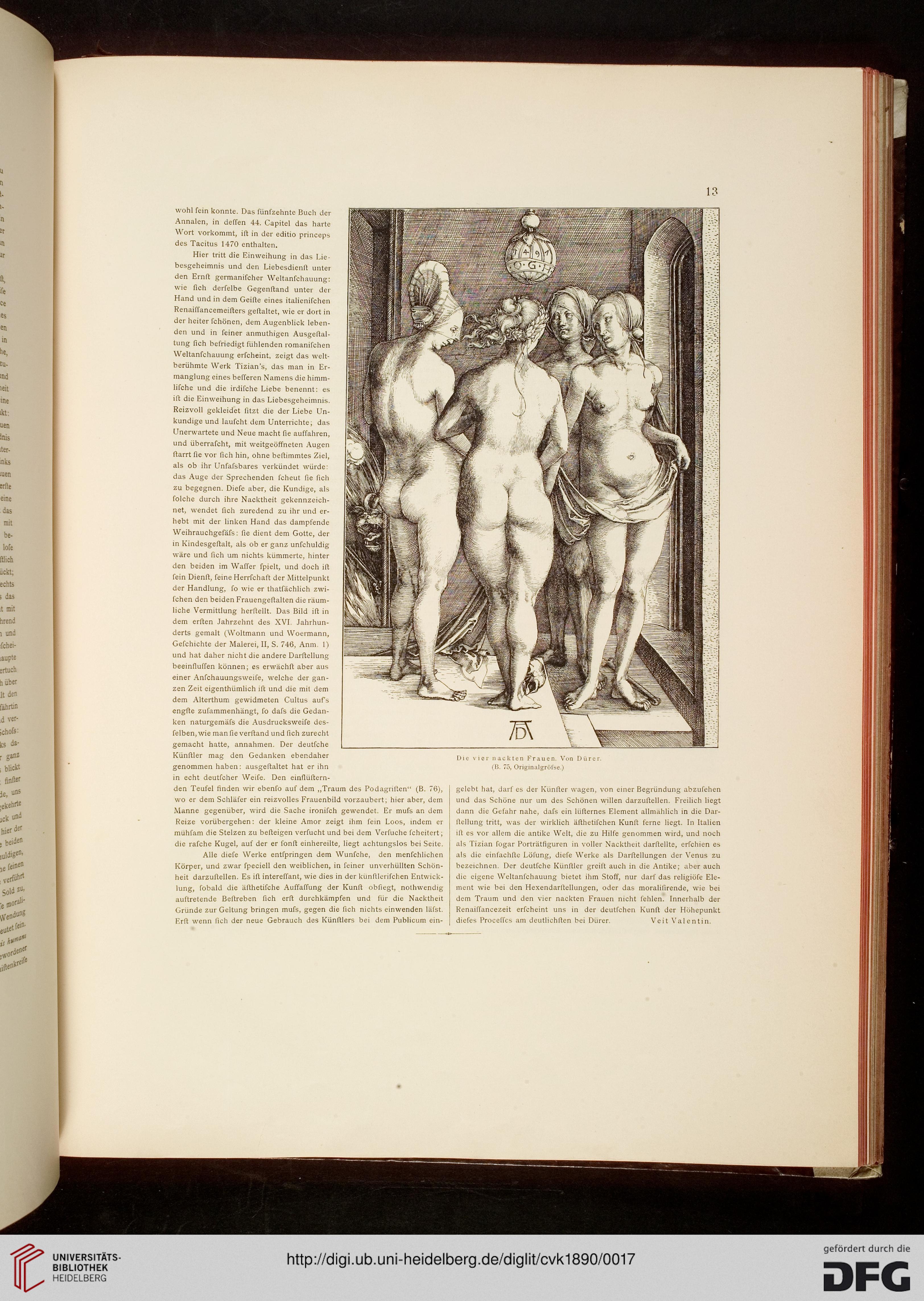13
rder
et so-
wohl sein konnte. Das fünfzehnte Buch der
Annalen, in dessen 44. Capitel das harte
Wort vorkommt, ist in der editio prineeps
des Tacitus 1470 enthalten.
Hier tritt die Einweihung in das Lie-
besgeheimnis und den Liebesdienft untei
den Ernst germanischer Weltanschauung:
wie sich derselbe Gegenstand unter der
Hand und in dem Geiste eines itaüenischen
Renaisfancemeisters gestaltet, wie er dort in
der heiter schönen, dem Augenblick leben-
den und in seiner anmuthigen Ausgestal-
tung sich befriedigt fühlenden romanischen
Weltanschauung erscheint, zeigt das welt-
berühmte Werk Tizian's, das man in Er-
manglung eines besferen Namens die himm-
lische und die irdische Liebe benennt: es
ist die Einweihung in das Liebesgeheimnis.
Reizvoll gekleidet sitzt die der Liebe Un-
kundige und lauscht dem Unterrichte; das
Unerwartete und Neue macht sie ausfahren,
und überrascht, mit weitgeösfneten Augen
starrt sie vor sich hin, ohne bestimmtes Ziel,
als ob ihr Unfassbares verkündet würde:
das Auge der Sprechenden scheut sie sich
zu begegnen. Diese aber, die Kundige, als
solche durch ihre Nacktheit gekennzeich-
net, wendet sich zuredend zu ihr und er-
hebt mit der linken Hand das dampsende
Weihrauchgefäss: fie dient dem Gotte, der
in Kindesgestalt, als ob er ganz unschuldig
wäre und sich um nichts kümmerte, hinter
den beiden im Wasfer spielt, und doch ist
sein Dienst, seine Herrschast der Mittelpunkt
der Handlung, so wie er thatsächlich Zwi-
lchen den beiden Frauengeftalten die räum-
liche Vermittlung herftellt. Das Bild ist in
dem erlten Jahrzehnt des XVI. Jahrhun-
derts gemalt (Woltmann und Woermann,
Geschichte der Malerei, II, S. 746, Anm 1)
und hat daher nicht die andere Darstellung
beeinslusfen können; es erwächst aber aus
einer Anschauungsweise, welche der gan-
zen Zeit eigenthümlich ift und die mit dem
dem Alterthum gewidmeten Cultus auss
engste zufammenhängt, so dass die Gedan-
ken naturgemäss die Ausdrucksweife des-
felben, wie man fie verstandund fich zurecht
gemacht hatte, annahmen. Der deutsehe
Künstler mag den Gedanken ebendaher
genommen haben: ausgestaltet hat er ihn
in echt deutseher Weise. Den einslüstern-
den Teufel finden wir ebenso aus dem „Traum des Podagriften" (B. 76),
wo er dem Schlaser ein reizvolles Frauenbild vorzaubert; hier aber, dem
Manne gegenüber, wird die Sache ironisch gewendet. Er mufs an dem
Reize vorübergehen; der kleine Amor zeigt ihm fein Loos, indem er
mühfam die Stelzen zu besteigen verfucht und bei dem Verfuche scheitert;
die rasche Kugel, auf der er fonst einhereiite, liegt achtungslos bei Seite.
Alle diefe Werke entspringen dem Wunfche, den mensehlichen
Körper, und zwar fpeciell den weiblichen, in seiner unverhüllten Schön-
heit darzuftellen. Es ist interessant, wie dies in der künstlerischen Entwick-
lung, sobald die ästhetifche Aussassung der Kunst obliegt, nothwendig
auftretende Bestreben sich erst durchkämpfen und sür die Nacktheit
Gründe zur Geltung bringen muss, gegen die sich nichts einwenden läfst.
Erst wenn sich der neue Gebrauch des Künftlers bei dem Publicum ein-
ackten Frauen. Von Dürer.
(B. 75, Originalgröße.)
gelebt hat, dars es der Künster wagen, von einer Begründung abzufehen
und das Schöne nur um des Schönen willen darzustellen. Freilich liegt
dann die Gesahr nahe, dass ein lüfternes Element allmählich in die Dar-
ftellung tritt, was der wirklich ästhetifchen Kunft ferne liegt. In Italien
ist es vor allem die antike Welt, die zu Hilse genommen wird, und noch
als Tizian sogar Porträtsiguren In voller Nacktheit darstellte, erfchien es
als die einsachste Losung, diefe Werke als Darftellungen der Venus zu
bezeichnen. Der deutsehe Künstler greift auch in die Antike; aber auch
die eigene Weltanfchauung bietet ihm Stofs, nur darf das religiöfe Ele-
ment wie bei den Hesendarftellungen, oder das moralifirende, wie bei
dem Traum und den vier nackten Frauen nicht fehlen. Innerhalb der
Renaisfancezeit erscheint uns in der deutsehen Kunst der Höhepunkt
diefes Proceffcs am deutlichsten bei Dürer« Veit Valentin.
J&L
rder
et so-
wohl sein konnte. Das fünfzehnte Buch der
Annalen, in dessen 44. Capitel das harte
Wort vorkommt, ist in der editio prineeps
des Tacitus 1470 enthalten.
Hier tritt die Einweihung in das Lie-
besgeheimnis und den Liebesdienft untei
den Ernst germanischer Weltanschauung:
wie sich derselbe Gegenstand unter der
Hand und in dem Geiste eines itaüenischen
Renaisfancemeisters gestaltet, wie er dort in
der heiter schönen, dem Augenblick leben-
den und in seiner anmuthigen Ausgestal-
tung sich befriedigt fühlenden romanischen
Weltanschauung erscheint, zeigt das welt-
berühmte Werk Tizian's, das man in Er-
manglung eines besferen Namens die himm-
lische und die irdische Liebe benennt: es
ist die Einweihung in das Liebesgeheimnis.
Reizvoll gekleidet sitzt die der Liebe Un-
kundige und lauscht dem Unterrichte; das
Unerwartete und Neue macht sie ausfahren,
und überrascht, mit weitgeösfneten Augen
starrt sie vor sich hin, ohne bestimmtes Ziel,
als ob ihr Unfassbares verkündet würde:
das Auge der Sprechenden scheut sie sich
zu begegnen. Diese aber, die Kundige, als
solche durch ihre Nacktheit gekennzeich-
net, wendet sich zuredend zu ihr und er-
hebt mit der linken Hand das dampsende
Weihrauchgefäss: fie dient dem Gotte, der
in Kindesgestalt, als ob er ganz unschuldig
wäre und sich um nichts kümmerte, hinter
den beiden im Wasfer spielt, und doch ist
sein Dienst, seine Herrschast der Mittelpunkt
der Handlung, so wie er thatsächlich Zwi-
lchen den beiden Frauengeftalten die räum-
liche Vermittlung herftellt. Das Bild ist in
dem erlten Jahrzehnt des XVI. Jahrhun-
derts gemalt (Woltmann und Woermann,
Geschichte der Malerei, II, S. 746, Anm 1)
und hat daher nicht die andere Darstellung
beeinslusfen können; es erwächst aber aus
einer Anschauungsweise, welche der gan-
zen Zeit eigenthümlich ift und die mit dem
dem Alterthum gewidmeten Cultus auss
engste zufammenhängt, so dass die Gedan-
ken naturgemäss die Ausdrucksweife des-
felben, wie man fie verstandund fich zurecht
gemacht hatte, annahmen. Der deutsehe
Künstler mag den Gedanken ebendaher
genommen haben: ausgestaltet hat er ihn
in echt deutseher Weise. Den einslüstern-
den Teufel finden wir ebenso aus dem „Traum des Podagriften" (B. 76),
wo er dem Schlaser ein reizvolles Frauenbild vorzaubert; hier aber, dem
Manne gegenüber, wird die Sache ironisch gewendet. Er mufs an dem
Reize vorübergehen; der kleine Amor zeigt ihm fein Loos, indem er
mühfam die Stelzen zu besteigen verfucht und bei dem Verfuche scheitert;
die rasche Kugel, auf der er fonst einhereiite, liegt achtungslos bei Seite.
Alle diefe Werke entspringen dem Wunfche, den mensehlichen
Körper, und zwar fpeciell den weiblichen, in seiner unverhüllten Schön-
heit darzuftellen. Es ist interessant, wie dies in der künstlerischen Entwick-
lung, sobald die ästhetifche Aussassung der Kunst obliegt, nothwendig
auftretende Bestreben sich erst durchkämpfen und sür die Nacktheit
Gründe zur Geltung bringen muss, gegen die sich nichts einwenden läfst.
Erst wenn sich der neue Gebrauch des Künftlers bei dem Publicum ein-
ackten Frauen. Von Dürer.
(B. 75, Originalgröße.)
gelebt hat, dars es der Künster wagen, von einer Begründung abzufehen
und das Schöne nur um des Schönen willen darzustellen. Freilich liegt
dann die Gesahr nahe, dass ein lüfternes Element allmählich in die Dar-
ftellung tritt, was der wirklich ästhetifchen Kunft ferne liegt. In Italien
ist es vor allem die antike Welt, die zu Hilse genommen wird, und noch
als Tizian sogar Porträtsiguren In voller Nacktheit darstellte, erfchien es
als die einsachste Losung, diefe Werke als Darftellungen der Venus zu
bezeichnen. Der deutsehe Künstler greift auch in die Antike; aber auch
die eigene Weltanfchauung bietet ihm Stofs, nur darf das religiöfe Ele-
ment wie bei den Hesendarftellungen, oder das moralifirende, wie bei
dem Traum und den vier nackten Frauen nicht fehlen. Innerhalb der
Renaisfancezeit erscheint uns in der deutsehen Kunst der Höhepunkt
diefes Proceffcs am deutlichsten bei Dürer« Veit Valentin.
J&L