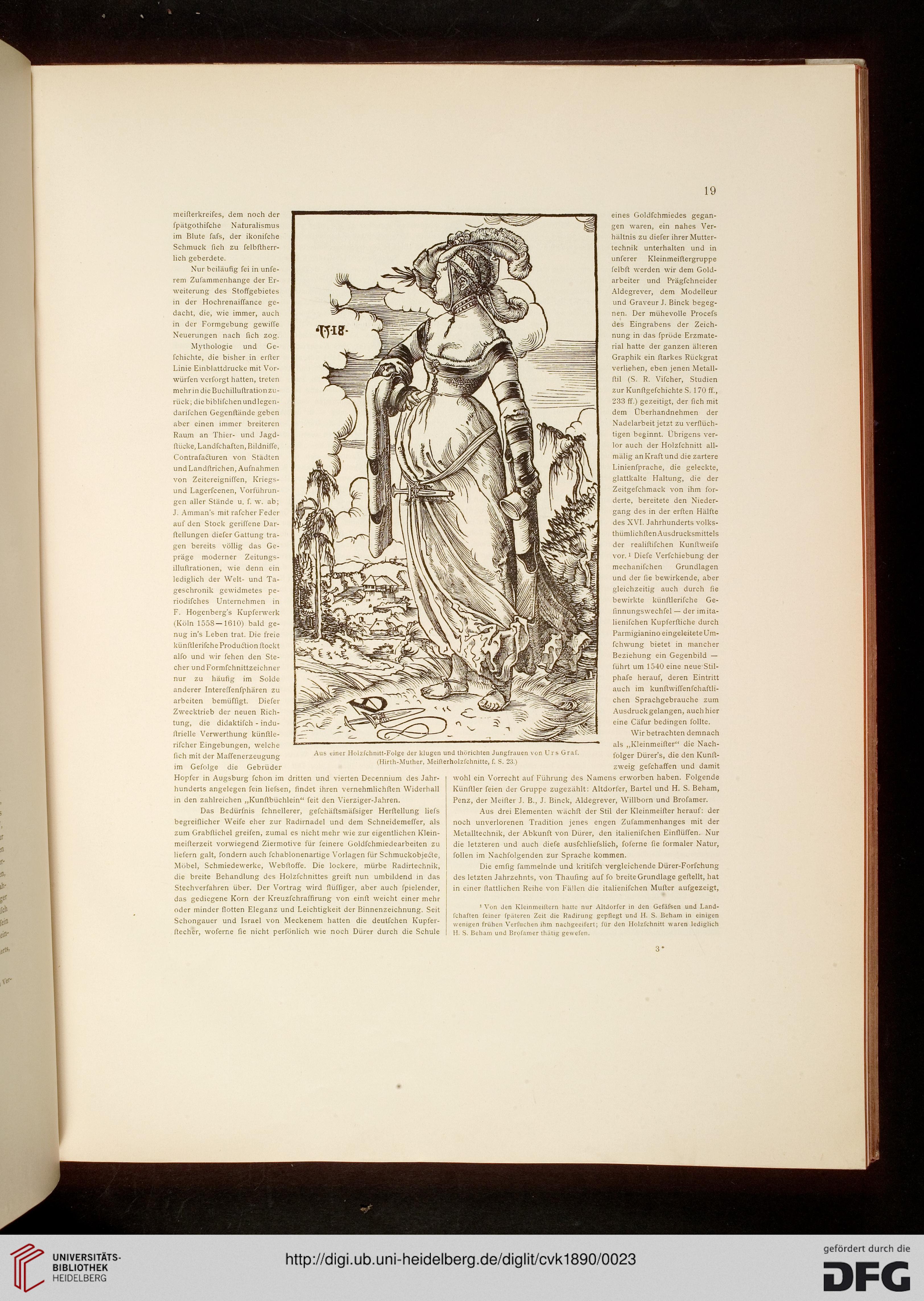19
meisterkreises, dem noch der
spätgothische Naturalismus
im Blute sass, der ikonische
Schmuck sich zu selbstherr-
lich geberdete.
Nur beiläufig sei in unte-
rem Zusammenhange der Er-
weiterung des Stosfgebietes
m der Hochrenaissance ge-
dacht, die, wie immer, auch
in der Formgebung gewilYe
Neuerungen nach sich zog.
Mythologie und Ge-
schi.ch.te, die bisher in erster
Linie Einblattdrucke mit Vor-
würsen versorgt hatten, treten
mehr in die Buchillustration zu-
rück; diebiblischenundlegen-
darischen Gegenstände geben
aber einen immer breiteren
Raum an Thier- und Jagd-
stücke,Landschaften,Bildnisse,
Contrafacfuren von Städten
und Landstrichen, Ausnahmen
von Zeitereignissen, Kriegs-
und Lagerscenen, Vorführun-
gen aller Stände u. s. w. ab;
J. Amman's mit rascher Feder
auf den Stock gerissene Dar-
stellungen dieser Gattung tra-
gen bereits völlig das Ge-
präge moderner Zeitungs-
lllusirationen, wie denn ein
lediglich der Welt- und Ta-
geschronik gewidmetes pe-
riodisches Unternehmen in
F. Hogenberg's Kupserwerk
(Köln 1558-1610) bald ge-
nug in's Leben trat. Die freie
künstlerische Produktion flockt
also und wir sehen den Ste-
cher undFormschnittzeichner
nur zu häusig im Solde
anderer Interessenspharen zu
arbeiten bemüssigt. Dieser
Zwecktrieb der neuen Rich-
tung, die didaktisch - indu-
strielle Verwerthung künstle-
rischer Eingebungen, welche
sich mit der Massenerzeugung
im Gesolge die Gebrüder
Hopfer in Augsburg schon im dritten und vierten Decennium des Jahr-
hunderts angelegen sein liessen, findet ihren vernehmlichsten Widerhall
in den zahlreichen „Kunstbüchlein" seit den Vierziger-Jahren.
Das Bedürfnis schnellerer, geschäftsmässiger Herstellung liess
begreislicher Weise eher zur Radirnadel und dem Schneidemesser, als
zum Grabstichel greisen, zumal es nicht mehr wie zur eigentlichen Klein-
meisterzeit vorwiegend Ziermotive für feinere Goldschmiedearbeiten zu
liefern galt, sondern auch schablonenartige Vorlagen sür Schmuckobjecte,
Möbel, Schmiedewerke, Webstofse, Die lockere, mürbe Radirtechnik,
die breite Behandlung des Holzschnittes greist nun umbildend in das
Stechversahren über. Der Vortrag wird fiüssiger, aber auch spielender,
das gediegene Korn der Kreuzschrasfirung von einst weicht einer mehr
oder minder flotten Eleganz und Leichtigkeit der Binnenzeichnung. Seit
Schongauer und Israel von Meckenem hatten die deutsehen Kupfer-
stecher, woserne sie nicht persönlich wie noch Dürer durch die Schule
;iner Holzlehnitt-Folge der klugen und thurichten Jungfra
(Hirth-Mulher, Meisserholzschmtte, s. S. 23.)
eines Goldscbmiedes gegan-
gen waren, ein nahes Ver-
hältnis zu dieser ihrer Mutter-
technik unterhalten und in
unserer Kleinmeistergruppe
selbst werden wir dem Gold-
arbeiter und Prägsehneider
Aldegrever, dem Modelleur
und Graveur J. Binck begeg-
nen. Der mühevolle Process
des Eingrabens der Zeich-
nung in das sprode Erzmate-
rial hatte der ganzen älteren
Graphik ein starkes Rückgrat
verliehen, eben jenen Metall-
stil (S. R. Vischer, Studien
zur Kunftgeschichte S. 170 sf.,
233 fs.) gezeitigt, der sich mit
dem Überhandnehmen der
Nadelarbeit jetzt zu verslüch-
tigen beginnt. Übrigens ver-
lor auch der Holzschnitt all-
mälig an Kraft und die zartere
Liniensprache, die geleckte,
glattkalte Haltung, die der
Zeitgeschmack von ihm sor-
derte, bereitete den Nieder-
gang des in der ersten Hälfte
des XVI. Jahrhunderts volks-
thümüchsten Ausdrucksmittels
der realistischen Kunssweise
vor.1 Diese Verschiebung der
mechanischen Grundlagen
und der sie bewirkende, aber
gleichzeitig auch durch sie
bewirkte künstlerische Ge-
sinnungswechsel — der lmita-
lienischen Kupsersüche durch
Parmigianino eingeleiteteUm-
schwung bietet in mancher
Beziehung ein Gegenbild —
sührt um 1540 eine neueStü-
phase herauf, deren Eintritt
auch im kunstwissenschastli-
chen Sprachgebrauche zum
Ausdruck gelangen, auch hier
eine Cäsur bedingen sollte.
Wir betrachten demnach
als „Kleinmeister" die Nach-
folger Dürer's, die den Kunst-
zweig geschasfen und damit
wohl ein Vorrecht auf Führung des Namens erworben haben. Folgende
Künstler seien der Gruppe zugezählt: Altdorfer, Bartel und H. S. Beham,
Penz, der Meister J. B., J. Binck, Aldegrever, Willborn und Brosamer.
Aus drei Elementen wächst der Stil der Kleinmeister herauf: der
noch unverlorenen Tradition jenes engen Zusammenhanges mit der
Metalltechnik, der Abkunft von Dürer, den italienischen Einflüssen, Nur
die letzteren und auch diese ausschliesslich, soserne sie formaler Natur,
sollen im Nachfolgenden zur Sprache kommen.
Die emsig sammelnde und kritisch vergleichende Dürer-Forschung
des letzten Jahrzehnts, von Thausing auf so breite Grundlage gestellt, hat
in einer fiattlichen Reihe von Fällen die italienischen Muster aufgezeigt,
1 Von den Klemm elstem hatte nur Altdorser in den Gesässen und Land-
schasten seiner spateren Zeit die Radirung gepssegt und H. S. Beham in einigen
wenigen srühen Versuchen Ihm nachgeeifert; für den Holzschnitt waren lediglich
H. S. Beham und Brosamer thätig gewesen.
meisterkreises, dem noch der
spätgothische Naturalismus
im Blute sass, der ikonische
Schmuck sich zu selbstherr-
lich geberdete.
Nur beiläufig sei in unte-
rem Zusammenhange der Er-
weiterung des Stosfgebietes
m der Hochrenaissance ge-
dacht, die, wie immer, auch
in der Formgebung gewilYe
Neuerungen nach sich zog.
Mythologie und Ge-
schi.ch.te, die bisher in erster
Linie Einblattdrucke mit Vor-
würsen versorgt hatten, treten
mehr in die Buchillustration zu-
rück; diebiblischenundlegen-
darischen Gegenstände geben
aber einen immer breiteren
Raum an Thier- und Jagd-
stücke,Landschaften,Bildnisse,
Contrafacfuren von Städten
und Landstrichen, Ausnahmen
von Zeitereignissen, Kriegs-
und Lagerscenen, Vorführun-
gen aller Stände u. s. w. ab;
J. Amman's mit rascher Feder
auf den Stock gerissene Dar-
stellungen dieser Gattung tra-
gen bereits völlig das Ge-
präge moderner Zeitungs-
lllusirationen, wie denn ein
lediglich der Welt- und Ta-
geschronik gewidmetes pe-
riodisches Unternehmen in
F. Hogenberg's Kupserwerk
(Köln 1558-1610) bald ge-
nug in's Leben trat. Die freie
künstlerische Produktion flockt
also und wir sehen den Ste-
cher undFormschnittzeichner
nur zu häusig im Solde
anderer Interessenspharen zu
arbeiten bemüssigt. Dieser
Zwecktrieb der neuen Rich-
tung, die didaktisch - indu-
strielle Verwerthung künstle-
rischer Eingebungen, welche
sich mit der Massenerzeugung
im Gesolge die Gebrüder
Hopfer in Augsburg schon im dritten und vierten Decennium des Jahr-
hunderts angelegen sein liessen, findet ihren vernehmlichsten Widerhall
in den zahlreichen „Kunstbüchlein" seit den Vierziger-Jahren.
Das Bedürfnis schnellerer, geschäftsmässiger Herstellung liess
begreislicher Weise eher zur Radirnadel und dem Schneidemesser, als
zum Grabstichel greisen, zumal es nicht mehr wie zur eigentlichen Klein-
meisterzeit vorwiegend Ziermotive für feinere Goldschmiedearbeiten zu
liefern galt, sondern auch schablonenartige Vorlagen sür Schmuckobjecte,
Möbel, Schmiedewerke, Webstofse, Die lockere, mürbe Radirtechnik,
die breite Behandlung des Holzschnittes greist nun umbildend in das
Stechversahren über. Der Vortrag wird fiüssiger, aber auch spielender,
das gediegene Korn der Kreuzschrasfirung von einst weicht einer mehr
oder minder flotten Eleganz und Leichtigkeit der Binnenzeichnung. Seit
Schongauer und Israel von Meckenem hatten die deutsehen Kupfer-
stecher, woserne sie nicht persönlich wie noch Dürer durch die Schule
;iner Holzlehnitt-Folge der klugen und thurichten Jungfra
(Hirth-Mulher, Meisserholzschmtte, s. S. 23.)
eines Goldscbmiedes gegan-
gen waren, ein nahes Ver-
hältnis zu dieser ihrer Mutter-
technik unterhalten und in
unserer Kleinmeistergruppe
selbst werden wir dem Gold-
arbeiter und Prägsehneider
Aldegrever, dem Modelleur
und Graveur J. Binck begeg-
nen. Der mühevolle Process
des Eingrabens der Zeich-
nung in das sprode Erzmate-
rial hatte der ganzen älteren
Graphik ein starkes Rückgrat
verliehen, eben jenen Metall-
stil (S. R. Vischer, Studien
zur Kunftgeschichte S. 170 sf.,
233 fs.) gezeitigt, der sich mit
dem Überhandnehmen der
Nadelarbeit jetzt zu verslüch-
tigen beginnt. Übrigens ver-
lor auch der Holzschnitt all-
mälig an Kraft und die zartere
Liniensprache, die geleckte,
glattkalte Haltung, die der
Zeitgeschmack von ihm sor-
derte, bereitete den Nieder-
gang des in der ersten Hälfte
des XVI. Jahrhunderts volks-
thümüchsten Ausdrucksmittels
der realistischen Kunssweise
vor.1 Diese Verschiebung der
mechanischen Grundlagen
und der sie bewirkende, aber
gleichzeitig auch durch sie
bewirkte künstlerische Ge-
sinnungswechsel — der lmita-
lienischen Kupsersüche durch
Parmigianino eingeleiteteUm-
schwung bietet in mancher
Beziehung ein Gegenbild —
sührt um 1540 eine neueStü-
phase herauf, deren Eintritt
auch im kunstwissenschastli-
chen Sprachgebrauche zum
Ausdruck gelangen, auch hier
eine Cäsur bedingen sollte.
Wir betrachten demnach
als „Kleinmeister" die Nach-
folger Dürer's, die den Kunst-
zweig geschasfen und damit
wohl ein Vorrecht auf Führung des Namens erworben haben. Folgende
Künstler seien der Gruppe zugezählt: Altdorfer, Bartel und H. S. Beham,
Penz, der Meister J. B., J. Binck, Aldegrever, Willborn und Brosamer.
Aus drei Elementen wächst der Stil der Kleinmeister herauf: der
noch unverlorenen Tradition jenes engen Zusammenhanges mit der
Metalltechnik, der Abkunft von Dürer, den italienischen Einflüssen, Nur
die letzteren und auch diese ausschliesslich, soserne sie formaler Natur,
sollen im Nachfolgenden zur Sprache kommen.
Die emsig sammelnde und kritisch vergleichende Dürer-Forschung
des letzten Jahrzehnts, von Thausing auf so breite Grundlage gestellt, hat
in einer fiattlichen Reihe von Fällen die italienischen Muster aufgezeigt,
1 Von den Klemm elstem hatte nur Altdorser in den Gesässen und Land-
schasten seiner spateren Zeit die Radirung gepssegt und H. S. Beham in einigen
wenigen srühen Versuchen Ihm nachgeeifert; für den Holzschnitt waren lediglich
H. S. Beham und Brosamer thätig gewesen.