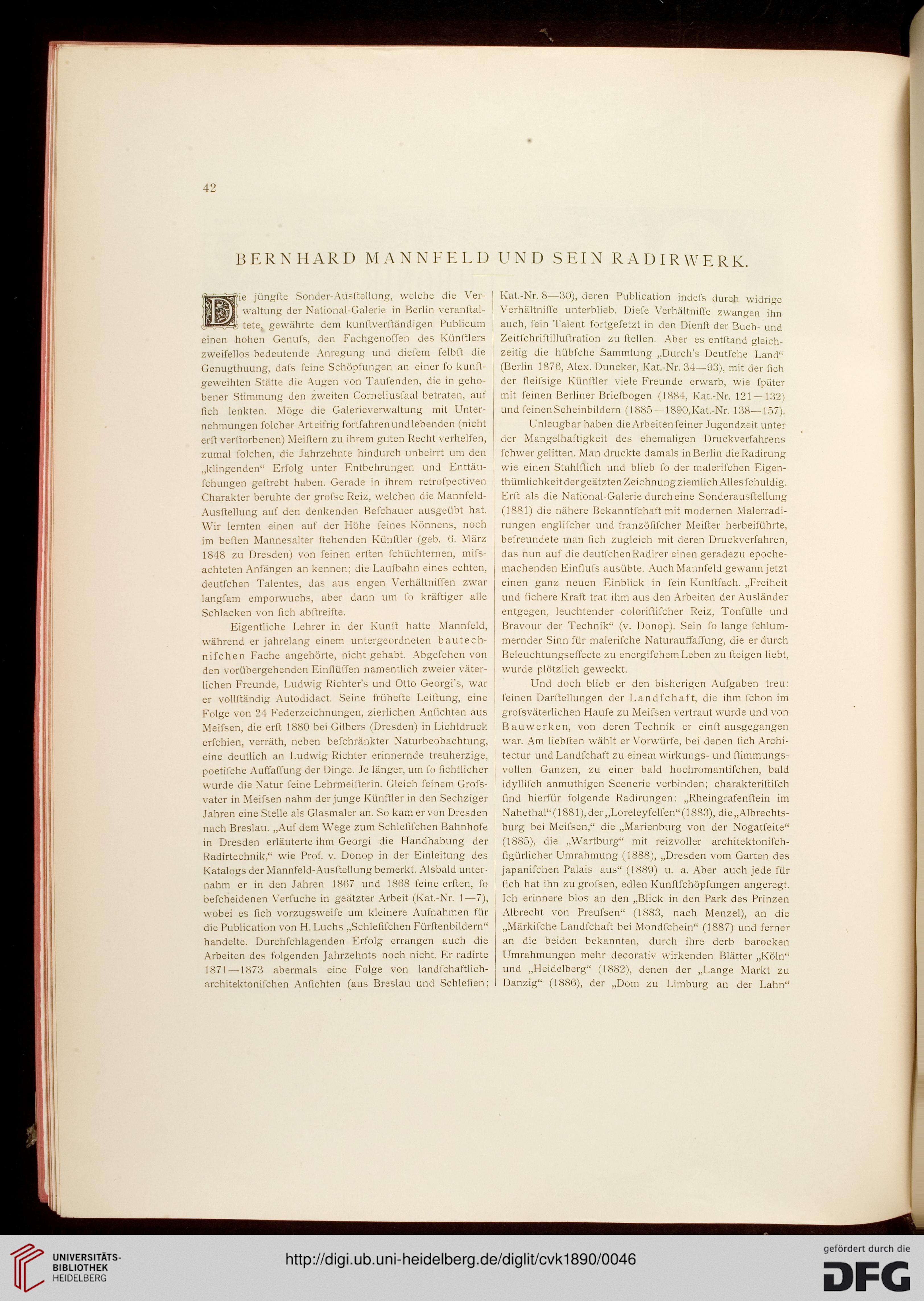42
BERNHARD MANNFELD UND SEIN RADIRWERK.
?ie jüngste Sonder-Aüsstellung, welche die Ver-
waltung der National-Galerie in Berlin veranstal-
tete,_ gewährte dem kunstverständigen Publicum
einen hohen Genuss, den Fachgenossen des Künstlers
zweifellos bedeutende Anregung und diesem selbst die
Genugthuung, dass seine Schöpfungen an einer so kunst-
geweihten Stätte die Augen von Tausenden, die in geho-
bener Stimmung den zweiten Corneliussaal betraten, auf
sseh lenkten. Möge die Galerieverwaltung mit Unter-
nehmungen solcher Arteifrig fortfahrenundlebenden (nicht
erst verstorbenen) Meistern zu ihrem guten Recht verhelfen,
zumal solchen, die Jahrzehnte hindurch unbeirrt um den
„klingenden" Erfolg unter Entbehrungen und Enttäu-
schungen gestrebt haben. Gerade in ihrem retrospectiven
Charakter beruhte der grosse Reiz, welchen die Mannfeld-
Ausstellung auf den denkenden Beschauer ausgeübt hat.
Wir lernten einen auf der Höhe seines Könnens, noch
im besten Mannesalter slehenden Künstler (geb. 6. März
1848 zu Dresden) von seinen ersten schüchternen, miss-
achteten Anfängen an kennen; die Laufbahn eines echten,
deutsehen Talentes, das aus engen Verhältnissen zwar
langsam emporwuchs, aber dann um so kräftiger alle
Schlacken von (ich abstreifte.
Eigentliche Lehrer in der Kunst hatte Mannfeld,
während er jahrelang einem untergeordneten bautech-
nischen Fache angehörte, nicht gehabt. Abgesehen von
den vorübergehenden Einflüssen namentlich zweier väter-
lichen Freunde, Ludwig Richters und Otto Georgi's, war
er vollständig Autodidact. Seine früheste Leistung, eine
Folge von 24 Federzeichnungen, zierlichen Anslehten aus
Meissen, die erst 1880 bei Gilbers (Dresden) in Lichtdruck
erschien, verräth, neben beschränkter Naturbeobachtung,
eine deutlich an Ludwig Richter erinnernde treuherzige,
poetische Auffasfung der Dinge. Je länger, um so sichtlicher
wurde die Natur seine Lehrmeisterin. Gleich seinem Gross-
vater in Meissen nahm der junge Künstler in den Sechziger
Jahren eine Stelle als Glasmaler an. So kam er von Dresden
nach Breslau. „Auf dem Wege zum Schlesischen Bahnhofe
in Dresden erläuterte ihm Georgi die Handhabung der
Radirtechnik," wie Prof. v. Donop in der Einleitung des
Katalogs der Mannfeld-Ausstellung bemerkt. Alsbald unter-
nahm er in den Jahren 1867 und 1868 seine ersten, so
bescheidenen Versuche in geätzter Arbeit ("Kat.-Nr. 1—7),
wobei es sicti vorzugsweise um kleinere Aufnahmen für
die Publication von H. Luchs „Schlesischen Fürstenbildern"
handelte. Durchschlagenden Erfolg errangen auch die
Arbeiten des folgenden Jahrzehnts noch nicht. Er radirte
1871 —1873 abermals eine Folge von landschaftlich-
architektonischen Anslehten (aus Breslau und Schlesien;
Kat.-Nr. 8-—30), deren Publication indess durch widrige
Verhältnisse unterblieb. Diese Verhältnisse zwangen ihn
auch, sein Talent fortgesetzt in den Dienst der Buch- und
Zeitschriftillustration zu stellen. Aber es entstand gleich-
zeitig die hübsehe Sammlung „Durch's Deutsche Land"
(Berlin 1876, Alex. Duncker, Kat.-Nr. 34—93), mit der sseh
der fleissige Künstler viele Freunde erwarb, wie später
mit seinen Berliner Briefbogen (1884, Kat.-Nr. 121 — 132)
und seinenScheinbildern (1885 —1890,Kat.-Nr. 138—157).
Unleugbar haben die Arbeiten seiner Jugendzeit unter
der Mangelhaftigkeit des ehemaligen Druckverfahrens
schwer gelitten. Man druckte damals in Berlin dieRadirung
wie einen Stahlstich und blieb so der malerischen Eigen-
thümlichkeitdergeätzten Zeichnungziemlich Alles schuldig.
Erst als die National-Galerie durch eine Sonderausstellung
(1881) die nähere Bekanntschaft mit modernen Malerradi-
rungen englischer und französischer Meister herbeiführte,
befreundete man sich zugleich mit deren Druckverfahren,
das nun auf die deutsehenRadirer einen geradezu epoche-
machenden Einfluss ausübte. Auch Mannfeld gewann jetzt
einen ganz neuen Einblick in sein Kunstfach. „Freiheit
und sichere Kraft trat ihm aus den Arbeiten der Ausländer
entgegen, leuchtender coloristischer Reiz, Tonfülle und
Bravour der Technik" (v. Donop). Sein so lange schlum-
mernder Sinn für malerische Naturauffassung, die er durch
Beleuchtungseffecte zu energischem Leben zu steigen liebt,
wurde plötzlich geweckt.
Und doch blieb er den bisherigen Aufgaben treu:
seinen Darstellungen der Landschaft, die ihm schon im
grossväterlichen Hause zu Meissen vertraut wurde und von
Bauwerken, von deren Technik er einst ausgegangen
war. Am liebsten wählt er Vorwürfe, bei denen sich Archi-
tectur und Landschaft zu einem wirkungs- und stimmungs-
vollen Ganzen, zu einer bald hochromantischen, bald
idyllisch anmuthigen Scenerie verbinden; charakteristisch
sind hierfür folgende Radirungen: „Rheingrafenstein im
Nahethal" (1881), der „Loreleyfelsen"( 1883), die „Albrechts-
burg bei Meissen," die „Marienburg von der Nogatseite"
(1885), die „Wartburg" mit reizvoller architektonisch-
figürlicher Umrahmung (1888), „Dresden vom Garten des
japanischen Palais aus" (1889) u. a. Aber auch jede für
sich hat ihn zu grossen, edlen Kunstschöpfungen angeregt.
Ich erinnere blos an den „Blick in den Park des Prinzen
Albrecht von Preussen" (1883, nach Menzel), an die
„Märkische Landschaft bei Mondschein" (1887) und ferner
an die beiden bekannten, durch ihre derb barocken
Umrahmungen mehr decorativ wirkenden Blätter „Köln"
und „Heidelberg" (1882), denen der „Lange Markt zu
Danzig" (1886), der „Dom zu Limburg an der Lahn"
^^H^IH^^IBMBI^H^^^^ss^^H^BMB^^H
■
BERNHARD MANNFELD UND SEIN RADIRWERK.
?ie jüngste Sonder-Aüsstellung, welche die Ver-
waltung der National-Galerie in Berlin veranstal-
tete,_ gewährte dem kunstverständigen Publicum
einen hohen Genuss, den Fachgenossen des Künstlers
zweifellos bedeutende Anregung und diesem selbst die
Genugthuung, dass seine Schöpfungen an einer so kunst-
geweihten Stätte die Augen von Tausenden, die in geho-
bener Stimmung den zweiten Corneliussaal betraten, auf
sseh lenkten. Möge die Galerieverwaltung mit Unter-
nehmungen solcher Arteifrig fortfahrenundlebenden (nicht
erst verstorbenen) Meistern zu ihrem guten Recht verhelfen,
zumal solchen, die Jahrzehnte hindurch unbeirrt um den
„klingenden" Erfolg unter Entbehrungen und Enttäu-
schungen gestrebt haben. Gerade in ihrem retrospectiven
Charakter beruhte der grosse Reiz, welchen die Mannfeld-
Ausstellung auf den denkenden Beschauer ausgeübt hat.
Wir lernten einen auf der Höhe seines Könnens, noch
im besten Mannesalter slehenden Künstler (geb. 6. März
1848 zu Dresden) von seinen ersten schüchternen, miss-
achteten Anfängen an kennen; die Laufbahn eines echten,
deutsehen Talentes, das aus engen Verhältnissen zwar
langsam emporwuchs, aber dann um so kräftiger alle
Schlacken von (ich abstreifte.
Eigentliche Lehrer in der Kunst hatte Mannfeld,
während er jahrelang einem untergeordneten bautech-
nischen Fache angehörte, nicht gehabt. Abgesehen von
den vorübergehenden Einflüssen namentlich zweier väter-
lichen Freunde, Ludwig Richters und Otto Georgi's, war
er vollständig Autodidact. Seine früheste Leistung, eine
Folge von 24 Federzeichnungen, zierlichen Anslehten aus
Meissen, die erst 1880 bei Gilbers (Dresden) in Lichtdruck
erschien, verräth, neben beschränkter Naturbeobachtung,
eine deutlich an Ludwig Richter erinnernde treuherzige,
poetische Auffasfung der Dinge. Je länger, um so sichtlicher
wurde die Natur seine Lehrmeisterin. Gleich seinem Gross-
vater in Meissen nahm der junge Künstler in den Sechziger
Jahren eine Stelle als Glasmaler an. So kam er von Dresden
nach Breslau. „Auf dem Wege zum Schlesischen Bahnhofe
in Dresden erläuterte ihm Georgi die Handhabung der
Radirtechnik," wie Prof. v. Donop in der Einleitung des
Katalogs der Mannfeld-Ausstellung bemerkt. Alsbald unter-
nahm er in den Jahren 1867 und 1868 seine ersten, so
bescheidenen Versuche in geätzter Arbeit ("Kat.-Nr. 1—7),
wobei es sicti vorzugsweise um kleinere Aufnahmen für
die Publication von H. Luchs „Schlesischen Fürstenbildern"
handelte. Durchschlagenden Erfolg errangen auch die
Arbeiten des folgenden Jahrzehnts noch nicht. Er radirte
1871 —1873 abermals eine Folge von landschaftlich-
architektonischen Anslehten (aus Breslau und Schlesien;
Kat.-Nr. 8-—30), deren Publication indess durch widrige
Verhältnisse unterblieb. Diese Verhältnisse zwangen ihn
auch, sein Talent fortgesetzt in den Dienst der Buch- und
Zeitschriftillustration zu stellen. Aber es entstand gleich-
zeitig die hübsehe Sammlung „Durch's Deutsche Land"
(Berlin 1876, Alex. Duncker, Kat.-Nr. 34—93), mit der sseh
der fleissige Künstler viele Freunde erwarb, wie später
mit seinen Berliner Briefbogen (1884, Kat.-Nr. 121 — 132)
und seinenScheinbildern (1885 —1890,Kat.-Nr. 138—157).
Unleugbar haben die Arbeiten seiner Jugendzeit unter
der Mangelhaftigkeit des ehemaligen Druckverfahrens
schwer gelitten. Man druckte damals in Berlin dieRadirung
wie einen Stahlstich und blieb so der malerischen Eigen-
thümlichkeitdergeätzten Zeichnungziemlich Alles schuldig.
Erst als die National-Galerie durch eine Sonderausstellung
(1881) die nähere Bekanntschaft mit modernen Malerradi-
rungen englischer und französischer Meister herbeiführte,
befreundete man sich zugleich mit deren Druckverfahren,
das nun auf die deutsehenRadirer einen geradezu epoche-
machenden Einfluss ausübte. Auch Mannfeld gewann jetzt
einen ganz neuen Einblick in sein Kunstfach. „Freiheit
und sichere Kraft trat ihm aus den Arbeiten der Ausländer
entgegen, leuchtender coloristischer Reiz, Tonfülle und
Bravour der Technik" (v. Donop). Sein so lange schlum-
mernder Sinn für malerische Naturauffassung, die er durch
Beleuchtungseffecte zu energischem Leben zu steigen liebt,
wurde plötzlich geweckt.
Und doch blieb er den bisherigen Aufgaben treu:
seinen Darstellungen der Landschaft, die ihm schon im
grossväterlichen Hause zu Meissen vertraut wurde und von
Bauwerken, von deren Technik er einst ausgegangen
war. Am liebsten wählt er Vorwürfe, bei denen sich Archi-
tectur und Landschaft zu einem wirkungs- und stimmungs-
vollen Ganzen, zu einer bald hochromantischen, bald
idyllisch anmuthigen Scenerie verbinden; charakteristisch
sind hierfür folgende Radirungen: „Rheingrafenstein im
Nahethal" (1881), der „Loreleyfelsen"( 1883), die „Albrechts-
burg bei Meissen," die „Marienburg von der Nogatseite"
(1885), die „Wartburg" mit reizvoller architektonisch-
figürlicher Umrahmung (1888), „Dresden vom Garten des
japanischen Palais aus" (1889) u. a. Aber auch jede für
sich hat ihn zu grossen, edlen Kunstschöpfungen angeregt.
Ich erinnere blos an den „Blick in den Park des Prinzen
Albrecht von Preussen" (1883, nach Menzel), an die
„Märkische Landschaft bei Mondschein" (1887) und ferner
an die beiden bekannten, durch ihre derb barocken
Umrahmungen mehr decorativ wirkenden Blätter „Köln"
und „Heidelberg" (1882), denen der „Lange Markt zu
Danzig" (1886), der „Dom zu Limburg an der Lahn"
^^H^IH^^IBMBI^H^^^^ss^^H^BMB^^H
■