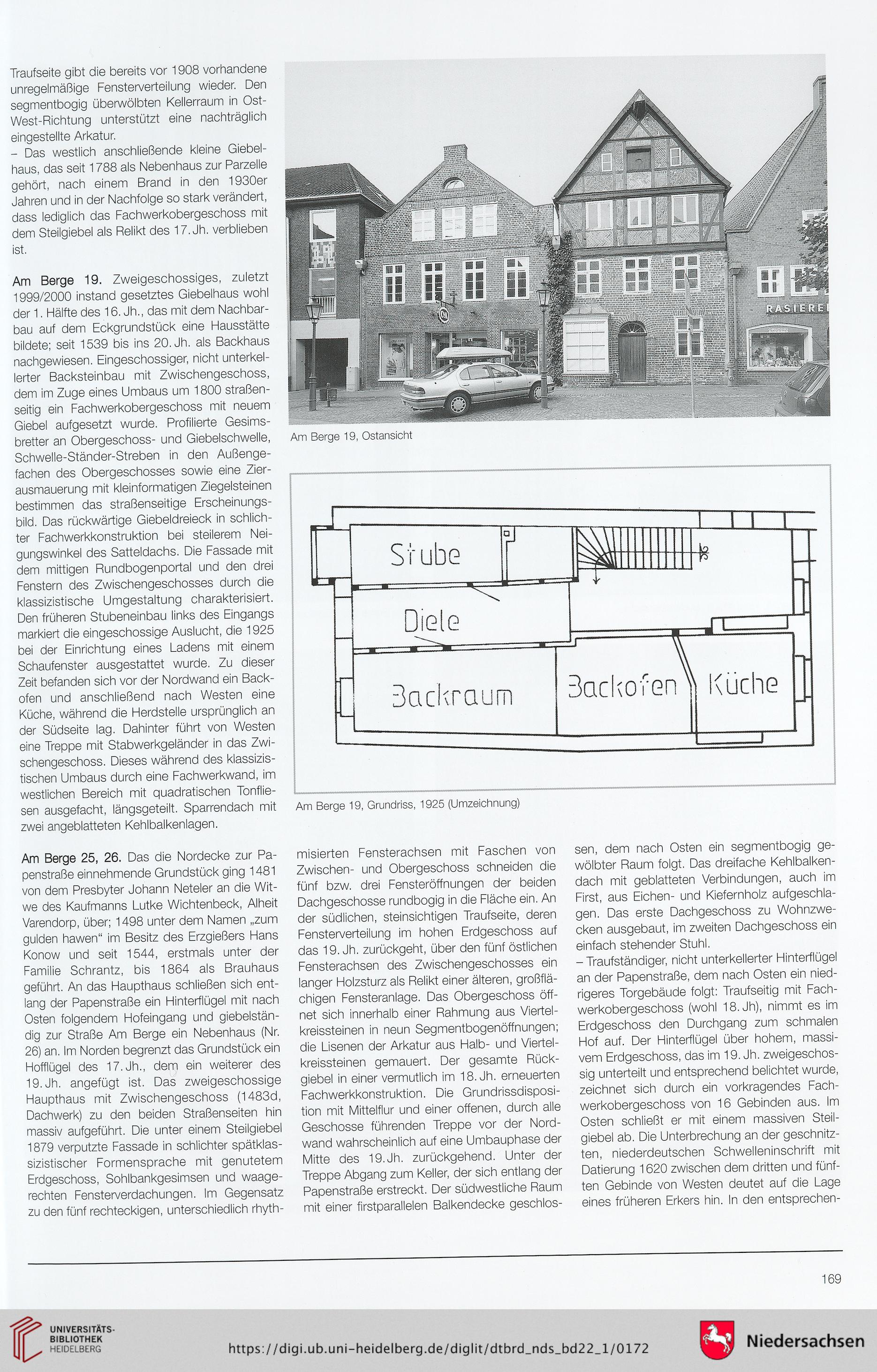Traufseite gibt die bereits vor 1908 vorhandene
unregelmäßige Fensterverteilung wieder. Den
segmentbogig überwölbten Kellerraum in Ost-
West-Richtung unterstützt eine nachträglich
eingestellte Arkatur.
- Das westlich anschließende kleine Giebel-
haus, das seit 1788 als Nebenhaus zur Parzelle
gehört, nach einem Brand in den 1930er
Jahren und in der Nachfolge so stark verändert,
dass lediglich das Fachwerkobergeschoss mit
dem Steilgiebel als Relikt des 17.Jh. verblieben
ist.
Am Berge 19. Zweigeschossiges, zuletzt
1999/2000 instand gesetztes Giebelhaus wohl
der 1. Hälfte des 16. Jh., das mit dem Nachbar-
bau auf dem Eckgrundstück eine Hausstätte
bildete; seit 1539 bis ins 20. Jh. als Backhaus
nachgewiesen. Eingeschossiger, nicht unterkel-
lerter Backsteinbau mit Zwischengeschoss,
dem im Zuge eines Umbaus um 1800 straßen-
seitig ein Fachwerkobergeschoss mit neuem
Giebel aufgesetzt wurde. Profilierte Gesims-
bretter an Obergeschoss- und Giebelschwelle,
Schwelle-Ständer-Streben in den Außenge-
fachen des Obergeschosses sowie eine Zier-
ausmauerung mit kleinformatigen Ziegelsteinen
bestimmen das straßenseitige Erscheinungs-
bild. Das rückwärtige Giebeldreieck in schlich-
ter Fachwerkkonstruktion bei steilerem Nei-
gungswinkel des Satteldachs. Die Fassade mit
dem mittigen Rundbogenportal und den drei
Fenstern des Zwischengeschosses durch die
klassizistische Umgestaltung charakterisiert.
Den früheren Stubeneinbau links des Eingangs
markiert die eingeschossige Auslucht, die 1925
bei der Einrichtung eines Ladens mit einem
Schaufenster ausgestattet wurde. Zu dieser
Zeit befanden sich vor der Nordwand ein Back-
ofen und anschließend nach Westen eine
Küche, während die Herdstelle ursprünglich an
der Südseite lag. Dahinter führt von Westen
eine Treppe mit Stabwerkgeländer in das Zwi-
schengeschoss. Dieses während des klassizis-
tischen Umbaus durch eine Fachwerkwand, im
westlichen Bereich mit quadratischen Tonflie-
sen ausgefacht, längsgeteilt. Sparrendach mit
zwei angeblatteten Kehlbalkenlagen.
Am Berge 19, Ostansicht
Am Berge 25, 26. Das die Nordecke zur Pa-
penstraße einnehmende Grundstück ging 1481
von dem Presbyter Johann Neteler an die Wit-
we des Kaufmanns Lutke Wichtenbeck, Alheit
Varendorp, über; 1498 unter dem Namen „zum
gülden hawen“ im Besitz des Erzgießers Hans
Konow und seit 1544, erstmals unter der
Familie Schrantz, bis 1864 als Brauhaus
geführt. An das Haupthaus schließen sich ent-
lang der Papenstraße ein Hinterflügel mit nach
Osten folgendem Hofeingang und giebelstän-
dig zur Straße Am Berge ein Nebenhaus (Nr.
26) an. Im Norden begrenzt das Grundstück ein
Hofflügel des 17. Jh., dem ein weiterer des
19. Jh. angefügt ist. Das zweigeschossige
Haupthaus mit Zwischengeschoss (1483d,
Dachwerk) zu den beiden Straßenseiten hin
massiv aufgeführt. Die unter einem Steilgiebel
1879 verputzte Fassade in schlichter spätklas-
sizistischer Formensprache mit genutetem
Erdgeschoss, Sohlbankgesimsen und waage-
rechten Fensterverdachungen. Im Gegensatz
zu den fünf rechteckigen, unterschiedlich rhyth-
misierten Fensterachsen mit Faschen von
Zwischen- und Obergeschoss schneiden die
fünf bzw. drei Fensteröffnungen der beiden
Dachgeschosse rundbogig in die Fläche ein. An
der südlichen, steinsichtigen Traufseite, deren
Fensterverteilung im hohen Erdgeschoss auf
das 19. Jh. zurückgeht, über den fünf östlichen
Fensterachsen des Zwischengeschosses ein
langer Holzsturz als Relikt einer älteren, großflä-
chigen Fensteranlage. Das Obergeschoss öff-
net sich innerhalb einer Rahmung aus Viertel-
kreissteinen in neun Segmentbogenöffnungen;
die Lisenen der Arkatur aus Halb- und Viertel-
kreissteinen gemauert. Der gesamte Rück-
giebel in einer vermutlich im 18. Jh. erneuerten
Fachwerkkonstruktion. Die Grundrissdisposi-
tion mit Mittelflur und einer offenen, durch alle
Geschosse führenden Treppe vor der Nord-
wand wahrscheinlich auf eine Umbauphase der
Mitte des 19.Jh. zurückgehend. Unter der
Treppe Abgang zum Keller, der sich entlang der
Papenstraße erstreckt. Der südwestliche Raum
mit einer firstparallelen Balkendecke geschlos-
sen, dem nach Osten ein segmentbogig ge-
wölbter Raum folgt. Das dreifache Kehlbalken-
dach mit geblatteten Verbindungen, auch im
First, aus Eichen- und Kiefernholz aufgeschla-
gen. Das erste Dachgeschoss zu Wohnzwe-
cken ausgebaut, im zweiten Dachgeschoss ein
einfach stehender Stuhl.
- Traufständiger, nicht unterkellerter Hinterflügel
an der Papenstraße, dem nach Osten ein nied-
rigeres Torgebäude folgt: Traufseitig mit Fach-
werkobergeschoss (wohl 18. Jh), nimmt es im
Erdgeschoss den Durchgang zum schmalen
Hof auf. Der Hinterflügel über hohem, massi-
vem Erdgeschoss, das im 19. Jh. zweigeschos-
sig unterteilt und entsprechend belichtet wurde,
zeichnet sich durch ein vorkragendes Fach-
werkobergeschoss von 16 Gebinden aus. Im
Osten schließt er mit einem massiven Steil-
giebel ab. Die Unterbrechung an der geschnitz-
ten, niederdeutschen Schwelleninschrift mit
Datierung 1620 zwischen dem dritten und fünf-
ten Gebinde von Westen deutet auf die Lage
eines früheren Erkers hin. In den entsprechen-
169
unregelmäßige Fensterverteilung wieder. Den
segmentbogig überwölbten Kellerraum in Ost-
West-Richtung unterstützt eine nachträglich
eingestellte Arkatur.
- Das westlich anschließende kleine Giebel-
haus, das seit 1788 als Nebenhaus zur Parzelle
gehört, nach einem Brand in den 1930er
Jahren und in der Nachfolge so stark verändert,
dass lediglich das Fachwerkobergeschoss mit
dem Steilgiebel als Relikt des 17.Jh. verblieben
ist.
Am Berge 19. Zweigeschossiges, zuletzt
1999/2000 instand gesetztes Giebelhaus wohl
der 1. Hälfte des 16. Jh., das mit dem Nachbar-
bau auf dem Eckgrundstück eine Hausstätte
bildete; seit 1539 bis ins 20. Jh. als Backhaus
nachgewiesen. Eingeschossiger, nicht unterkel-
lerter Backsteinbau mit Zwischengeschoss,
dem im Zuge eines Umbaus um 1800 straßen-
seitig ein Fachwerkobergeschoss mit neuem
Giebel aufgesetzt wurde. Profilierte Gesims-
bretter an Obergeschoss- und Giebelschwelle,
Schwelle-Ständer-Streben in den Außenge-
fachen des Obergeschosses sowie eine Zier-
ausmauerung mit kleinformatigen Ziegelsteinen
bestimmen das straßenseitige Erscheinungs-
bild. Das rückwärtige Giebeldreieck in schlich-
ter Fachwerkkonstruktion bei steilerem Nei-
gungswinkel des Satteldachs. Die Fassade mit
dem mittigen Rundbogenportal und den drei
Fenstern des Zwischengeschosses durch die
klassizistische Umgestaltung charakterisiert.
Den früheren Stubeneinbau links des Eingangs
markiert die eingeschossige Auslucht, die 1925
bei der Einrichtung eines Ladens mit einem
Schaufenster ausgestattet wurde. Zu dieser
Zeit befanden sich vor der Nordwand ein Back-
ofen und anschließend nach Westen eine
Küche, während die Herdstelle ursprünglich an
der Südseite lag. Dahinter führt von Westen
eine Treppe mit Stabwerkgeländer in das Zwi-
schengeschoss. Dieses während des klassizis-
tischen Umbaus durch eine Fachwerkwand, im
westlichen Bereich mit quadratischen Tonflie-
sen ausgefacht, längsgeteilt. Sparrendach mit
zwei angeblatteten Kehlbalkenlagen.
Am Berge 19, Ostansicht
Am Berge 25, 26. Das die Nordecke zur Pa-
penstraße einnehmende Grundstück ging 1481
von dem Presbyter Johann Neteler an die Wit-
we des Kaufmanns Lutke Wichtenbeck, Alheit
Varendorp, über; 1498 unter dem Namen „zum
gülden hawen“ im Besitz des Erzgießers Hans
Konow und seit 1544, erstmals unter der
Familie Schrantz, bis 1864 als Brauhaus
geführt. An das Haupthaus schließen sich ent-
lang der Papenstraße ein Hinterflügel mit nach
Osten folgendem Hofeingang und giebelstän-
dig zur Straße Am Berge ein Nebenhaus (Nr.
26) an. Im Norden begrenzt das Grundstück ein
Hofflügel des 17. Jh., dem ein weiterer des
19. Jh. angefügt ist. Das zweigeschossige
Haupthaus mit Zwischengeschoss (1483d,
Dachwerk) zu den beiden Straßenseiten hin
massiv aufgeführt. Die unter einem Steilgiebel
1879 verputzte Fassade in schlichter spätklas-
sizistischer Formensprache mit genutetem
Erdgeschoss, Sohlbankgesimsen und waage-
rechten Fensterverdachungen. Im Gegensatz
zu den fünf rechteckigen, unterschiedlich rhyth-
misierten Fensterachsen mit Faschen von
Zwischen- und Obergeschoss schneiden die
fünf bzw. drei Fensteröffnungen der beiden
Dachgeschosse rundbogig in die Fläche ein. An
der südlichen, steinsichtigen Traufseite, deren
Fensterverteilung im hohen Erdgeschoss auf
das 19. Jh. zurückgeht, über den fünf östlichen
Fensterachsen des Zwischengeschosses ein
langer Holzsturz als Relikt einer älteren, großflä-
chigen Fensteranlage. Das Obergeschoss öff-
net sich innerhalb einer Rahmung aus Viertel-
kreissteinen in neun Segmentbogenöffnungen;
die Lisenen der Arkatur aus Halb- und Viertel-
kreissteinen gemauert. Der gesamte Rück-
giebel in einer vermutlich im 18. Jh. erneuerten
Fachwerkkonstruktion. Die Grundrissdisposi-
tion mit Mittelflur und einer offenen, durch alle
Geschosse führenden Treppe vor der Nord-
wand wahrscheinlich auf eine Umbauphase der
Mitte des 19.Jh. zurückgehend. Unter der
Treppe Abgang zum Keller, der sich entlang der
Papenstraße erstreckt. Der südwestliche Raum
mit einer firstparallelen Balkendecke geschlos-
sen, dem nach Osten ein segmentbogig ge-
wölbter Raum folgt. Das dreifache Kehlbalken-
dach mit geblatteten Verbindungen, auch im
First, aus Eichen- und Kiefernholz aufgeschla-
gen. Das erste Dachgeschoss zu Wohnzwe-
cken ausgebaut, im zweiten Dachgeschoss ein
einfach stehender Stuhl.
- Traufständiger, nicht unterkellerter Hinterflügel
an der Papenstraße, dem nach Osten ein nied-
rigeres Torgebäude folgt: Traufseitig mit Fach-
werkobergeschoss (wohl 18. Jh), nimmt es im
Erdgeschoss den Durchgang zum schmalen
Hof auf. Der Hinterflügel über hohem, massi-
vem Erdgeschoss, das im 19. Jh. zweigeschos-
sig unterteilt und entsprechend belichtet wurde,
zeichnet sich durch ein vorkragendes Fach-
werkobergeschoss von 16 Gebinden aus. Im
Osten schließt er mit einem massiven Steil-
giebel ab. Die Unterbrechung an der geschnitz-
ten, niederdeutschen Schwelleninschrift mit
Datierung 1620 zwischen dem dritten und fünf-
ten Gebinde von Westen deutet auf die Lage
eines früheren Erkers hin. In den entsprechen-
169