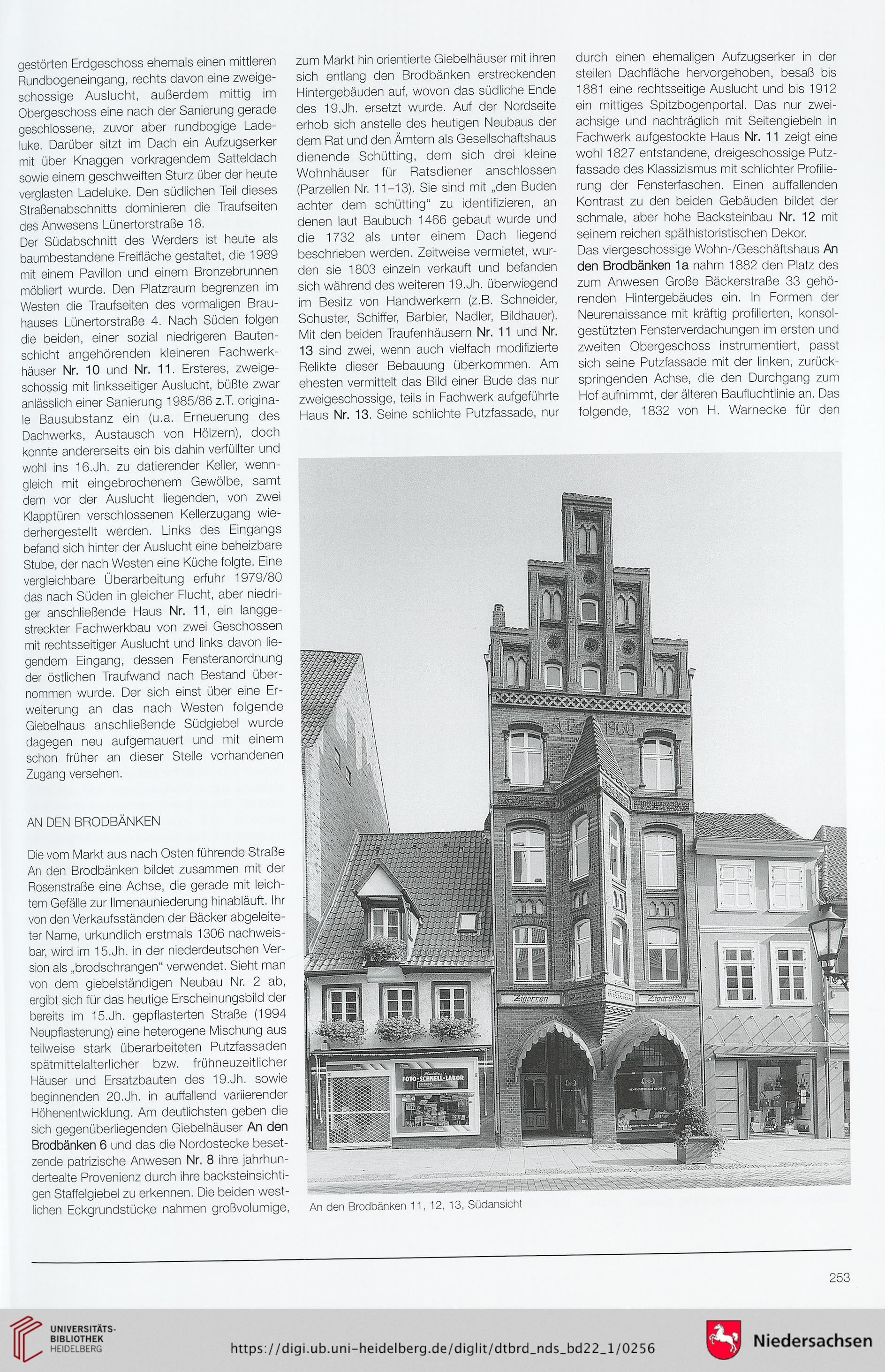gestörten Erdgeschoss ehemals einen mittleren
Rundbogeneingang, rechts davon eine zweige-
schossige Auslucht, außerdem mittig im
Obergeschoss eine nach der Sanierung gerade
geschlossene, zuvor aber rundbogige Lade-
luke. Darüber sitzt im Dach ein Aufzugserker
mit über Knaggen vorkragendem Satteldach
sowie einem geschweiften Sturz über der heute
verglasten Ladeiuke. Den südlichen Teil dieses
Straßenabschnitts dominieren die Traufseiten
des Anwesens Lünertorstraße 18.
Der Südabschnitt des Werders ist heute als
baumbestandene Freifläche gestaltet, die 1989
mit einem Pavillon und einem Bronzebrunnen
möbliert wurde. Den Platzraum begrenzen im
Westen die Traufseiten des vormaligen Brau-
hauses Lünertorstraße 4. Nach Süden folgen
die beiden, einer sozial niedrigeren Bauten-
schicht angehörenden kleineren Fachwerk-
häuser Nr. 10 und Nr. 11. Ersteres, zweige-
schossig mit linksseitiger Auslucht, büßte zwar
anlässlich einer Sanierung 1985/86 z.T. origina-
le Bausubstanz ein (u.a. Erneuerung des
Dachwerks, Austausch von Hölzern), doch
konnte andererseits ein bis dahin verfüllter und
wohl ins 16.Jh. zu datierender Keller, wenn-
gleich mit eingebrochenem Gewölbe, samt
dem vor der Auslucht liegenden, von zwei
Klapptüren verschlossenen Kellerzugang wie-
derhergestellt werden. Links des Eingangs
befand sich hinter der Auslucht eine beheizbare
Stube, der nach Westen eine Küche folgte. Eine
vergleichbare Überarbeitung erfuhr 1979/80
das nach Süden in gleicher Flucht, aber niedri-
ger anschließende Haus Nr. 11, ein langge-
streckter Fachwerkbau von zwei Geschossen
mit rechtsseitiger Auslucht und links davon lie-
gendem Eingang, dessen Fensteranordnung
der östlichen Traufwand nach Bestand über-
nommen wurde. Der sich einst über eine Er-
weiterung an das nach Westen folgende
Giebelhaus anschließende Südgiebel wurde
dagegen neu aufgemauert und mit einem
schon früher an dieser Stelle vorhandenen
Zugang versehen.
AN DEN BRODBÄNKEN
Die vom Markt aus nach Osten führende Straße
An den Brodbänken bildet zusammen mit der
Rosenstraße eine Achse, die gerade mit leich-
tem Gefälle zur llmenauniederung hinabläuft. Ihr
von den Verkaufsständen der Bäcker abgeleite-
ter Name, urkundlich erstmals 1306 nachweis-
bar, wird im 15.Jh. in der niederdeutschen Ver-
sion als „brodschrangen“ verwendet. Sieht man
von dem giebelständigen Neubau Nr. 2 ab,
ergibt sich für das heutige Erscheinungsbild der
bereits im 15.Jh. gepflasterten Straße (1994
Neupflasterung) eine heterogene Mischung aus
teilweise stark überarbeiteten Putzfassaden
spätmittelalterlicher bzw. frühneuzeitlicher
Häuser und Ersatzbauten des 19.Jh. sowie
beginnenden 2O.Jh. in auffallend variierender
Höhenentwicklung. Am deutlichsten geben die
sich gegenüberliegenden Giebelhäuser An den
Brodbänken 6 und das die Nordostecke beset-
zende patrizische Anwesen Nr. 8 ihre jahrhun-
dertealte Provenienz durch ihre backsteinsichti-
gen Staffelgiebel zu erkennen. Die beiden west-
lichen Eckgrundstücke nahmen großvolumige,
zum Markt hin orientierte Giebelhäuser mit ihren
sich entlang den Brodbänken erstreckenden
Hintergebäuden auf, wovon das südliche Ende
des 19.Jh. ersetzt wurde. Auf der Nordseite
erhob sich anstelle des heutigen Neubaus der
dem Rat und den Ämtern als Gesellschaftshaus
dienende Schütting, dem sich drei kleine
Wohnhäuser für Ratsdiener anschlossen
(Parzellen Nr. 11-13). Sie sind mit „den Buden
achter dem schütting“ zu identifizieren, an
denen laut Baubuch 1466 gebaut wurde und
die 1732 als unter einem Dach liegend
beschrieben werden. Zeitweise vermietet, wur-
den sie 1803 einzeln verkauft und befanden
sich während des weiteren 19.Jh. überwiegend
im Besitz von Handwerkern (z.B. Schneider,
Schuster, Schiffer, Barbier, Nadler, Bildhauer).
Mit den beiden Traufenhäusern Nr. 11 und Nr.
13 sind zwei, wenn auch vielfach modifizierte
Relikte dieser Bebauung überkommen. Am
ehesten vermittelt das Bild einer Bude das nur
zweigeschossige, teils in Fachwerk aufgeführte
Haus Nr. 13. Seine schlichte Putzfassade, nur
durch einen ehemaligen Aufzugserker in der
steilen Dachfläche hervorgehoben, besaß bis
1881 eine rechtsseitige Auslucht und bis 1912
ein mittiges Spitzbogenportal. Das nur zwei-
achsige und nachträglich mit Seitengiebeln in
Fachwerk aufgestockte Haus Nr. 11 zeigt eine
wohl 1827 entstandene, dreigeschossige Putz-
fassade des Klassizismus mit schlichter Profilie-
rung der Fensterfaschen. Einen auffallenden
Kontrast zu den beiden Gebäuden bildet der
schmale, aber hohe Backsteinbau Nr. 12 mit
seinem reichen späthistoristischen Dekor.
Das viergeschossige Wohn-/Geschäftshaus An
den Brodbänken la nahm 1882 den Platz des
zum Anwesen Große Bäckerstraße 33 gehö-
renden Hintergebäudes ein. In Formen der
Neurenaissance mit kräftig profilierten, konsol-
gestützten Fensterverdachungen im ersten und
zweiten Obergeschoss instrumentiert, passt
sich seine Putzfassade mit der linken, zurück-
springenden Achse, die den Durchgang zum
Hof aufnimmt, der älteren Baufluchtlinie an. Das
folgende, 1832 von H. Warnecke für den
j|
lll
IV
HlT
m
HS
öd.
□ MI.
An den Brodbänken 11, 12, 13, Südansicht
253
Rundbogeneingang, rechts davon eine zweige-
schossige Auslucht, außerdem mittig im
Obergeschoss eine nach der Sanierung gerade
geschlossene, zuvor aber rundbogige Lade-
luke. Darüber sitzt im Dach ein Aufzugserker
mit über Knaggen vorkragendem Satteldach
sowie einem geschweiften Sturz über der heute
verglasten Ladeiuke. Den südlichen Teil dieses
Straßenabschnitts dominieren die Traufseiten
des Anwesens Lünertorstraße 18.
Der Südabschnitt des Werders ist heute als
baumbestandene Freifläche gestaltet, die 1989
mit einem Pavillon und einem Bronzebrunnen
möbliert wurde. Den Platzraum begrenzen im
Westen die Traufseiten des vormaligen Brau-
hauses Lünertorstraße 4. Nach Süden folgen
die beiden, einer sozial niedrigeren Bauten-
schicht angehörenden kleineren Fachwerk-
häuser Nr. 10 und Nr. 11. Ersteres, zweige-
schossig mit linksseitiger Auslucht, büßte zwar
anlässlich einer Sanierung 1985/86 z.T. origina-
le Bausubstanz ein (u.a. Erneuerung des
Dachwerks, Austausch von Hölzern), doch
konnte andererseits ein bis dahin verfüllter und
wohl ins 16.Jh. zu datierender Keller, wenn-
gleich mit eingebrochenem Gewölbe, samt
dem vor der Auslucht liegenden, von zwei
Klapptüren verschlossenen Kellerzugang wie-
derhergestellt werden. Links des Eingangs
befand sich hinter der Auslucht eine beheizbare
Stube, der nach Westen eine Küche folgte. Eine
vergleichbare Überarbeitung erfuhr 1979/80
das nach Süden in gleicher Flucht, aber niedri-
ger anschließende Haus Nr. 11, ein langge-
streckter Fachwerkbau von zwei Geschossen
mit rechtsseitiger Auslucht und links davon lie-
gendem Eingang, dessen Fensteranordnung
der östlichen Traufwand nach Bestand über-
nommen wurde. Der sich einst über eine Er-
weiterung an das nach Westen folgende
Giebelhaus anschließende Südgiebel wurde
dagegen neu aufgemauert und mit einem
schon früher an dieser Stelle vorhandenen
Zugang versehen.
AN DEN BRODBÄNKEN
Die vom Markt aus nach Osten führende Straße
An den Brodbänken bildet zusammen mit der
Rosenstraße eine Achse, die gerade mit leich-
tem Gefälle zur llmenauniederung hinabläuft. Ihr
von den Verkaufsständen der Bäcker abgeleite-
ter Name, urkundlich erstmals 1306 nachweis-
bar, wird im 15.Jh. in der niederdeutschen Ver-
sion als „brodschrangen“ verwendet. Sieht man
von dem giebelständigen Neubau Nr. 2 ab,
ergibt sich für das heutige Erscheinungsbild der
bereits im 15.Jh. gepflasterten Straße (1994
Neupflasterung) eine heterogene Mischung aus
teilweise stark überarbeiteten Putzfassaden
spätmittelalterlicher bzw. frühneuzeitlicher
Häuser und Ersatzbauten des 19.Jh. sowie
beginnenden 2O.Jh. in auffallend variierender
Höhenentwicklung. Am deutlichsten geben die
sich gegenüberliegenden Giebelhäuser An den
Brodbänken 6 und das die Nordostecke beset-
zende patrizische Anwesen Nr. 8 ihre jahrhun-
dertealte Provenienz durch ihre backsteinsichti-
gen Staffelgiebel zu erkennen. Die beiden west-
lichen Eckgrundstücke nahmen großvolumige,
zum Markt hin orientierte Giebelhäuser mit ihren
sich entlang den Brodbänken erstreckenden
Hintergebäuden auf, wovon das südliche Ende
des 19.Jh. ersetzt wurde. Auf der Nordseite
erhob sich anstelle des heutigen Neubaus der
dem Rat und den Ämtern als Gesellschaftshaus
dienende Schütting, dem sich drei kleine
Wohnhäuser für Ratsdiener anschlossen
(Parzellen Nr. 11-13). Sie sind mit „den Buden
achter dem schütting“ zu identifizieren, an
denen laut Baubuch 1466 gebaut wurde und
die 1732 als unter einem Dach liegend
beschrieben werden. Zeitweise vermietet, wur-
den sie 1803 einzeln verkauft und befanden
sich während des weiteren 19.Jh. überwiegend
im Besitz von Handwerkern (z.B. Schneider,
Schuster, Schiffer, Barbier, Nadler, Bildhauer).
Mit den beiden Traufenhäusern Nr. 11 und Nr.
13 sind zwei, wenn auch vielfach modifizierte
Relikte dieser Bebauung überkommen. Am
ehesten vermittelt das Bild einer Bude das nur
zweigeschossige, teils in Fachwerk aufgeführte
Haus Nr. 13. Seine schlichte Putzfassade, nur
durch einen ehemaligen Aufzugserker in der
steilen Dachfläche hervorgehoben, besaß bis
1881 eine rechtsseitige Auslucht und bis 1912
ein mittiges Spitzbogenportal. Das nur zwei-
achsige und nachträglich mit Seitengiebeln in
Fachwerk aufgestockte Haus Nr. 11 zeigt eine
wohl 1827 entstandene, dreigeschossige Putz-
fassade des Klassizismus mit schlichter Profilie-
rung der Fensterfaschen. Einen auffallenden
Kontrast zu den beiden Gebäuden bildet der
schmale, aber hohe Backsteinbau Nr. 12 mit
seinem reichen späthistoristischen Dekor.
Das viergeschossige Wohn-/Geschäftshaus An
den Brodbänken la nahm 1882 den Platz des
zum Anwesen Große Bäckerstraße 33 gehö-
renden Hintergebäudes ein. In Formen der
Neurenaissance mit kräftig profilierten, konsol-
gestützten Fensterverdachungen im ersten und
zweiten Obergeschoss instrumentiert, passt
sich seine Putzfassade mit der linken, zurück-
springenden Achse, die den Durchgang zum
Hof aufnimmt, der älteren Baufluchtlinie an. Das
folgende, 1832 von H. Warnecke für den
j|
lll
IV
HlT
m
HS
öd.
□ MI.
An den Brodbänken 11, 12, 13, Südansicht
253