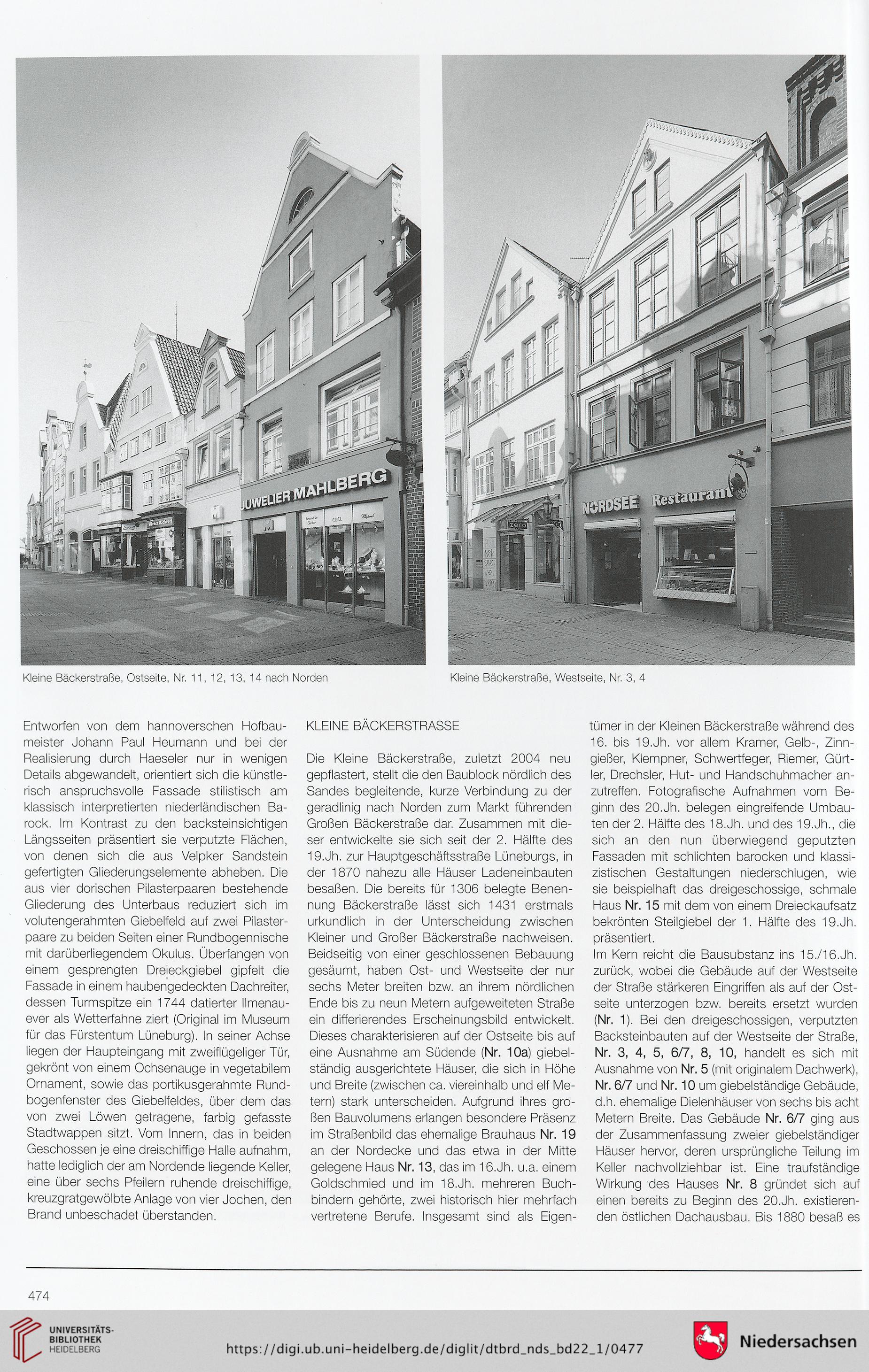Kleine Bäckerstraße, Ostseite, Nr. 11, 12, 13, 14 nach Norden
Kleine Bäckerstraße, Westseite, Nr. 3, 4
Entworfen von dem hannoverschen Hofbau-
meister Johann Paul Heumann und bei der
Realisierung durch Haeseler nur in wenigen
Details abgewandelt, orientiert sich die künstle-
risch anspruchsvolle Fassade stilistisch am
klassisch interpretierten niederländischen Ba-
rock. Im Kontrast zu den backsteinsichtigen
Längsseiten präsentiert sie verputzte Flächen,
von denen sich die aus Velpker Sandstein
gefertigten Gliederungselemente abheben. Die
aus vier dorischen Pilasterpaaren bestehende
Gliederung des Unterbaus reduziert sich im
volutengerahmten Giebelfeld auf zwei Pilaster-
paare zu beiden Seiten einer Rundbogennische
mit darüberliegendem Okulus. Überfangen von
einem gesprengten Dreieckgiebel gipfelt die
Fassade in einem haubengedeckten Dachreiter,
dessen Turmspitze ein 1744 datierter llmenau-
ever als Wetterfahne ziert (Original im Museum
für das Fürstentum Lüneburg). In seiner Achse
liegen der Haupteingang mit zweiflügeliger Tür,
gekrönt von einem Ochsenauge in vegetabilem
Ornament, sowie das portikusgerahmte Rund-
bogenfenster des Giebelfeldes, über dem das
von zwei Löwen getragene, farbig gefasste
Stadtwappen sitzt. Vom Innern, das in beiden
Geschossen je eine dreischiffige Halle aufnahm,
hatte lediglich der am Nordende liegende Keller,
eine über sechs Pfeilern ruhende dreischiffige,
kreuzgratgewölbte Anlage von vier Jochen, den
Brand unbeschadet überstanden.
KLEINE BÄCKERSTRASSE
Die Kleine Bäckerstraße, zuletzt 2004 neu
gepflastert, stellt die den Baublock nördlich des
Sandes begleitende, kurze Verbindung zu der
geradlinig nach Norden zum Markt führenden
Großen Bäckerstraße dar. Zusammen mit die-
ser entwickelte sie sich seit der 2. Hälfte des
19.Jh. zur Hauptgeschäftsstraße Lüneburgs, in
der 1870 nahezu alle Häuser Ladeneinbauten
besaßen. Die bereits für 1306 belegte Benen-
nung Bäckerstraße lässt sich 1431 erstmals
urkundlich in der Unterscheidung zwischen
Kleiner und Großer Bäckerstraße nachweisen.
Beidseitig von einer geschlossenen Bebauung
gesäumt, haben Ost- und Westseite der nur
sechs Meter breiten bzw. an ihrem nördlichen
Ende bis zu neun Metern aufgeweiteten Straße
ein differierendes Erscheinungsbild entwickelt.
Dieses charakterisieren auf der Ostseite bis auf
eine Ausnahme am Südende (Nr. 10a) giebel-
ständig ausgerichtete Häuser, die sich in Höhe
und Breite (zwischen ca. viereinhalb und elf Me-
tern) stark unterscheiden. Aufgrund ihres gro-
ßen Bauvolumens erlangen besondere Präsenz
im Straßenbild das ehemalige Brauhaus Nr. 19
an der Nordecke und das etwa in der Mitte
gelegene Haus Nr. 13, das im 16.Jh. u.a. einem
Goldschmied und im 18.Jh. mehreren Buch-
bindern gehörte, zwei historisch hier mehrfach
vertretene Berufe. Insgesamt sind als Eigen-
tümer in der Kleinen Bäckerstraße während des
16. bis 19.Jh. vor allem Kramer, Gelb-, Zinn-
gießer, Klempner, Schwertfeger, Riemer, Gürt-
ler, Drechsler, Hut- und Handschuhmacher an-
zutreffen. Fotografische Aufnahmen vom Be-
ginn des 20.Jh. belegen eingreifende Umbau-
ten der 2. Hälfte des 18.Jh. und des 19.Jh., die
sich an den nun überwiegend geputzten
Fassaden mit schlichten barocken und klassi-
zistischen Gestaltungen niederschlugen, wie
sie beispielhaft das dreigeschossige, schmale
Haus Nr. 15 mit dem von einem Dreieckaufsatz
bekrönten Steilgiebel der 1. Hälfte des 19.Jh.
präsentiert.
Im Kern reicht die Bausubstanz ins 15./16,Jh.
zurück, wobei die Gebäude auf der Westseite
der Straße stärkeren Eingriffen als auf der Ost-
seite unterzogen bzw. bereits ersetzt wurden
(Nr. 1). Bei den dreigeschossigen, verputzten
Backsteinbauten auf der Westseite der Straße,
Nr. 3, 4, 5, 6/7, 8, 10, handelt es sich mit
Ausnahme von Nr. 5 (mit originalem Dachwerk),
Nr. 6/7 und Nr. 10 um giebelständige Gebäude,
d.h. ehemalige Dielenhäuser von sechs bis acht
Metern Breite. Das Gebäude Nr. 6/7 ging aus
der Zusammenfassung zweier giebelständiger
Häuser hervor, deren ursprüngliche Teilung im
Keller nachvollziehbar ist. Eine traufständige
Wirkung des Hauses Nr. 8 gründet sich auf
einen bereits zu Beginn des 20.Jh. existieren-
den östlichen Dachausbau. Bis 1880 besaß es
474