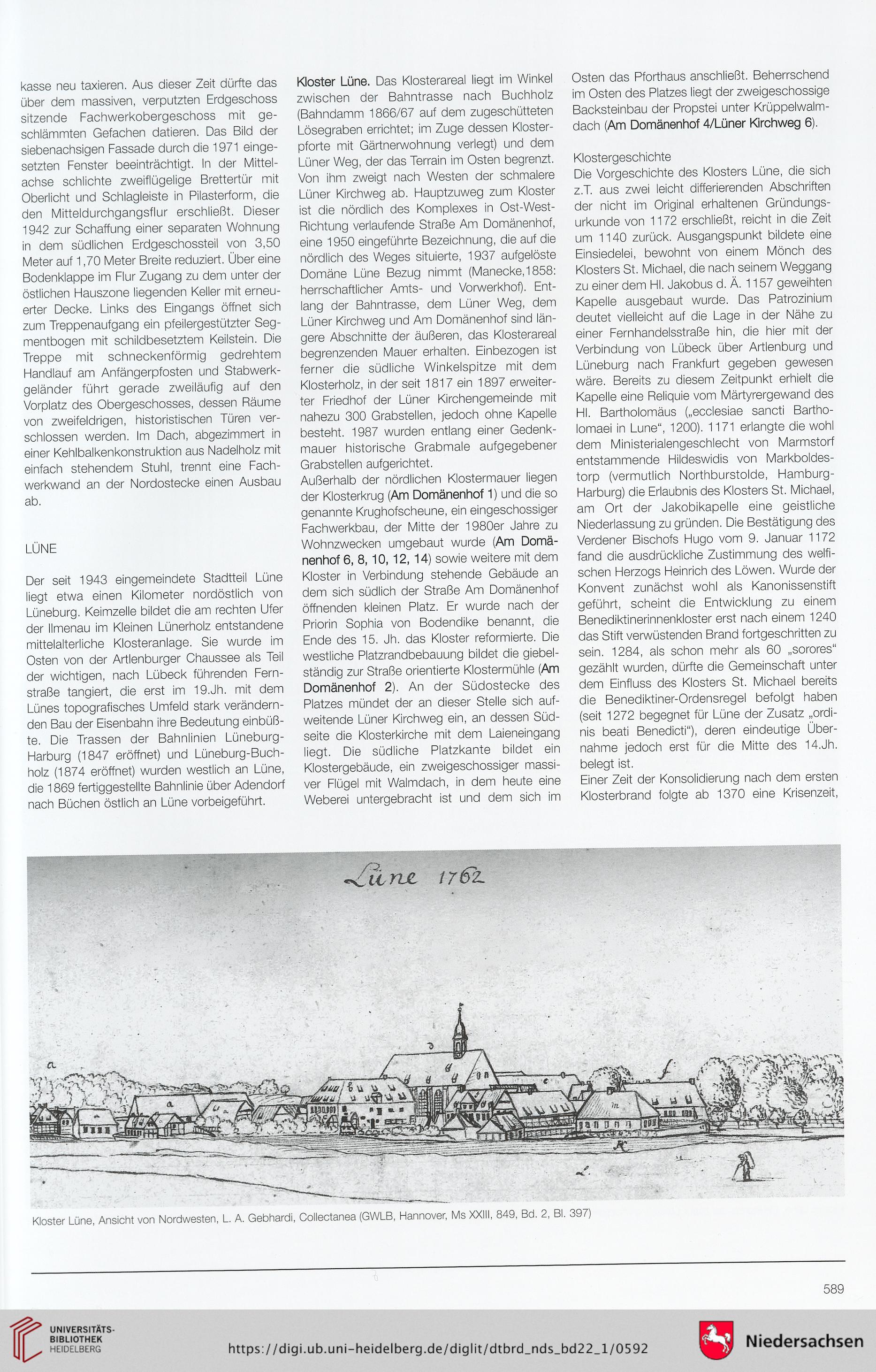kasse neu taxieren. Aus dieser Zeit dürfte das
über dem massiven, verputzten Erdgeschoss
sitzende Fachwerkobergeschoss mit ge-
schlämmten Gefachen datieren. Das Bild der
siebenachsigen Fassade durch die 1971 einge-
setzten Fenster beeinträchtigt. In der Mittel-
achse schlichte zweiflügelige Brettertür mit
Oberlicht und Schlagleiste in Pilasterform, die
den Mitteldurchgangsflur erschließt. Dieser
1942 zur Schaffung einer separaten Wohnung
in dem südlichen Erdgeschossteil von 3,50
Meter auf 1,70 Meter Breite reduziert. Über eine
Bodenklappe im Flur Zugang zu dem unter der
östlichen Hauszone liegenden Keller mit erneu-
erter Decke. Links des Eingangs öffnet sich
zum Treppenaufgang ein pfeilergestützter Seg-
mentbogen mit schildbesetztem Keilstein. Die
Treppe mit schneckenförmig gedrehtem
Handlauf am Anfängerpfosten und Stabwerk-
geländer führt gerade zweiläufig auf den
Vorplatz des Obergeschosses, dessen Räume
von zweifeldrigen, historistischen Türen ver-
schlossen werden. Im Dach, abgezimmert in
einer Kehlbalkenkonstruktion aus Nadelholz mit
einfach stehendem Stuhl, trennt eine Fach-
werkwand an der Nordostecke einen Ausbau
ab.
LÜNE
Der seit 1943 eingemeindete Stadtteil Lüne
liegt etwa einen Kilometer nordöstlich von
Lüneburg. Keimzelle bildet die am rechten Ufer
der Ilmenau im Kleinen Lünerholz entstandene
mittelalterliche Klosteranlage. Sie wurde im
Osten von der Artlenburger Chaussee als Teil
der wichtigen, nach Lübeck führenden Fern-
straße tangiert, die erst im 19.Jh. mit dem
Lünes topografisches Umfeld stark verändern-
den Bau der Eisenbahn ihre Bedeutung einbüß-
te. Die Trassen der Bahnlinien Lüneburg-
Harburg (1847 eröffnet) und Lüneburg-Buch-
holz (1874 eröffnet) wurden westlich an Lüne,
die 1869 fertiggestellte Bahnlinie über Adendorf
nach Büchen östlich an Lüne vorbeigeführt.
Kloster Lüne. Das Klosterareal liegt im Winkel
zwischen der Bahntrasse nach Buchholz
(Bahndamm 1866/67 auf dem zugeschütteten
Lösegraben errichtet; im Zuge dessen Kloster-
pforte mit Gärtnerwohnung verlegt) und dem
Lüner Weg, der das Terrain im Osten begrenzt.
Von ihm zweigt nach Westen der schmalere
Lüner Kirchweg ab. Hauptzuweg zum Kloster
ist die nördlich des Komplexes in Ost-West-
Richtung verlaufende Straße Am Domänenhof,
eine 1950 eingeführte Bezeichnung, die auf die
nördlich des Weges situierte, 1937 aufgelöste
Domäne Lüne Bezug nimmt (Manecke,1858:
herrschaftlicher Amts- und Vorwerkhof). Ent-
lang der Bahntrasse, dem Lüner Weg, dem
Lüner Kirchweg und Am Domänenhof sind län-
gere Abschnitte der äußeren, das Klosterareal
begrenzenden Mauer erhalten. Einbezogen ist
ferner die südliche Winkelspitze mit dem
Klosterholz, in der seit 1817 ein 1897 erweiter-
ter Friedhof der Lüner Kirchengemeinde mit
nahezu 300 Grabstellen, jedoch ohne Kapelle
besteht. 1987 wurden entlang einer Gedenk-
mauer historische Grabmale aufgegebener
Grabstellen aufgerichtet.
Außerhalb der nördlichen Klostermauer liegen
der Klosterkrug (Am Domänenhof 1) und die so
genannte Krughofscheune, ein eingeschossiger
Fachwerkbau, der Mitte der 1980er Jahre zu
Wohnzwecken umgebaut wurde (Am Domä-
nenhof 6, 8, 10, 12, 14) sowie weitere mit dem
Kloster in Verbindung stehende Gebäude an
dem sich südlich der Straße Am Domänenhof
öffnenden kleinen Platz. Er wurde nach der
Priorin Sophia von Bodendike benannt, die
Ende des 15. Jh. das Kloster reformierte. Die
westliche Platzrandbebauung bildet die giebel-
ständig zur Straße orientierte Klostermühle (Am
Domänenhof 2). An der Südostecke des
Platzes mündet der an dieser Stelle sich auf-
weitende Lüner Kirchweg ein, an dessen Süd-
seite die Klosterkirche mit dem Laieneingang
liegt. Die südliche Platzkante bildet ein
Klostergebäude, ein zweigeschossiger massi-
ver Flügel mit Walmdach, in dem heute eine
Weberei untergebracht ist und dem sich im
Osten das Pforthaus anschließt. Beherrschend
im Osten des Platzes liegt der zweigeschossige
Backsteinbau der Propstei unter Krüppelwalm-
dach (Am Domänenhof 4/Lüner Kirchweg 6).
Klostergeschichte
Die Vorgeschichte des Klosters Lüne, die sich
z.T. aus zwei leicht differierenden Abschriften
der nicht im Original erhaltenen Gründungs-
urkunde von 1172 erschließt, reicht in die Zeit
um 1140 zurück. Ausgangspunkt bildete eine
Einsiedelei, bewohnt von einem Mönch des
Klosters St. Michael, die nach seinem Weggang
zu einer dem Hl. Jakobus d. Ä. 1157 geweihten
Kapelle ausgebaut wurde. Das Patrozinium
deutet vielleicht auf die Lage in der Nähe zu
einer Fernhandelsstraße hin, die hier mit der
Verbindung von Lübeck über Artlenburg und
Lüneburg nach Frankfurt gegeben gewesen
wäre. Bereits zu diesem Zeitpunkt erhielt die
Kapelle eine Reliquie vom Märtyrergewand des
Hl. Bartholomäus („ecclesiae sancti Bartho-
lomaei in Lune“, 1200). 1171 erlangte die wohl
dem Ministerialengeschlecht von Marmstorf
entstammende Hildeswidis von Markboldes-
torp (vermutlich Northburstolde, Hamburg-
Harburg) die Erlaubnis des Klosters St. Michael,
am Ort der Jakobikapelle eine geistliche
Niederlassung zu gründen. Die Bestätigung des
Verdener Bischofs Hugo vom 9. Januar 1172
fand die ausdrückliche Zustimmung des welfi-
schen Herzogs Heinrich des Löwen. Wurde der
Konvent zunächst wohl als Kanonissenstift
geführt, scheint die Entwicklung zu einem
Benediktinerinnenkloster erst nach einem 1240
das Stift verwüstenden Brand fortgeschritten zu
sein. 1284, als schon mehr als 60 „sorores“
gezählt wurden, dürfte die Gemeinschaft unter
dem Einfluss des Klosters St. Michael bereits
die Benediktiner-Ordensregel befolgt haben
(seit 1272 begegnet für Lüne der Zusatz „ordi-
nis beati Benedicti“), deren eindeutige Über-
nahme jedoch erst für die Mitte des 14.Jh.
belegt ist.
Einer Zeit der Konsolidierung nach dem ersten
Klosterbrand folgte ab 1370 eine Krisenzeit,
Kloster Lüne, Ansicht von Nordwesten, L. A. Gebhardi, Collectanea (GWLB, Hannover, Ms XXIII, 849, Bd. 2, BI. 397)
589
über dem massiven, verputzten Erdgeschoss
sitzende Fachwerkobergeschoss mit ge-
schlämmten Gefachen datieren. Das Bild der
siebenachsigen Fassade durch die 1971 einge-
setzten Fenster beeinträchtigt. In der Mittel-
achse schlichte zweiflügelige Brettertür mit
Oberlicht und Schlagleiste in Pilasterform, die
den Mitteldurchgangsflur erschließt. Dieser
1942 zur Schaffung einer separaten Wohnung
in dem südlichen Erdgeschossteil von 3,50
Meter auf 1,70 Meter Breite reduziert. Über eine
Bodenklappe im Flur Zugang zu dem unter der
östlichen Hauszone liegenden Keller mit erneu-
erter Decke. Links des Eingangs öffnet sich
zum Treppenaufgang ein pfeilergestützter Seg-
mentbogen mit schildbesetztem Keilstein. Die
Treppe mit schneckenförmig gedrehtem
Handlauf am Anfängerpfosten und Stabwerk-
geländer führt gerade zweiläufig auf den
Vorplatz des Obergeschosses, dessen Räume
von zweifeldrigen, historistischen Türen ver-
schlossen werden. Im Dach, abgezimmert in
einer Kehlbalkenkonstruktion aus Nadelholz mit
einfach stehendem Stuhl, trennt eine Fach-
werkwand an der Nordostecke einen Ausbau
ab.
LÜNE
Der seit 1943 eingemeindete Stadtteil Lüne
liegt etwa einen Kilometer nordöstlich von
Lüneburg. Keimzelle bildet die am rechten Ufer
der Ilmenau im Kleinen Lünerholz entstandene
mittelalterliche Klosteranlage. Sie wurde im
Osten von der Artlenburger Chaussee als Teil
der wichtigen, nach Lübeck führenden Fern-
straße tangiert, die erst im 19.Jh. mit dem
Lünes topografisches Umfeld stark verändern-
den Bau der Eisenbahn ihre Bedeutung einbüß-
te. Die Trassen der Bahnlinien Lüneburg-
Harburg (1847 eröffnet) und Lüneburg-Buch-
holz (1874 eröffnet) wurden westlich an Lüne,
die 1869 fertiggestellte Bahnlinie über Adendorf
nach Büchen östlich an Lüne vorbeigeführt.
Kloster Lüne. Das Klosterareal liegt im Winkel
zwischen der Bahntrasse nach Buchholz
(Bahndamm 1866/67 auf dem zugeschütteten
Lösegraben errichtet; im Zuge dessen Kloster-
pforte mit Gärtnerwohnung verlegt) und dem
Lüner Weg, der das Terrain im Osten begrenzt.
Von ihm zweigt nach Westen der schmalere
Lüner Kirchweg ab. Hauptzuweg zum Kloster
ist die nördlich des Komplexes in Ost-West-
Richtung verlaufende Straße Am Domänenhof,
eine 1950 eingeführte Bezeichnung, die auf die
nördlich des Weges situierte, 1937 aufgelöste
Domäne Lüne Bezug nimmt (Manecke,1858:
herrschaftlicher Amts- und Vorwerkhof). Ent-
lang der Bahntrasse, dem Lüner Weg, dem
Lüner Kirchweg und Am Domänenhof sind län-
gere Abschnitte der äußeren, das Klosterareal
begrenzenden Mauer erhalten. Einbezogen ist
ferner die südliche Winkelspitze mit dem
Klosterholz, in der seit 1817 ein 1897 erweiter-
ter Friedhof der Lüner Kirchengemeinde mit
nahezu 300 Grabstellen, jedoch ohne Kapelle
besteht. 1987 wurden entlang einer Gedenk-
mauer historische Grabmale aufgegebener
Grabstellen aufgerichtet.
Außerhalb der nördlichen Klostermauer liegen
der Klosterkrug (Am Domänenhof 1) und die so
genannte Krughofscheune, ein eingeschossiger
Fachwerkbau, der Mitte der 1980er Jahre zu
Wohnzwecken umgebaut wurde (Am Domä-
nenhof 6, 8, 10, 12, 14) sowie weitere mit dem
Kloster in Verbindung stehende Gebäude an
dem sich südlich der Straße Am Domänenhof
öffnenden kleinen Platz. Er wurde nach der
Priorin Sophia von Bodendike benannt, die
Ende des 15. Jh. das Kloster reformierte. Die
westliche Platzrandbebauung bildet die giebel-
ständig zur Straße orientierte Klostermühle (Am
Domänenhof 2). An der Südostecke des
Platzes mündet der an dieser Stelle sich auf-
weitende Lüner Kirchweg ein, an dessen Süd-
seite die Klosterkirche mit dem Laieneingang
liegt. Die südliche Platzkante bildet ein
Klostergebäude, ein zweigeschossiger massi-
ver Flügel mit Walmdach, in dem heute eine
Weberei untergebracht ist und dem sich im
Osten das Pforthaus anschließt. Beherrschend
im Osten des Platzes liegt der zweigeschossige
Backsteinbau der Propstei unter Krüppelwalm-
dach (Am Domänenhof 4/Lüner Kirchweg 6).
Klostergeschichte
Die Vorgeschichte des Klosters Lüne, die sich
z.T. aus zwei leicht differierenden Abschriften
der nicht im Original erhaltenen Gründungs-
urkunde von 1172 erschließt, reicht in die Zeit
um 1140 zurück. Ausgangspunkt bildete eine
Einsiedelei, bewohnt von einem Mönch des
Klosters St. Michael, die nach seinem Weggang
zu einer dem Hl. Jakobus d. Ä. 1157 geweihten
Kapelle ausgebaut wurde. Das Patrozinium
deutet vielleicht auf die Lage in der Nähe zu
einer Fernhandelsstraße hin, die hier mit der
Verbindung von Lübeck über Artlenburg und
Lüneburg nach Frankfurt gegeben gewesen
wäre. Bereits zu diesem Zeitpunkt erhielt die
Kapelle eine Reliquie vom Märtyrergewand des
Hl. Bartholomäus („ecclesiae sancti Bartho-
lomaei in Lune“, 1200). 1171 erlangte die wohl
dem Ministerialengeschlecht von Marmstorf
entstammende Hildeswidis von Markboldes-
torp (vermutlich Northburstolde, Hamburg-
Harburg) die Erlaubnis des Klosters St. Michael,
am Ort der Jakobikapelle eine geistliche
Niederlassung zu gründen. Die Bestätigung des
Verdener Bischofs Hugo vom 9. Januar 1172
fand die ausdrückliche Zustimmung des welfi-
schen Herzogs Heinrich des Löwen. Wurde der
Konvent zunächst wohl als Kanonissenstift
geführt, scheint die Entwicklung zu einem
Benediktinerinnenkloster erst nach einem 1240
das Stift verwüstenden Brand fortgeschritten zu
sein. 1284, als schon mehr als 60 „sorores“
gezählt wurden, dürfte die Gemeinschaft unter
dem Einfluss des Klosters St. Michael bereits
die Benediktiner-Ordensregel befolgt haben
(seit 1272 begegnet für Lüne der Zusatz „ordi-
nis beati Benedicti“), deren eindeutige Über-
nahme jedoch erst für die Mitte des 14.Jh.
belegt ist.
Einer Zeit der Konsolidierung nach dem ersten
Klosterbrand folgte ab 1370 eine Krisenzeit,
Kloster Lüne, Ansicht von Nordwesten, L. A. Gebhardi, Collectanea (GWLB, Hannover, Ms XXIII, 849, Bd. 2, BI. 397)
589