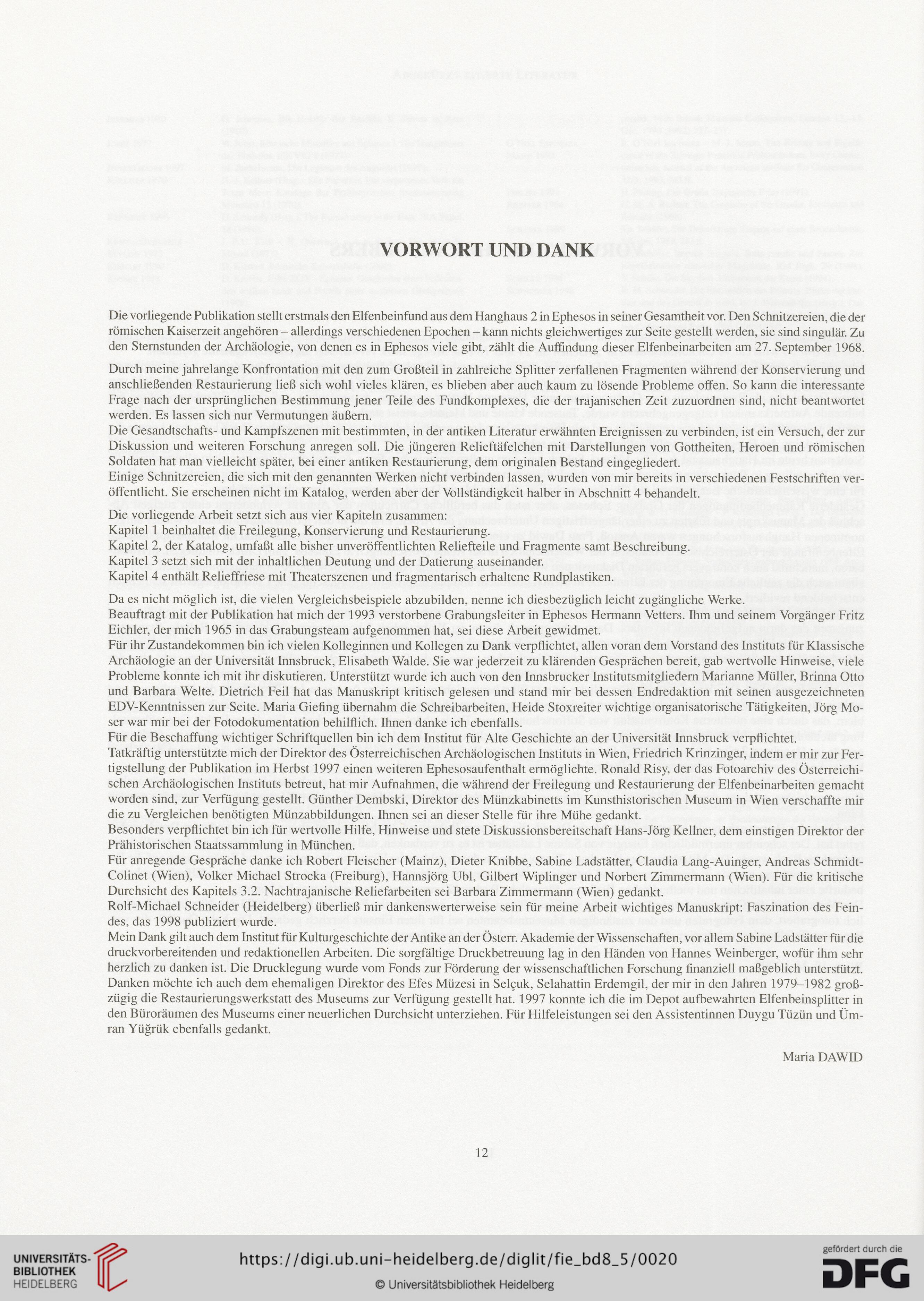VORWORT UND DANK
Die vorliegende Publikation stellt erstmals den Elfenbeinfund aus dem Hanghaus 2 in Ephesos in seiner Gesamtheit vor. Den Schnitzereien, die der
römischen Kaiserzeit angehören - allerdings verschiedenen Epochen - kann nichts gleichwertiges zur Seite gestellt werden, sie sind singulär. Zu
den Stemstunden der Archäologie, von denen es in Ephesos viele gibt, zählt die Auffindung dieser Elfenbeinarbeiten am 27. September 1968.
Durch meine jahrelange Konfrontation mit den zum Großteil in zahlreiche Splitter zerfallenen Fragmenten während der Konservierung und
anschließenden Restaurierung ließ sich wohl vieles klären, es blieben aber auch kaum zu lösende Probleme offen. So kann die interessante
Frage nach der ursprünglichen Bestimmung jener Teile des Fundkomplexes, die der trajanischen Zeit zuzuordnen sind, nicht beantwortet
werden. Es lassen sich nur Vermutungen äußern.
Die Gesandtschafts- und Kampfszenen mit bestimmten, in der antiken Literatur erwähnten Ereignissen zu verbinden, ist ein Versuch, der zur
Diskussion und weiteren Forschung anregen soll. Die jüngeren Relieftäfelchen mit Darstellungen von Gottheiten, Heroen und römischen
Soldaten hat man vielleicht später, bei einer antiken Restaurierung, dem originalen Bestand eingegliedert.
Einige Schnitzereien, die sich mit den genannten Werken nicht verbinden lassen, wurden von mir bereits in verschiedenen Festschriften ver-
öffentlicht. Sie erscheinen nicht im Katalog, werden aber der Vollständigkeit halber in Abschnitt 4 behandelt.
Die vorliegende Arbeit setzt sich aus vier Kapiteln zusammen:
Kapitel 1 beinhaltet die Freilegung, Konservierung und Restaurierung.
Kapitel 2, der Katalog, umfaßt alle bisher unveröffentlichten Reliefteile und Fragmente samt Beschreibung.
Kapitel 3 setzt sich mit der inhaltlichen Deutung und der Datierung auseinander.
Kapitel 4 enthält Relieffriese mit Theaterszenen und fragmentarisch erhaltene Rundplastiken.
Da es nicht möglich ist, die vielen Vergleichsbeispiele abzubilden, nenne ich diesbezüglich leicht zugängliche Werke.
Beauftragt mit der Publikation hat mich der 1993 verstorbene Grabungsleiter in Ephesos Hermann Vetters. Ihm und seinem Vorgänger Fritz
Eichler, der mich 1965 in das Grabungsteam aufgenommen hat, sei diese Arbeit gewidmet.
Für ihr Zustandekommen bin ich vielen Kolleginnen und Kollegen zu Dank verpflichtet, allen voran dem Vorstand des Instituts für Klassische
Archäologie an der Universität Innsbruck, Elisabeth Walde. Sie war jederzeit zu klärenden Gesprächen bereit, gab wertvolle Hinweise, viele
Probleme konnte ich mit ihr diskutieren. Unterstützt wurde ich auch von den Innsbrucker Institutsmitgliedern Marianne Müller, Brinna Otto
und Barbara Welte. Dietrich Feil hat das Manuskript kritisch gelesen und stand mir bei dessen Endredaktion mit seinen ausgezeichneten
EDV-Kenntnissen zur Seite. Maria Giefing übernahm die Schreibarbeiten, Heide Stoxreiter wichtige organisatorische Tätigkeiten, Jörg Mo-
ser war mir bei der Fotodokumentation behilflich. Ihnen danke ich ebenfalls.
Für die Beschaffung wichtiger Schriftquellen bin ich dem Institut für Alte Geschichte an der Universität Innsbruck verpflichtet.
Tatkräftig unterstützte mich der Direktor des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien, Friedrich Krinzinger, indem er mir zur Fer-
tigstellung der Publikation im Herbst 1997 einen weiteren Ephesosaufenthalt ermöglichte. Ronald Risy, der das Fotoarchiv des Österreichi-
schen Archäologischen Instituts betreut, hat mir Aufnahmen, die während der Freilegung und Restaurierung der Elfenbeinarbeiten gemacht
worden sind, zur Verfügung gestellt. Günther Dembski, Direktor des Münzkabinetts im Kunsthistorischen Museum in Wien verschaffte mir
die zu Vergleichen benötigten Münzabbildungen. Ihnen sei an dieser Stelle für ihre Mühe gedankt.
Besonders verpflichtet bin ich für wertvolle Hilfe, Hinweise und stete Diskussionsbereitschaft Hans-Jörg Kellner, dem einstigen Direktor der
Prähistorischen Staatssammlung in München.
Für anregende Gespräche danke ich Robert Fleischer (Mainz), Dieter Knibbe, Sabine Ladstätter, Claudia Lang-Auinger, Andreas Schmidt-
Colinet (Wien), Volker Michael Strocka (Freiburg), Hannsjörg Ubl, Gilbert Wiplinger und Norbert Zimmermann (Wien). Für die kritische
Durchsicht des Kapitels 3.2. Nachtrajanische Reliefarbeiten sei Barbara Zimmermann (Wien) gedankt.
Rolf-Michael Schneider (Heidelberg) überließ mir dankenswerterweise sein für meine Arbeit wichtiges Manuskript: Faszination des Fein-
des, das 1998 publiziert wurde.
Mein Dank gilt auch dem Institut für Kulturgeschichte der Antike an der Österr. Akademie der Wissenschaften, vor allem Sabine Ladstätter für die
druckvorbereitenden und redaktionellen Arbeiten. Die sorgfältige Druckbetreuung lag in den Händen von Hannes Weinberger, wofür ihm sehr
herzlich zu danken ist. Die Drucklegung wurde vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziell maßgeblich unterstützt.
Danken möchte ich auch dem ehemaligen Direktor des Efes Müzesi in Selguk, Selahattin Erdemgil, der mir in den Jahren 1979-1982 groß-
zügig die Restaurierungswerkstatt des Museums zur Verfügung gestellt hat. 1997 konnte ich die im Depot aufbewahrten Elfenbeinsplitter in
den Büroräumen des Museums einer neuerlichen Durchsicht unterziehen. Für Hilfeleistungen sei den Assistentinnen Duygu Tüzün und Üm-
ran Yügrük ebenfalls gedankt.
Maria DAWID
12
Die vorliegende Publikation stellt erstmals den Elfenbeinfund aus dem Hanghaus 2 in Ephesos in seiner Gesamtheit vor. Den Schnitzereien, die der
römischen Kaiserzeit angehören - allerdings verschiedenen Epochen - kann nichts gleichwertiges zur Seite gestellt werden, sie sind singulär. Zu
den Stemstunden der Archäologie, von denen es in Ephesos viele gibt, zählt die Auffindung dieser Elfenbeinarbeiten am 27. September 1968.
Durch meine jahrelange Konfrontation mit den zum Großteil in zahlreiche Splitter zerfallenen Fragmenten während der Konservierung und
anschließenden Restaurierung ließ sich wohl vieles klären, es blieben aber auch kaum zu lösende Probleme offen. So kann die interessante
Frage nach der ursprünglichen Bestimmung jener Teile des Fundkomplexes, die der trajanischen Zeit zuzuordnen sind, nicht beantwortet
werden. Es lassen sich nur Vermutungen äußern.
Die Gesandtschafts- und Kampfszenen mit bestimmten, in der antiken Literatur erwähnten Ereignissen zu verbinden, ist ein Versuch, der zur
Diskussion und weiteren Forschung anregen soll. Die jüngeren Relieftäfelchen mit Darstellungen von Gottheiten, Heroen und römischen
Soldaten hat man vielleicht später, bei einer antiken Restaurierung, dem originalen Bestand eingegliedert.
Einige Schnitzereien, die sich mit den genannten Werken nicht verbinden lassen, wurden von mir bereits in verschiedenen Festschriften ver-
öffentlicht. Sie erscheinen nicht im Katalog, werden aber der Vollständigkeit halber in Abschnitt 4 behandelt.
Die vorliegende Arbeit setzt sich aus vier Kapiteln zusammen:
Kapitel 1 beinhaltet die Freilegung, Konservierung und Restaurierung.
Kapitel 2, der Katalog, umfaßt alle bisher unveröffentlichten Reliefteile und Fragmente samt Beschreibung.
Kapitel 3 setzt sich mit der inhaltlichen Deutung und der Datierung auseinander.
Kapitel 4 enthält Relieffriese mit Theaterszenen und fragmentarisch erhaltene Rundplastiken.
Da es nicht möglich ist, die vielen Vergleichsbeispiele abzubilden, nenne ich diesbezüglich leicht zugängliche Werke.
Beauftragt mit der Publikation hat mich der 1993 verstorbene Grabungsleiter in Ephesos Hermann Vetters. Ihm und seinem Vorgänger Fritz
Eichler, der mich 1965 in das Grabungsteam aufgenommen hat, sei diese Arbeit gewidmet.
Für ihr Zustandekommen bin ich vielen Kolleginnen und Kollegen zu Dank verpflichtet, allen voran dem Vorstand des Instituts für Klassische
Archäologie an der Universität Innsbruck, Elisabeth Walde. Sie war jederzeit zu klärenden Gesprächen bereit, gab wertvolle Hinweise, viele
Probleme konnte ich mit ihr diskutieren. Unterstützt wurde ich auch von den Innsbrucker Institutsmitgliedern Marianne Müller, Brinna Otto
und Barbara Welte. Dietrich Feil hat das Manuskript kritisch gelesen und stand mir bei dessen Endredaktion mit seinen ausgezeichneten
EDV-Kenntnissen zur Seite. Maria Giefing übernahm die Schreibarbeiten, Heide Stoxreiter wichtige organisatorische Tätigkeiten, Jörg Mo-
ser war mir bei der Fotodokumentation behilflich. Ihnen danke ich ebenfalls.
Für die Beschaffung wichtiger Schriftquellen bin ich dem Institut für Alte Geschichte an der Universität Innsbruck verpflichtet.
Tatkräftig unterstützte mich der Direktor des Österreichischen Archäologischen Instituts in Wien, Friedrich Krinzinger, indem er mir zur Fer-
tigstellung der Publikation im Herbst 1997 einen weiteren Ephesosaufenthalt ermöglichte. Ronald Risy, der das Fotoarchiv des Österreichi-
schen Archäologischen Instituts betreut, hat mir Aufnahmen, die während der Freilegung und Restaurierung der Elfenbeinarbeiten gemacht
worden sind, zur Verfügung gestellt. Günther Dembski, Direktor des Münzkabinetts im Kunsthistorischen Museum in Wien verschaffte mir
die zu Vergleichen benötigten Münzabbildungen. Ihnen sei an dieser Stelle für ihre Mühe gedankt.
Besonders verpflichtet bin ich für wertvolle Hilfe, Hinweise und stete Diskussionsbereitschaft Hans-Jörg Kellner, dem einstigen Direktor der
Prähistorischen Staatssammlung in München.
Für anregende Gespräche danke ich Robert Fleischer (Mainz), Dieter Knibbe, Sabine Ladstätter, Claudia Lang-Auinger, Andreas Schmidt-
Colinet (Wien), Volker Michael Strocka (Freiburg), Hannsjörg Ubl, Gilbert Wiplinger und Norbert Zimmermann (Wien). Für die kritische
Durchsicht des Kapitels 3.2. Nachtrajanische Reliefarbeiten sei Barbara Zimmermann (Wien) gedankt.
Rolf-Michael Schneider (Heidelberg) überließ mir dankenswerterweise sein für meine Arbeit wichtiges Manuskript: Faszination des Fein-
des, das 1998 publiziert wurde.
Mein Dank gilt auch dem Institut für Kulturgeschichte der Antike an der Österr. Akademie der Wissenschaften, vor allem Sabine Ladstätter für die
druckvorbereitenden und redaktionellen Arbeiten. Die sorgfältige Druckbetreuung lag in den Händen von Hannes Weinberger, wofür ihm sehr
herzlich zu danken ist. Die Drucklegung wurde vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung finanziell maßgeblich unterstützt.
Danken möchte ich auch dem ehemaligen Direktor des Efes Müzesi in Selguk, Selahattin Erdemgil, der mir in den Jahren 1979-1982 groß-
zügig die Restaurierungswerkstatt des Museums zur Verfügung gestellt hat. 1997 konnte ich die im Depot aufbewahrten Elfenbeinsplitter in
den Büroräumen des Museums einer neuerlichen Durchsicht unterziehen. Für Hilfeleistungen sei den Assistentinnen Duygu Tüzün und Üm-
ran Yügrük ebenfalls gedankt.
Maria DAWID
12