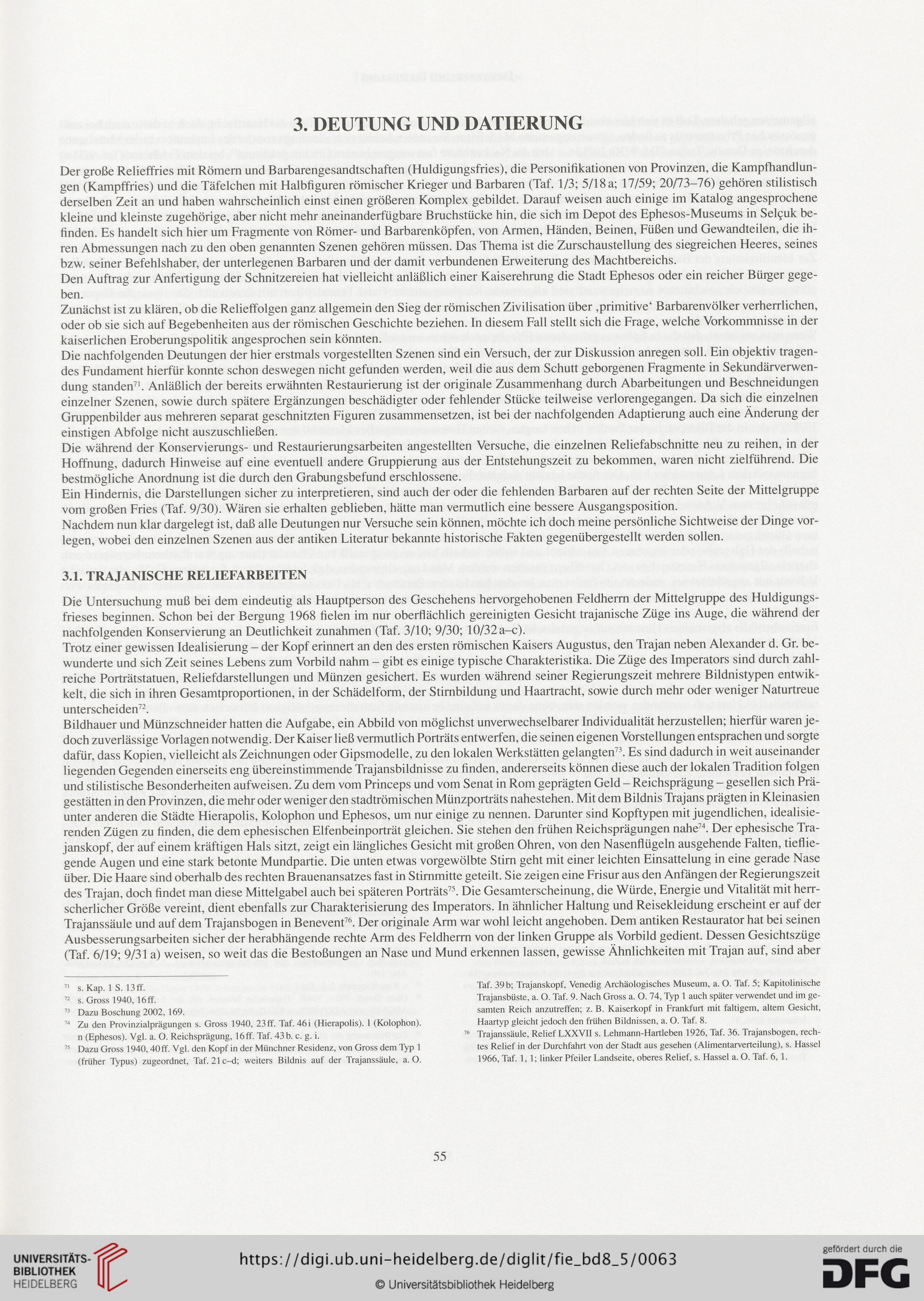3. DEUTUNG UND DATIERUNG
Der große Relieffries mit Römern und Barbarengesandtschaften (Huldigungsfries), die Personifikationen von Provinzen, die Kampfhandlun-
gen (Kampffries) und die Täfelchen mit Halbfiguren römischer Krieger und Barbaren (Taf. 1/3; 5/18 a; 17/59; 20/73-76) gehören stilistisch
derselben Zeit an und haben wahrscheinlich einst einen größeren Komplex gebildet. Darauf weisen auch einige im Katalog angesprochene
kleine und kleinste zugehörige, aber nicht mehr aneinanderfügbare Bruchstücke hin, die sich im Depot des Ephesos-Museums in Selguk be-
finden. Es handelt sich hier um Fragmente von Römer- und Barbarenköpfen, von Armen, Händen, Beinen, Füßen und Gewandteilen, die ih-
ren Abmessungen nach zu den oben genannten Szenen gehören müssen. Das Thema ist die Zurschaustellung des siegreichen Heeres, seines
bzw. seiner Befehlshaber, der unterlegenen Barbaren und der damit verbundenen Erweiterung des Machtbereichs.
Den Auftrag zur Anfertigung der Schnitzereien hat vielleicht anläßlich einer Kaiserehrung die Stadt Ephesos oder ein reicher Büiger gege-
ben.
Zunächst ist zu klären, ob die Relieffolgen ganz allgemein den Sieg der römischen Zivilisation über ,primitive4 Barbarenvölker verherrlichen,
oder ob sie sich auf Begebenheiten aus der römischen Geschichte beziehen. In diesem Fall stellt sich die Frage, welche Vorkommnisse in der
kaiserlichen Eroberungspolitik angesprochen sein könnten.
Die nachfolgenden Deutungen der hier erstmals vorgestellten Szenen sind ein Versuch, der zur Diskussion anregen soll. Ein objektiv tragen-
des Fundament hierfür konnte schon deswegen nicht gefunden werden, weil die aus dem Schutt geborgenen Fragmente in Sekundärverwen-
dung standen71. Anläßlich der bereits erwähnten Restaurierung ist der originale Zusammenhang durch Abarbeitungen und Beschneidungen
einzelner Szenen, sowie durch spätere Ergänzungen beschädigter oder fehlender Stücke teilweise verlorengegangen. Da sich die einzelnen
Gruppenbilder aus mehreren separat geschnitzten Figuren zusammensetzen, ist bei der nachfolgenden Adaptierung auch eine Änderung der
einstigen Abfolge nicht auszuschließen.
Die während der Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten angestellten Versuche, die einzelnen Reliefabschnitte neu zu reihen, in der
Hoffnung, dadurch Hinweise auf eine eventuell andere Gruppierung aus der Entstehungszeit zu bekommen, waren nicht zielführend. Die
bestmögliche Anordnung ist die durch den Grabungsbefund erschlossene.
Ein Hindernis, die Darstellungen sicher zu interpretieren, sind auch der oder die fehlenden Barbaren auf der rechten Seite der Mittelgruppe
vom großen Fries (Taf. 9/30). Wären sie erhalten geblieben, hätte man vermutlich eine bessere Ausgangsposition.
Nachdem nun klar dargelegt ist, daß alle Deutungen nur Versuche sein können, möchte ich doch meine persönliche Sichtweise der Dinge vor-
legen, wobei den einzelnen Szenen aus der antiken Literatur bekannte historische Fakten gegenübergestellt werden sollen.
3.1. TRAJANISCHE RELIEFARBEITEN
Die Untersuchung muß bei dem eindeutig als Hauptperson des Geschehens hervorgehobenen Feldherm der Mittelgruppe des Huldigungs-
frieses beginnen. Schon bei der Bergung 1968 fielen im nur oberflächlich gereinigten Gesicht trajanische Züge ins Auge, die während der
nachfolgenden Konservierung an Deutlichkeit zunahmen (Taf. 3/10; 9/30; 10/32 a-c).
Trotz einer gewissen Idealisierung - der Kopf erinnert an den des ersten römischen Kaisers Augustus, den Trajan neben Alexander d. Gr. be-
wunderte und sich Zeit seines Lebens zum Vorbild nahm - gibt es einige typische Charakteristika. Die Züge des Imperators sind durch zahl-
reiche Porträtstatuen, Reliefdarstellungen und Münzen gesichert. Es wurden während seiner Regierungszeit mehrere Bildnistypen entwik-
kelt, die sich in ihren Gesamtproportionen, in der Schädelform, der Stimbildung und Haartracht, sowie durch mehr oder weniger Naturtreue
unterscheiden72.
Bildhauer und Münzschneider hatten die Aufgabe, ein Abbild von möglichst unverwechselbarer Individualität herzustellen; hierfür waren je-
doch zuverlässige Vorlagen notwendig. Der Kaiser ließ vermutlich Porträts entwerfen, die seinen eigenen Vorstellungen entsprachen und sorgte
dafür, dass Kopien, vielleicht als Zeichnungen oder Gipsmodelle, zu den lokalen Werkstätten gelangten73. Es sind dadurch in weit auseinander
liegenden Gegenden einerseits eng übereinstimmende Trajansbildnisse zu finden, andererseits können diese auch der lokalen Tradition folgen
und stilistische Besonderheiten aufweisen. Zu dem vom Princeps und vom Senat in Rom geprägten Geld - Reichsprägung - gesellen sich Prä-
gestätten in den Provinzen, die mehr oder weniger den stadtrömischen Münzporträts nahestehen. Mit dem Bildnis Trajans prägten in Kleinasien
unter anderen die Städte Hierapolis, Kolophon und Ephesos, um nur einige zu nennen. Darunter sind Kopftypen mit jugendlichen, idealisie-
renden Zügen zu finden, die dem ephesischen Elfenbeinporträt gleichen. Sie stehen den frühen Reichsprägungen nahe74. Der ephesische Tra-
janskopf, der auf einem kräftigen Hals sitzt, zeigt ein längliches Gesicht mit großen Ohren, von den Nasenflügeln ausgehende Falten, tieflie-
gende Augen und eine stark betonte Mundpartie. Die unten etwas vorgewölbte Stirn geht mit einer leichten Einsattelung in eine gerade Nase
über. Die Haare sind oberhalb des rechten Brauenansatzes fast in Stirnmitte geteilt. Sie zeigen eine Frisur aus den Anfängen der Regierungszeit
des Trajan, doch findet man diese Mittelgabel auch bei späteren Porträts75. Die Gesamterscheinung, die Würde, Energie und Vitalität mit herr-
scherlicher Größe vereint, dient ebenfalls zur Charakterisierung des Imperators. In ähnlicher Haltung und Reisekleidung erscheint er auf der
Trajanssäule und auf dem Trajansbogen in Benevent76. Der originale Arm war wohl leicht angehoben. Dem antiken Restaurator hat bei seinen
Ausbesserungsarbeiten sicher der herabhängende rechte Arm des Feldherm von der linken Gruppe als Vorbild gedient. Dessen Gesichtszüge
(Taf. 6/19; 9/31 a) weisen, so weit das die Bestoßungen an Nase und Mund erkennen lassen, gewisse Ähnlichkeiten mit Trajan auf, sind aber
71 s. Kap. 1 S. 13 ff.
72 s. Gross 1940,16 ff.
73 Dazu Böschung 2002, 169.
74 Zu den Provinzialprägungen s. Gross 1940, 23 ff. Taf. 46 i (Hierapolis). 1 (Kolophon),
n (Ephesos). Vgl. a. O. Reichsprägung, 16ff. Taf. 43 b. c. g. i.
75 Dazu Gross 1940. 40 ff. Vgl. den Kopf in der Münchner Residenz, von Gross dem Typ 1
(früher Typus) zugeordnet, Taf. 21 c-d; weiters Bildnis auf der Trajanssäule, a. O.
Taf. 39 b; Trajanskopf, Venedig Archäologisches Museum, a. O. Taf. 5; Kapitolinische
Trajansbüste, a. O. Taf. 9. Nach Gross a. O. 74, Typ 1 auch später verwendet und im ge-
samten Reich anzutreffen; z. B. Kaiserkopf in Frankfurt mit faltigem, altem Gesicht,
Haartyp gleicht jedoch den frühen Bildnissen, a. O. Taf. 8.
76 Trajanssäule, Relief LXXVII s. Lehmann-Hartleben 1926, Taf. 36. Trajansbogen, rech-
tes Relief in der Durchfahrt von der Stadt aus gesehen (Alimentarverteilung), s. Hassel
1966, Taf. 1,1; linker Pfeiler Landseite, oberes Relief, s. Hassel a. O. Taf. 6,1.
55
Der große Relieffries mit Römern und Barbarengesandtschaften (Huldigungsfries), die Personifikationen von Provinzen, die Kampfhandlun-
gen (Kampffries) und die Täfelchen mit Halbfiguren römischer Krieger und Barbaren (Taf. 1/3; 5/18 a; 17/59; 20/73-76) gehören stilistisch
derselben Zeit an und haben wahrscheinlich einst einen größeren Komplex gebildet. Darauf weisen auch einige im Katalog angesprochene
kleine und kleinste zugehörige, aber nicht mehr aneinanderfügbare Bruchstücke hin, die sich im Depot des Ephesos-Museums in Selguk be-
finden. Es handelt sich hier um Fragmente von Römer- und Barbarenköpfen, von Armen, Händen, Beinen, Füßen und Gewandteilen, die ih-
ren Abmessungen nach zu den oben genannten Szenen gehören müssen. Das Thema ist die Zurschaustellung des siegreichen Heeres, seines
bzw. seiner Befehlshaber, der unterlegenen Barbaren und der damit verbundenen Erweiterung des Machtbereichs.
Den Auftrag zur Anfertigung der Schnitzereien hat vielleicht anläßlich einer Kaiserehrung die Stadt Ephesos oder ein reicher Büiger gege-
ben.
Zunächst ist zu klären, ob die Relieffolgen ganz allgemein den Sieg der römischen Zivilisation über ,primitive4 Barbarenvölker verherrlichen,
oder ob sie sich auf Begebenheiten aus der römischen Geschichte beziehen. In diesem Fall stellt sich die Frage, welche Vorkommnisse in der
kaiserlichen Eroberungspolitik angesprochen sein könnten.
Die nachfolgenden Deutungen der hier erstmals vorgestellten Szenen sind ein Versuch, der zur Diskussion anregen soll. Ein objektiv tragen-
des Fundament hierfür konnte schon deswegen nicht gefunden werden, weil die aus dem Schutt geborgenen Fragmente in Sekundärverwen-
dung standen71. Anläßlich der bereits erwähnten Restaurierung ist der originale Zusammenhang durch Abarbeitungen und Beschneidungen
einzelner Szenen, sowie durch spätere Ergänzungen beschädigter oder fehlender Stücke teilweise verlorengegangen. Da sich die einzelnen
Gruppenbilder aus mehreren separat geschnitzten Figuren zusammensetzen, ist bei der nachfolgenden Adaptierung auch eine Änderung der
einstigen Abfolge nicht auszuschließen.
Die während der Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten angestellten Versuche, die einzelnen Reliefabschnitte neu zu reihen, in der
Hoffnung, dadurch Hinweise auf eine eventuell andere Gruppierung aus der Entstehungszeit zu bekommen, waren nicht zielführend. Die
bestmögliche Anordnung ist die durch den Grabungsbefund erschlossene.
Ein Hindernis, die Darstellungen sicher zu interpretieren, sind auch der oder die fehlenden Barbaren auf der rechten Seite der Mittelgruppe
vom großen Fries (Taf. 9/30). Wären sie erhalten geblieben, hätte man vermutlich eine bessere Ausgangsposition.
Nachdem nun klar dargelegt ist, daß alle Deutungen nur Versuche sein können, möchte ich doch meine persönliche Sichtweise der Dinge vor-
legen, wobei den einzelnen Szenen aus der antiken Literatur bekannte historische Fakten gegenübergestellt werden sollen.
3.1. TRAJANISCHE RELIEFARBEITEN
Die Untersuchung muß bei dem eindeutig als Hauptperson des Geschehens hervorgehobenen Feldherm der Mittelgruppe des Huldigungs-
frieses beginnen. Schon bei der Bergung 1968 fielen im nur oberflächlich gereinigten Gesicht trajanische Züge ins Auge, die während der
nachfolgenden Konservierung an Deutlichkeit zunahmen (Taf. 3/10; 9/30; 10/32 a-c).
Trotz einer gewissen Idealisierung - der Kopf erinnert an den des ersten römischen Kaisers Augustus, den Trajan neben Alexander d. Gr. be-
wunderte und sich Zeit seines Lebens zum Vorbild nahm - gibt es einige typische Charakteristika. Die Züge des Imperators sind durch zahl-
reiche Porträtstatuen, Reliefdarstellungen und Münzen gesichert. Es wurden während seiner Regierungszeit mehrere Bildnistypen entwik-
kelt, die sich in ihren Gesamtproportionen, in der Schädelform, der Stimbildung und Haartracht, sowie durch mehr oder weniger Naturtreue
unterscheiden72.
Bildhauer und Münzschneider hatten die Aufgabe, ein Abbild von möglichst unverwechselbarer Individualität herzustellen; hierfür waren je-
doch zuverlässige Vorlagen notwendig. Der Kaiser ließ vermutlich Porträts entwerfen, die seinen eigenen Vorstellungen entsprachen und sorgte
dafür, dass Kopien, vielleicht als Zeichnungen oder Gipsmodelle, zu den lokalen Werkstätten gelangten73. Es sind dadurch in weit auseinander
liegenden Gegenden einerseits eng übereinstimmende Trajansbildnisse zu finden, andererseits können diese auch der lokalen Tradition folgen
und stilistische Besonderheiten aufweisen. Zu dem vom Princeps und vom Senat in Rom geprägten Geld - Reichsprägung - gesellen sich Prä-
gestätten in den Provinzen, die mehr oder weniger den stadtrömischen Münzporträts nahestehen. Mit dem Bildnis Trajans prägten in Kleinasien
unter anderen die Städte Hierapolis, Kolophon und Ephesos, um nur einige zu nennen. Darunter sind Kopftypen mit jugendlichen, idealisie-
renden Zügen zu finden, die dem ephesischen Elfenbeinporträt gleichen. Sie stehen den frühen Reichsprägungen nahe74. Der ephesische Tra-
janskopf, der auf einem kräftigen Hals sitzt, zeigt ein längliches Gesicht mit großen Ohren, von den Nasenflügeln ausgehende Falten, tieflie-
gende Augen und eine stark betonte Mundpartie. Die unten etwas vorgewölbte Stirn geht mit einer leichten Einsattelung in eine gerade Nase
über. Die Haare sind oberhalb des rechten Brauenansatzes fast in Stirnmitte geteilt. Sie zeigen eine Frisur aus den Anfängen der Regierungszeit
des Trajan, doch findet man diese Mittelgabel auch bei späteren Porträts75. Die Gesamterscheinung, die Würde, Energie und Vitalität mit herr-
scherlicher Größe vereint, dient ebenfalls zur Charakterisierung des Imperators. In ähnlicher Haltung und Reisekleidung erscheint er auf der
Trajanssäule und auf dem Trajansbogen in Benevent76. Der originale Arm war wohl leicht angehoben. Dem antiken Restaurator hat bei seinen
Ausbesserungsarbeiten sicher der herabhängende rechte Arm des Feldherm von der linken Gruppe als Vorbild gedient. Dessen Gesichtszüge
(Taf. 6/19; 9/31 a) weisen, so weit das die Bestoßungen an Nase und Mund erkennen lassen, gewisse Ähnlichkeiten mit Trajan auf, sind aber
71 s. Kap. 1 S. 13 ff.
72 s. Gross 1940,16 ff.
73 Dazu Böschung 2002, 169.
74 Zu den Provinzialprägungen s. Gross 1940, 23 ff. Taf. 46 i (Hierapolis). 1 (Kolophon),
n (Ephesos). Vgl. a. O. Reichsprägung, 16ff. Taf. 43 b. c. g. i.
75 Dazu Gross 1940. 40 ff. Vgl. den Kopf in der Münchner Residenz, von Gross dem Typ 1
(früher Typus) zugeordnet, Taf. 21 c-d; weiters Bildnis auf der Trajanssäule, a. O.
Taf. 39 b; Trajanskopf, Venedig Archäologisches Museum, a. O. Taf. 5; Kapitolinische
Trajansbüste, a. O. Taf. 9. Nach Gross a. O. 74, Typ 1 auch später verwendet und im ge-
samten Reich anzutreffen; z. B. Kaiserkopf in Frankfurt mit faltigem, altem Gesicht,
Haartyp gleicht jedoch den frühen Bildnissen, a. O. Taf. 8.
76 Trajanssäule, Relief LXXVII s. Lehmann-Hartleben 1926, Taf. 36. Trajansbogen, rech-
tes Relief in der Durchfahrt von der Stadt aus gesehen (Alimentarverteilung), s. Hassel
1966, Taf. 1,1; linker Pfeiler Landseite, oberes Relief, s. Hassel a. O. Taf. 6,1.
55